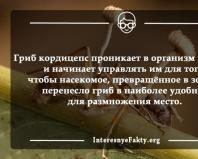Ethik als praktische Philosophie: Gegenstand, Struktur, moderne Probleme und Aufgaben. Definieren Sie den Begriff „Ethik“
lat. - Disposition, Sitte) ist ein Zweig des philosophischen Wissens, der die Natur von Moral und Moral, die Gesetze ihrer historischen Entwicklung und ihre Rolle im öffentlichen Leben untersucht. Die Ethik untersucht die Normen des menschlichen Lebens unter dem Gesichtspunkt von Gut und Böse. Moral kann auf verschiedenen Ideen basieren: religiöse moralische Sanktion, Eudaimonismus als selbstsüchtiges Streben nach Glück, Klasseninteressen usw. Es gibt christliche Ethik, die auf den moralischen Idealen der Bibel, auf der Anerkennung der Bergpredigt und den dreien basiert heilige Tugenden – Glaube, Hoffnung und Liebe, Ideen von Sünde und Erlösung. Hinzu kommt die Berufsethik, insbesondere die Pädagogik. Ethik spielt im menschlichen Leben eine große Rolle. Dabei handelt es sich um eine Art Schutzsystem gegen völligen Eigenwillen und normative Normen für ein konfliktfreies Miteinander.
Hervorragende Definition
Unvollständige Definition ↓
ETHIK
lat ethica, aus dem Griechischen etmke tech-ne – Wissenschaft und Kunst der Moral), die Lehre von der Moral, Moral. Der Begriff „E“ wurde von Aristoteles eingeführt, der E zwischen die Lehre von der Seele (Psychologie) und die Lehre von stellte Der Staat (Politik) war ein zentraler Bestandteil von E. Er betrachtete die Lehre von den Tugenden als Moral. Sein System enthielt trotz Persönlichkeitsmerkmalen bereits viele „ewige Fragen“ über die Natur und Quelle der Moral, über den freien Willen und die Grundlagen der Moral. Handlungen, das höchste Gut, Gerechtigkeit usw.
Im Laufe seiner Geschichte fungierte E gleichzeitig als praktische (Moral-)Philosophie, als Lehre von einem korrekten und würdigen Leben und als Wissen über Moral (über ihre Natur, Herkunft usw.). Somit hat E zwei gesellschaftlich bedeutsame Funktionen erfüllt – moralisch-pädagogisch und kognitiv-pädagogisch. Die relative Unabhängigkeit und die Diskrepanz zwischen diesen Funktionen dienten als Grund für die allmähliche Trennung zweier miteinander verbundener Teile innerhalb von E – normatives E und theoretisches. E, jeweils auf das Studium des Lebens und auf die Kenntnis der Moral ausgerichtet. In der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts führte die Abgrenzung dieser Teile von E zu ihrer tatsächlichen Registrierung in verschiedenen Disziplinen. Diese Differenzierung ist größtenteils auf die Didaktik zurückzuführen. Anforderungen im Zusammenhang mit der Organisation des E-Unterrichts in Bildungseinrichtungen (Schulen, Hochschulen, Universitäten usw.) Die Einbeziehung von E in Bildungsprogramme ist ein für alle entwickelten Länder charakteristischer Trend. Ein E-Kurs kann mit dem Ziel eingeführt werden, positiv zu sein Auswirkungen auf die Moral. Bewusstsein der Studierenden, über ihre Wertorientierungen, in diesem Fall besteht der Inhalt des Kurses hauptsächlich aus normativen Komponenten der Ethik. Wenn in der Lehre das akzentuierte Ziel darin besteht, die Weltanschauungskultur der Schüler zu stärken, ihnen Wissen über die Gesellschaft, die Mechanismen ihrer Regulierung (einschließlich Moral) usw. zu vermitteln, dann liegt der Schwerpunkt auf der Wissenschaft. -Erklären Sie Aspekte von E. Obwohl erwartet, dass sie pädagogisch oder kognitiv sind. Das Ergebnis des Unterrichts in diesem Fach hängt von der Methode ab und enthält Faktoren, die die anfängliche Wahl zwischen normativ und theoretisch beeinflussen. E als Grundlage des Bildungsgangs ist von entscheidender Bedeutung. Beispielsweise die vom Lehrer geplante Moral. -gebildet Die Wirkung des von ihm entwickelten Kurses E wird oft nicht erreicht, weil den Studierenden hauptsächlich beschreibendes und erklärendes (theoretisches) Material präsentiert wird. Ein solcher Fehler ist meist eine Folge der im pädagogischen Umfeld tief verwurzelten „Aufklärungs“-Illusion dass jedes Wissen (und insbesondere Wissen über Moral) an sich für den Einzelnen von Vorteil ist, ihn moralisch erhebt usw. Um solche Fehler beim Unterrichten von E zu vermeiden, ist es notwendig, klar zwischen normativ und theoretisch zu unterscheiden. Probleme
Normative Ethik ist ein System moralistischen Denkens, das darauf abzielt, die Grundlagen der Moral in der Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Werte Ziel ist es, Antworten auf Fragen nach Gut und Böse, nach dem richtigen Verhalten eines Menschen in alltäglichen Lebenssituationen zu formulieren. Normativ und ethisch. Die Lehre verkündet und verteidigt eine bestimmte moralische Position und drückt sie in der Form der Moral aus. Ideale, Prinzipien, Regeln und Verhaltensnormen Im Gegensatz zum nackten Moralisieren, das durch Erbauung, Suggestion, Verweis auf Autoritäten und Vorbilder gekennzeichnet ist, beruft sich das normative E auf die Vernunft, ihre Methoden sind Beweis, Argumentation, Argumentation. Wenn Moralisieren wie Päd. Während die Technik für ein unentwickeltes (kindliches oder unkultiviertes) Bewusstsein geeignet ist, richtet sich normatives E. an eine kritisch denkende Person, die in der Lage ist, alle Postulate in Frage zu stellen. Vernünftige Argumente für bestimmte moralische Bestimmungen tragen zur Umwandlung eines gesellschaftlichen Imperativs (moralische Norm) außerhalb des Individuums in einen internen bei. Impuls (Pflichtgefühl, moralische Motivation des Verhaltens). Regulatorisch und ethisch Reflexion und Evidenz bilden eines der Mittel zur Bildung von Moral. Überzeugungen.
Philosoph sein Im Rahmen der Disziplin geht es der normativen Ethik nicht direkt um den Nachweis spezifischer, privater moralischer Einschätzungen und Vorschriften. Entwicklung und Begründung der Moral. Imperative in Bezug auf individuelle oder typische Situationen, denen Menschen in ihrem persönlichen und gesellschaftlichen Leben begegnen. Leben, ist das Tätigkeitsfeld von Predigern, Literaturmoralisten, Lehrern, Schöpfern von Prof. ethisch Codes („medizinisches E.“, „Geschäfts-E.“ usw.), d. h. im Allgemeinen Pädagogen im weitesten Sinne dieses Konzepts. All diese Aktivitäten stehen für Konkretisierung und Praktikabilität. die Anwendung bestimmter allgemeiner Ethikregeln. Prinzipien; Somit verlässt sich der Lehrer letztendlich auf die eine oder andere philosophische Norm und Ethik. Position.
Die Besonderheit der normativen Ethik als Moralphilosophie besteht darin, dass sie eine rationale Grundlage für Grundwerte liefert, die dem praktizierenden Pädagogen als Leitfaden dienen. CH. Aufgabe der Philosophie Begründungen der Moral – um ihnen einen überindividuellen Status zu verleihen und die Unbedingtheit moralischer Anforderungen zu bekräftigen. Ein Moralphilosoph spricht in der Regel nicht in seinem eigenen Namen, nicht im Namen eines Kandidaten. soziale Institution (in diesen Fällen würden ihre Urteile den Stempel der Willkür und Optionalität tragen), sondern als Dirigent einer höheren Idee. Moralische Imperative und Bewertungen erhalten einen solchen unbestreitbaren Status, indem sie ihnen entweder eine heilig-übernatürliche (mystische, göttliche) oder eine natürlich-objektive Bedeutung verleihen. Im ersten Fall werden die kategorischen Prinzipien und Normen der Moral durch die absolute Autorität Gottes gewährleistet, im zweiten Fall durch die Zugehörigkeit zur objektiven Weltordnung, mit deren unweigerlich wirkenden Gesetzen der Mensch rechnen muss. Diese beiden Arten der Rechtfertigung der Moral bestimmen die allgemeinen Richtungen der normativen und ethischen. Gedanken, in denen es zahlreiche gibt. Geäst.
In der Religion Lehren ist das Leitmotiv der autoritären Begründung der Moral das Verständnis Gottes als Personifikation des Guten und der Normen der Moral als Gottheiten, Gebote, wodurch diese Normen im Bewusstsein des Gläubigen eine positive und bedingungslos verbindliche Bedeutung erhalten . Oft handelt Gott als allwissender Hüter seiner Gebote und belohnt einen Menschen unweigerlich entsprechend seinen Sünden und Verdiensten. In diesem Fall wird die Moral nicht so sehr durch die heilige Autorität und den inneren Wert des Guten gestützt, sondern durch die Androhung einer Strafe oder das Versprechen einer Belohnung, sodass die eigentliche moralische Bedeutung einer solchen Rechtfertigung verschwindet. Allerdings war der autoritäre Ansatz in der Geschichte der Ethnizität nicht vorherrschend. Die zweite Methode, die mit der Objektivierung moralischer Werte verbunden war, nahm einen viel größeren Platz ein, wodurch sie unumstritten und in diesem Sinne absolut wurden. Durch den Nachweis der Objektivität des Guten, der Pflicht usw. begründet der Philosoph damit diese Werte und zwingt einen vernünftigen Menschen, sie zu akzeptieren und ihnen zuzustimmen. So ist in den Lehren Platons Güte oder Nutzen eine objektiv existierende „Idee“, die in ihrer reinen Form den integralen höchsten Wert als solchen verkörpert. Solche Werte erhalten, sobald ihre Objektivität erkannt wird, unmittelbar eine normative, zielführende Bedeutung. Platon glaubte in Anlehnung an Sokrates (mit gewissen Vorbehalten), dass ein Mensch, der das objektive Gute erkennt, dadurch tugendhaft wird. Der Philosoph interpretierte die Objektivität der Moral unterschiedlich. Rationalismus der Neuzeit, der Normatives und Ethisches auflöst. Probleme der Erkenntnistheorie. Für R. Descartes, G. W. Leibniz, I. Kant bedeutete die Objektivität eines bestimmten Urteils (einschließlich moralischer) seine Logik. Notwendigkeit, Zwang für den Geist. Der berühmte kategorische Imperativ war eine solche notwendige Position (Maxime), mit der, wie Kant glaubte, jedes vernünftige Wesen nur zustimmen kann, und daher ist die Formulierung dieser Maxime selbst bereits ihre rationale Rechtfertigung. Eine ähnliche Position vertraten Vertreter des Intuitionismus des 18.-20. Jahrhunderts. (R. Price, J. E. Moore usw.); Ihrer Ansicht nach wird „moralische Wahrheit“ direkt (intuitiv) als selbstverständlich wahrgenommen, was ihr als Rechtfertigung dient. Diese Konzepte erkannten die Autonomie der Moral an, d.h. es wurde davon ausgegangen, dass es sich um ein eigenes handelte. Die Grundsätze der Moral sind objektiv, absolut und bedürfen keiner Verstärkung von außen.
Die Konzepte der heteronomen Ethik machen die Prinzipien der Moral von anderen, tieferen und stärkeren Grundlagen abhängig, die diesen Prinzipien Halt, Sicherheit und Verbindlichkeit verleihen. Solche Gründe sind vielfältig. Philosoph Bestimmungen, in denen bestimmte Merkmale der Welt, der Gesellschaft und des Menschen festgelegt werden. So diente die Idee der Weltnotwendigkeit, der objektiven Vorherbestimmung aller Ereignisse, ihrer Unfähigkeit, den Menschen zu kontrollieren, als Grundlage für eine Lebenslehre, die Demut, Selbstbeherrschung, weise Leidenschaftslosigkeit usw. predigte. [Anweisungen auf Chinesisch (Taoismus) und anderes Griechisch. (Stoizismus) Philosophie]. Aus Vorstellungen über die objektive „Gesetzgebung“ der Natur entstanden Gebote wie „Im Einklang mit der Natur leben“, „Alles Natürliche ist gut“ usw. (die Lehren anderer griechischer Philosophen – Zyniker, Sophisten usw.). Wenn damit nicht die äußere, sondern die menschliche Natur gemeint war, dann wurden diese Imperative in Aufrufe umgewandelt: „Höre auf die Stimme deiner eigenen Natur“, „folge deinen natürlichen Bestrebungen“ usw., die die Grundlage für normative und ethische Grundsätze bildeten. Naturalismus, vertreten durch die Lehren des Hedonismus, Eudaimonismus und der Theorie des Egoismus.
Im 19.-20. Jahrhundert. Weit verbreitet sind Vorstellungen, in denen die Moral durch Bezugnahme auf objektive Gesetze der Entwicklung der Natur oder Gesellschaft begründet wird, d. h. Handlungen, die mit der Richtung der Natur im Einklang standen, wurden als angemessen oder gerechtfertigt anerkannt. Evolution (evolutionäres E.) oder entsprechend dem objektiven Verlauf, den Trends, den „objektiven Bedürfnissen“ der Geschichte (marxistischer E.). Eine besondere Linie bilden Konzepte, bei denen nichtmoralische Werte die Rolle der objektiven Grundlage der Moral spielen. Die „Objektivität“ dieser Werte wird oft mit ihrer sozialen, d.h. überindividueller oder übergruppenübergreifender Status und in diesem Fall Moral. Der an eine Einzelperson oder eine Gruppe gerichtete Imperativ wird wie folgt gerechtfertigt: Etwas ist gut oder angemessen, weil es dem öffentlichen (allgemeinen) Wohl, dem sozialen Fortschritt, der Errichtung eines gerechten Systems, den Interessen des Staates oder der Nation dient oder darauf abzielt das Größte zu erreichen. Glück für die meisten Anzahl der Menschen (Utilitarismus) usw. In anderen Fällen werden objektive außermoralische Werte als „nichtmenschlich“, absolut, überragend (Gottheiten, Eigenwille, „über“ dem Guten stehen; kosmische Ziele usw.) verstanden. ), so dass moralisch die Würde des Handelns, die Verbindlichkeit der entsprechenden Weisungen durch deren Unterordnung unter das Höchste bestimmt wird. Werteziele (Teleologie, Lehre von der Zweckmäßigkeit der Weltordnung).
Die theoretische Ethik ist eine Wissenschaft, die Moral als ein besonderes gesellschaftliches Phänomen beschreibt und erklärt. Diese Wissenschaft beantwortet die Fragen: Was ist Moral, wie unterscheidet sie sich von anderen Gesellschaften? Phänomene; Was ist sein Ursprung, wie hat es sich historisch verändert; Was sind die Mechanismen und Muster seiner Funktionsweise? Welche soziale Rolle spielt es usw. All diese Fragen wurden erst im 18. Jahrhundert explizit formalisiert. Kant sah die Besonderheit der Moral in der Selbstgenügsamkeit, unbedingten Verbindlichkeit und Allgemeingültigkeit ihrer Imperative (Formalismus, Absolutismus). A. Shaftesbury, D. Hume und andere sahen den Unterschied als Zeichen moralischer Einschätzungen und Vorschriften in ihrem besonderen Geisteszustand. Substrat - „Moral. Gefühle“ (Psychologismus). Hume bemerkte auch logisch. die Einzigartigkeit moralischer Aussagen („Urteile darüber, was sein sollte“), ihre Nichtableitbarkeit aus Aussagen über Tatsachen („Urteile darüber, was ist“). Die Entwicklung dieses Gedankens war die Idee der Unmöglichkeit der Wissenschaft. Begründung der Moral (Neopositivismus), das Vorhandensein einer besonderen („deontischen“) Logik des moralischen Denkens usw. Für Vertreter des Intuitionismus bedeutete die Spezifität der Moral die Irreduzibilität eines moralischen Motivs auf ein anderes, die Einzigartigkeit des Inhalts von moralische Konzepte (Gut, Pflicht), ihre Nichtreduzierbarkeit auf andere Inhalte. Daher qualifizierte Moore jede Definition des Guten durch andere Konzepte als „naturalistisch“. Fehler"; Dieser Fehler ist seiner Meinung nach charakteristisch für den gesamten Text „sch. E. Mn. Philosophen verschiedene Richtungen (Aristoteles, Kant, A. Schopenhauer usw.) erkannten den freien Willen als notwendiges Zeichen des moralischen Bewusstseins, ohne das ihrer Meinung nach eine moralische Wahl und damit die moralische Verantwortung des Einzelnen unmöglich ist. Gleichzeitig stand der freie Wille entweder der natürlichen (einschließlich mentalen) Bestimmung oder der übernatürlichen Vorherbestimmung (Voluntarismus, Determinismus, Fatalismus) entgegen. Das Problem der Willensfreiheit wurde auch in einem anderen Kontext gestellt – im Zusammenhang mit der Klärung der Quelle der Moral, ihres Ursprungs. Freier Wille wurde in diesem Fall nicht mehr als Voraussetzung für eine moralisch verantwortliche Wahl zwischen Gut und Böse betrachtet, sondern als die Fähigkeit eines Menschen, seine Werte willkürlich festzulegen, das Kriterium von Gut und Böse festzulegen (Existentialismus, Personalismus).
Im 19.-20. Jahrhundert. Theoretische Probleme Die Ethik fiel zunehmend in den Zuständigkeitsbereich einzelner Wissenschaften, zu deren Fachgebiet auch die Moral gehörte. So erhellt die Soziologie (einschließlich der Sozialpsychologie) die Phylogenie der Moral und ihrer Gesellschaften. Funktionen, der Inhalt ihrer Prinzipien und Normen, die Beziehung zu anderen sozialen Phänomenen usw. Die Personalpsychologie untersucht die Ontogenese der Moral, ihre mentale. Substrat und Mechanismus. Die Ethologie sucht im Verhalten von Tieren nach den Voraussetzungen menschlicher Moral. Logik und Linguistik erforschen die Sprache der Moral, Regeln und Formen des Normativen und Ethischen. Argumentation. Theoretisch E. vereint all diese wissenschaftlichen Erkenntnisse. Daten über Wesen, Ursprung und Funktionsweise der Moral; Es deckt ein breites Wissensspektrum ab, einschließlich der Philosophie. wird die Konzepte und Ideen erläutern, aus denen sich die Methodik zusammensetzt. wissenschaftliche Basis Kenntnis der Moral.
Praktisch theoretischer Wert E. liegt darin, dass das dadurch gewonnene Wissen über die Gesetze und Bedingungen der Bildung und Veränderung der Moral für das Bewusstsein genutzt werden kann. Eingreifen in diesen Prozess, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen, beispielsweise die Festigung bestimmter Moralvorstellungen im Bewusstsein des Einzelnen. Installationen. Theoretisch Bildung selbst beinhaltet natürlich keine spezifischen Methoden der moralischen Erziehung, sondern dient als methodisches Instrument. die Grundlage für die entsprechende praxisorientierte Disziplin (Theorie der Moralerziehung). Wenn normative E., die moralische Werte rechtfertigen, die Moral beeinflussen können. Position des Individuums direkt durch seinen eigentlichen Inhalt, dann den Einfluss des Theoretischen. E. wirkt indirekt – durch die Entwicklung von Methoden und Techniken der moralischen Erziehung. Aktivitäten. Daher Unterricht theoretisch E. hat seine eigenen Eigenschaften: als Lehrer. Disziplin, es richtet sich nicht an ein Publikum, das aus „gebildeten“ Menschen besteht, sondern aus Pädagogen. Es empfiehlt sich, es in Aus- und Fortbildungsprogramme für Lehrkräfte einzubeziehen.
Lit.: Moore J. E., Grundsätze der Ethik, M., 1984; Guseinov A. A., Irrlitz G., A Brief History of Ethics, M., 1987; Maksimov P.V., Das Problem der Begründung der Moral, M., 1991. L.V. Maksimov.
Hervorragende Definition
Unvollständige Definition ↓
Vorlesungsübersicht:
1. Wie entstand die Ethik?
1. Wie entstand die Ethik?
Bevor wir den Themenbereich Ethik definieren, betrachten wir dessen Ursprung.
Die Ethik entsteht zusammen mit der Philosophie und ist ihr Abschnitt. Die Philosophie als Kulturzweig hat ihren Ursprung im antiken Griechenland. Dies wurde durch die Tatsache erleichtert, dass es im antiken Griechenland eine Tradition freier Diskussionen und der Fähigkeit zum Streiten gab, die sich im Zeitalter der Demokratie entwickelte, als sich alle freien Bürger der antiken griechischen Städte auf dem Hauptplatz versammelten und gemeinsam ihre Angelegenheiten besprachen. Wir hören allen zu und treffen Entscheidungen mit Mehrheitsbeschluss.
Natürlich sind die Menschen seit ihrer Intelligenz (also vor Millionen von Jahren) in der Lage zu denken. Aber als Disziplin mit einem bestimmten Konzeptsystem entstand die Philosophie in der Mitte des ersten Jahrtausends vor Christus. Philosophie als Disziplin beginnt dort, wo sich ein Mensch theoretisch von der Welt um ihn herum abgrenzt und beginnt, über abstrakte Konzepte zu sprechen.
Im antiken Griechenland begann man, die Philosophie in drei Hauptteile zu unterteilen: Logik, Metaphysik und Ethik. Als Teil der Philosophie versucht auch die Ethik, Konzepte zu bilden, allerdings nicht über die ganze Welt, sondern über die allgemeinsten Formen menschlichen Verhaltens. Gegenstand der Ethik ist die Untersuchung des Handelns von Menschen, um Verhaltensmuster zu erkennen. Gleichzeitig erscheint Ethik als die Kunst, richtig zu leben und die Fragen zu beantworten: Was ist Glück, was ist gut und böse, warum sollte man so und nicht anders handeln und was sind die Motive und Ziele des Handelns der Menschen? .
Außerdem ist Ethik nicht nur ein integraler Bestandteil der Philosophie, sondern vielmehr der Rahmen der Kultur. In allen historischen Stadien der kulturellen Entwicklung drückten ethische Normen ihren Hauptinhalt aus, und die Trennung der Kultur von der Ethik ging immer mit ihrem Niedergang einher.
2. Inhalt der Begriffe: Ethik, Moral, Moral
Der Begriff „Ethik“ leitet sich vom altgriechischen Wort „ethos“ (Ethos) ab. Ursprünglich bedeutete „Ethos“ Wohnort, Heimat, Zuhause. Anschließend begann es, die stabile Natur eines Phänomens, einer Sitte, einer Disposition oder eines Charakters zu bezeichnen.
Ausgehend vom Wort „ethos“ im Sinne von „Charakter“ bildete Aristoteles das Adjektiv „ethisch“, um eine besondere Klasse menschlicher Eigenschaften zu bezeichnen, die er ethische Tugenden nannte. Ethische Tugenden sind Eigenschaften des Charakters und des Temperaments einer Person; sie werden auch spirituelle Qualitäten genannt. Um die Gesamtheit der ethischen Tugenden zu bezeichnen und das Wissen über sie als besondere Wissenschaft hervorzuheben, führte Aristoteles den Begriff „Ethik“ ein.
Um den aristotelischen Begriff „ethisch“ genau aus dem Griechischen ins Lateinische zu übersetzen, prägte Cicero den Begriff „moralis“ (moralisch). Er bildete es aus dem Wort „mos“ – dem lateinischen Analogon des griechischen „ethos“, was Charakter, Temperament, Bräuche bedeutet.
Insbesondere Cicero sprach von Moralphilosophie und verstand darunter dasselbe Wissensgebiet, das Aristoteles Ethik nannte. Im 4. Jahrhundert n. Chr. Der Begriff „moralitas“ (Moral) erscheint im Lateinischen als Analogon zum griechischen Begriff „Ethik“.
Beide Wörter, eines griechischen und das andere lateinischen Ursprungs, kommen in modernen europäischen Sprachen vor. Daneben gibt es in einer Reihe von Sprachen eigene Wörter, die dasselbe bedeuten wie die Begriffe „Ethik“ und „Moral“. Auf Russisch ist das „Moral“.
In seiner ursprünglichen Bedeutung Ethik, Moral, Moral meine das Gleiche. Mit der Zeit ändert sich die Situation und verschiedenen Wörtern werden unterschiedliche Bedeutungen zugewiesen: Unter Ethik verstehen wir hauptsächlich den entsprechenden Wissenszweig, die Wissenschaft, und unter Moral (Moral) das von ihr untersuchte Fach.
Die folgende Definition von Ethik kann gegeben werden.
Ethik ist eine besondere humanitäre Lehre (Wissenschaft), deren Gegenstand die Moral ist und deren zentrales Problem Gut und Böse ist.
Das Ziel der Ethik besteht darin, ein optimales Modell menschlicher und fairer Beziehungen zu schaffen, das eine qualitativ hochwertige Kommunikation gewährleistet.
Die Hauptfrage der Ethik besteht darin, zu definieren, was gutes Verhalten ist, was ein Verhalten richtig oder falsch macht.
Daher in der einfachsten Formulierung: Moral und Moral sind die Vorstellungen der Gesellschaft und des Einzelnen über Gut und Böse, darüber, wie man gut und wie man schlecht handelt.
Ist es möglich, eine einzige wissenschaftliche Definition von Moral zu geben?
Diese Frage war in der gesamten Geschichte dieser Wissenschaft der Ausgangspunkt der Ethik. Verschiedene Schulen und Denker geben unterschiedliche Antworten auf diese Frage. Es gibt keine einheitliche, unumstrittene Definition von Moral. Und das ist keineswegs zufällig. Moral ist nicht einfach etwas, das ist. Vielmehr ist es so, wie es sein sollte. Und für verschiedene Völker und sogar für dasselbe Volk zu unterschiedlichen Zeiten variiert dieses „sollte sein“ erheblich. Zum Beispiel wird Moses‘ „Auge um Auge und Zahn um Zahn“ schließlich durch das „Wenn du auf die rechte Wange geschlagen wirst, wende deine linke“ ersetzt.
In der modernen Gesellschaft gibt es zwei Ansätze zum Verständnis der Begriffe Moral und Ethik. Im ersten Fall meinen sie dasselbe, im zweiten bezieht sich Moral auf die Gesellschaft und Moral auf das Individuum.
Entsprechend der Einteilung in Moral und Ethik in der Ethik lassen sich zwei Richtungen unterscheiden: die Sozialethik, die die Grundlagen und Entwicklung der Moral in der Gesellschaft untersucht, und die Individualethik, die sich mehr für die Quellen des inneren moralischen Gefühls interessiert.
Gleichzeitig stimmen die Vorstellungen einer Person möglicherweise nicht mit den Vorstellungen der Gesellschaft überein. So kann ein von Leidenschaften besessener Mensch die in der Gesellschaft akzeptierten Verbote und Vorschriften ignorieren. Umgekehrt kann das, was in der Gesellschaft akzeptabel ist, bei einer Person mit hoher Moral Ablehnung hervorrufen (z. B. Alkohol trinken, rauchen, Tiere jagen usw.).
Somit ist Ethik die Sphäre objektiver Wissenschaftsideen; Moral ist der Bereich sozialer Vorschriften und Bräuche; Moral ist die Sphäre innerer Einstellungen, die den inneren Regulator – das Gewissen einer Person – durchlaufen haben. Wir können jedoch die Wörter moralisch und moralisch in derselben Bedeutung verwenden, zum Beispiel: „moralischer Akt“ und „moralischer Akt“; „moralische Herrschaft“ und „moralische Herrschaft“.
Und obwohl es noch keine einheitliche Formulierung des Begriffs „Moral“ gibt, können wir in verallgemeinerter Form die folgende kurze und prägnante Formulierung geben:
„Moral (Moral) ist eine Reihe von Normen, Werten, Idealen und Einstellungen, die das menschliche Verhalten regulieren und die wichtigsten Bestandteile der Kultur sind.“
Warum ist es so wichtig, moralisch zu sein? Die Antwort ist einfach. Stellen wir uns zwei Menschen mit dem gleichen Maß an Wissen, gleich entwickelter Intelligenz und gleichem Wohlstand vor. Wo werden sie ihre Werte einsetzen: für gute oder böse Taten? Nur derjenige von beiden, der moralisch ist, wird alles, was er erworben hat, zu guten Zwecken lenken. Und je höher sein moralisches Niveau ist, desto höheren Zielen wird er nicht nur seinen Reichtum, sondern auch sein Leben widmen.
3. Moral aus göttlicher Sicht.
Alles, worüber wir oben über Moral gesprochen haben, bezieht sich auf die Ansichten der menschlichen Gemeinschaft und ihrer einzelnen Vertreter. Aber es gibt einen höheren Standpunkt zur Moral – die göttliche Moral. Was ist es?
Gott hat unsere Welt nach seinen Gesetzen geschaffen. UND Menschen als göttliche Geschöpfe müssen diesen Gesetzen folgen und sich freiwillig dem göttlichen Plan unterwerfen. Das heißt, je näher die innere Einstellung eines Menschen an den göttlichen Geboten ist, desto moralischer ist er. Das Befolgen der göttlichen Gesetze führt die Menschheit auf dem evolutionären Weg, wenn sie ihnen nicht folgt, wirft sie sie an den Rand des evolutionären Stroms, und dann unterliegt dieses „widerspenstige Material“ der Verarbeitung.
Können wir sagen, dass sich die Menschheit zielgerichtet und zielgerichtet weiterentwickelt und dabei den Gesetzen ihres Schöpfers folgt? Die moralische Situation, die sich mittlerweile in der Gesellschaft entwickelt hat, lässt uns daran zutiefst zweifeln.
Um die Situation zu korrigieren und der Menschheit zu helfen, sandte und sendet Gott ständig seine Helfer in die Welt. Zu allen Zeiten wurde diese höchste Moral von Propheten und Boten Gottes in Form von Geboten und Bündnissen auf die Erde gebracht. Im Laufe der Zeit wurden diese Gebote in Religionen und philosophische Lehren formalisiert. Durch die Erfüllung der göttlichen Gebote entwickelte sich die Menschheit schrittweise weiter, verbesserte sich sowohl individuell als auch durch die Schaffung von Traditionen, die die menschliche Gemeinschaft als Ganzes verbesserten.
Im nächsten Thema machen wir einen historischen Ausflug und betrachten moralische Bündnisse in den Religionen und Lehren der Welt. Wir werden ihre Einheit entdecken und ihre Entwicklung verfolgen.
Eine Reihe von Vorträgen zum Thema Ethik wurde von E.Yu. Ilina
Fragen zur Festigung:
1. Wie sind die Begriffe „Ethik“ und „Moral“ entstanden?
2. Welche allgemeine Definition kann der Moral gegeben werden?
3. Was ist Ihrer Meinung nach die höchste Moral?
Kants „formale“ Pflichtenethik entwickelte eine „materielle“ (substantielle) Werteethik. Das Problem von Gut und Böse steht weiterhin im Mittelpunkt der Ethik.
Die Bedeutung des Wortes Ethik laut Ushakovs Wörterbuch:
ETHIK
Ethik, Plural Jetzt. (von griech. ithos – Brauch). 1. Philosophische Lehre über Moral, über die Regeln menschlichen Verhaltens. Ethik Stoiker. Idealistisch Ethik. Kant. Materialistisch Ethik. 2. Verhaltensstandards, Moral, eine Reihe moralischer Regeln unter Mitgliedern einer bestimmten Gruppe. Gesellschaft, was auch immer soziale Gruppe, Beruf. Party Ethik. Medizinisch Ethik. Sportunterricht Ethik. Bourgeois Ethik. Proletarskaja Ethik.
Definition des Wortes „Ethik“ nach TSB:
Ethik(Griechisch ethikб, von ethikós – sich auf Moral beziehend, moralische Überzeugungen ausdrückend, Ethos – Gewohnheit, Brauch, Gesinnung)
philosophische Wissenschaft, deren Untersuchungsgegenstand Moral ist, Moral als eine Form des sozialen Bewusstseins, als einer der wichtigsten Aspekte des menschlichen Lebens, ein spezifisches Phänomen des sozio-historischen Lebens. Die Wirtschaftswissenschaften klären den Platz der Moral im System anderer gesellschaftlicher Beziehungen, analysieren ihr Wesen und ihre innere Struktur, untersuchen den Ursprung und die historische Entwicklung der Moral und untermauern theoretisch das eine oder andere ihrer Systeme.
Im östlichen und antiken Denken war die Ethik zunächst mit Philosophie und Recht verschmolzen und hatte den Charakter einer vorwiegend praktischen Morallehre, die die körperliche und geistige Hygiene des Lebens lehrte. Die aphoristische Form solcher Morallehren ging auf die mündliche Überlieferung zurück, die bereits in der späten Clangesellschaft das für das soziale Ganze (Gemeinschaft, Stamm) praktisch Nützliche im Verhalten eines Einzelnen verstärkte. E.s Bestimmungen wurden direkt aus der Natur des Universums, aller Lebewesen, einschließlich des Menschen, abgeleitet, was mit der kosmologischen Natur der östlichen und antiken Philosophie verbunden war. Es ist charakteristisch, dass die Verteidigung eines Moralsystems und die Verurteilung eines anderen auf Opposition beruhten
„das ewige Gesetz der Natur“ zu „menschlichen Institutionen“ (Lao Tzu im alten China, Hesiod im antiken Griechenland usw.). Auch ein Appell an die geistige Welt des Einzelnen (Buddha, Sokrates) führte nicht zur Isolation der Philosophie in eine eigenständige Theorie, sondern zu einem moralischen Verständnis der philosophischen Weltanschauung als Ganzes.
Die Ethik wurde von Aristoteles als besondere Disziplin hervorgehoben (er führte den Begriff selbst ein - im Titel seiner Werke „Nikomachische Ethik“, „Große Ethik“, „Eudemische Ethik“), der sie zwischen der Seelenlehre (Psychologie) einordnete ) und der Staatslehre (Politik). : Basierend auf der ersten dient sie der zweiten, da ihr Ziel darin besteht, einen tugendhaften Staatsbürger zu bilden. Obwohl Aristoteles‘ zentraler Teil der Ethik die Lehre von Tugenden als moralischen Eigenschaften des Einzelnen war, haben in seinem System bereits viele sogenannte Prinzipien ihren Ausdruck gefunden.
„ewige Fragen“ von E.: über Natur und Moral, über den freien Willen und die Grundlagen moralischen Handelns, den Sinn des Lebens und das höchste Gut, Gerechtigkeit usw.
Von den Stoikern (siehe Stoizismus) stammt die traditionelle Einteilung der Philosophie in drei Bereiche – Logik, Physik (einschließlich Metaphysik) und Elemente. Sie durchläuft das Mittelalter und wird von der Philosophie der Renaissance und des 17. Jahrhunderts übernommen. Diese Einteilung wird auch von I. Kant akzeptiert, der sie lediglich mit einer Unterscheidung zwischen den Lehren der Methode, der Natur und der Freiheit (Moral) begründet. Allerdings wurde Naturwissenschaft bis in die Neuzeit oft als Wissenschaft von der menschlichen Natur, den Ursachen und Zwecken seines Handelns im Allgemeinen verstanden, also mit der philosophischen Anthropologie (z. B. bei den französischen Aufklärern D. Hume) oder sogar mit der Naturphilosophie verschmolzen (mit J. B. Robin, B. Spinoza, deren Hauptwerk „Ethik“ ist – das ist die Lehre von der Substanz und ihren Erscheinungsweisen).
Diese Erweiterung des Themas von E. ergab sich aus der Interpretation seiner Aufgaben: E. sollte einem Menschen das richtige Leben lehren, basierend auf seiner eigenen (natürlichen oder göttlichen) Natur. Daher kombinierte E. die Theorie der menschlichen Existenz, das Studium der Leidenschaften und Affekte der Psyche (Seele) und gleichzeitig die Lehre von Wegen zu einem guten Leben (gemeinsamer Nutzen, Glück, Erlösung). So ging der vorkantianische E. unbewusst von der These über die Einheit des Seins und des Seins aus.
Kant kritisierte die Kombination naturalistischer und moralischer Aspekte in der Ethik. Nach Kant ist die Ökonomie eine Wissenschaft nur über das, was sein sollte, und nicht über das, was kausal bestimmt ist und ist; sie muss ihre Grundlagen nicht in der Existenz, Natur oder sozialen Existenz des Menschen suchen, sondern in den reinen außerempirischen Postulaten des Menschen Grund. Kants Versuch, das spezifische Subjekt der Moral (den Bereich der Verpflichtung) zu isolieren, führte dazu, dass die Probleme der Entstehung und gesellschaftlichen Konditionierung der Moral daraus beseitigt wurden. Gleichzeitig
Die „praktische Philosophie“ (die Kant als E. betrachtete) erwies sich als unfähig, die Frage nach der praktischen Möglichkeit der Umsetzung der von ihr begründeten Prinzipien in der realen Geschichte zu lösen. Kants Neudenken des Themas Ethik verbreitete sich in der bürgerlichen Ethik des 20 Vorrechte der persönlichen Moral. Bewusstsein, das im Rahmen einer einzigartigen Lebenssituation wirkt.
Die marxistische Ökonomie differenziert ihren Gegenstand grundlegend anders und lehnt den Gegensatz zwischen „rein theoretisch“ und „praktisch“ ab, da alles Wissen nur die objektiv-praktische Tätigkeit des Menschen zur Beherrschung der Welt ist. Das marxistische Ethikverständnis ist vielschichtig und umfasst normativ-moralische, historische, logisch-kognitive, soziologische und psychologische Aspekte als organische Aspekte eines Ganzen. Das Thema der marxistischen Ethik umfasst eine philosophische Analyse der Natur, des Wesens, der Struktur und der Funktionen der Moral, der normativen Ethik, die die Probleme von Kriterien, Prinzipien, Normen und Kategorien eines bestimmten moralischen Systems untersucht (Probleme der Berufsethik werden entwickelt). als Teil der normativen Ethik) und die Geschichte der Moralerziehung.
Das Hauptproblem der Ethik war schon immer die Frage nach der Natur und dem Ursprung der Moral, aber in der Geschichte der ethischen Lehren wurde sie meist in Form einer Frage nach der Grundlage der Vorstellungen des moralischen Bewusstseins darüber gestellt, was sein sollte, über das Kriterium der moralischen Beurteilung. Je nachdem, was als Grundlage der Moral angesehen wurde, können alle in der Geschichte der Ethik verfügbaren Lehren in zwei Typen eingeteilt werden. Die erste umfasst Theorien, die moralische Anforderungen aus der tatsächlichen Realität der menschlichen Existenz ableiten –
„menschliche Natur“, die natürlichen Bedürfnisse oder Bestrebungen der Menschen, ihre angeborenen Gefühle oder alle Tatsachen ihres Lebens, betrachtet als selbstverständliche, ahistorische Grundlage für Moral. Theorien dieser Art tendieren meist zum bioanthropologischen Determinismus; enthalten Elemente des Materialismus (antike griechische Materialisten, Aristoteles, Spinoza, Hobbes, französische Materialisten des 18. Jahrhunderts, Utilitarismus, L. Feuerbach, russische revolutionäre Demokraten), werden aber oft von Tendenzen des subjektiven Idealismus (englische Schule des moralischen Gefühls) dominiert des 17.-18. Jahrhunderts. , J. Butler; im modernen Bürgertum E. - J. Dewey, R. B. Perry, E. Westermarck, E. Durkheim, V. Pareto, W. Sumner usw.). In Theorien eines anderen Typs wird die Grundlage der Moral als ein bedingungsloses und ahistorisches Prinzip angesehen, das außerhalb der menschlichen Existenz liegt. Dieser Anfang kann naturalistisch verstanden werden
(„das Naturgesetz“ der Stoiker, das Gesetz der „kosmischen Teleologie“, die Evolution des organischen Lebens) oder idealistisch: „das höchste Gut“ (Platon), die absolute Idee (G. göttliches Gesetz (Thomismus und Neo- Thomismus), apriorisches Moralgesetz (Kant), einfache und selbstverständliche Ideen oder Beziehungen, die nicht von der Natur des Universums abhängen (Cambridge-Platoniker). In der Geschichte von E. sind insbesondere die autoritären Konzepte der Moral hervorzuheben , wonach die einzige Grundlage für seine Forderungen eine Art Autorität ist – göttliche oder persönliche.
In der modernen bürgerlichen Ökonomie scheint das Problem der Begründung der Moral oft völlig unlösbar. Im Intuitionismus gelten grundlegende moralische Konzepte als unabhängig von der Natur aller Dinge und daher als selbstverständlich, unbeweisbar und unwiderlegbar. Anhänger des Neopositivismus, dagegen
„Fakten“ und „Werte“ kommen zu dem Schluss, dass es unmöglich ist, moralische Urteile wissenschaftlich zu untermauern. Vertreter des Existenzialismus glauben, dass das Wesen des Menschen keine allgemeinen Definitionen hat und daher keine Grundlage für die Formulierung spezifischer moralischer Prinzipien bieten kann. Stimmt, im sogenannten naturalistischen E. der 1950er-60er Jahre. (E. Edel, R. Brandt – USA usw.), im Gegensatz zu Irrationalismus und Formalismus in der Ethik, werden die Grundlagen der Moral aus den Bedürfnissen des gesellschaftlichen Lebens, Daten aus der Anthropologie, Ethnographie und soziologischen Forschung abgeleitet.
Die Frage nach dem Wesen der Moral nahm in der Geschichte des ethischen Denkens manchmal eine andere Form an: Ist moralisches Handeln seinem Wesen nach zielgerichtet, dient es der Umsetzung einiger praktischer Ziele und der Erzielung konkreter Ergebnisse, oder ist es völlig zwecklos, repräsentierend nur die Erfüllung des Gesetzes, der Anforderungen einer absoluten Verpflichtung, die jedem Bedürfnis und Ziel vorausgeht. Dieselbe Alternative nahm die Form einer Frage nach dem Verhältnis in der Moral zwischen den Konzepten des außermoralischen Guten und des moralisch Geschuldeten an: Entweder basieren die Anforderungen der Pflicht auf dem Guten, das erreicht werden kann (dieser Standpunkt wurde von der überwiegenden Mehrheit geteilt). Mehrheit der Ethiker), oder umgekehrt, der Begriff des Guten selbst sollte durch das, was sein sollte, definiert und begründet werden (Kant, englische Philosophen C. Broad, E. Ewing).
Die erste Lösung führte meist zum Konzept des sogenannten Konsequenz-E. (lat. consequentia – Konsequenzen), wonach moralische Handlungen in Abhängigkeit von den praktischen Ergebnissen, zu denen sie führen, ausgewählt und bewertet werden sollten (Hedonismus, Eudaimonismus, Utilitarismus, usw.). Diese Lösung vereinfachte das moralische Problem: Die Beweggründe des Handelns und die Einhaltung des allgemeinen Prinzips erwiesen sich als unwichtig. Gegner der Konsequenzethik argumentierten, dass es in der Moral in erster Linie auf das Motiv und die Handlung selbst in Erfüllung des Gesetzes ankomme und nicht auf die Konsequenzen (Kant); Absicht, Wunsch, unternommene Anstrengung und nicht deren Ergebnis, das nicht immer von der Person abhängt (D. Ross, E. Carritt, UK); Wichtig ist nicht der Inhalt der Handlung, sondern die Beziehung, in der ihr Subjekt zu ihr steht (die Tatsache, dass die Wahl frei getroffen wird – J. P. Sartre; dass eine Person gegenüber ihren moralischsten Handlungen und Motiven kritisch ist, was auch immer sie sein mögen). sein - K. Barth, E. Brunner).
Schließlich tauchte die Frage nach dem Wesen der Moral in der Geschichte der Ethik oft in Form einer Frage nach dem Wesen des moralischen Handelns selbst und seiner Beziehung zum übrigen menschlichen Alltagsleben auf. Von der Antike bis zur Gegenwart lassen sich in Eurasien zwei gegensätzliche Traditionen verfolgen: hedonistisch-eudaimonistisch und rigoristisch. Im ersten verschmilzt das Problem der Begründung der Moral mit der Frage nach Wegen zur Verwirklichung moralischer Anforderungen. Da leitet sich die Moral ab
Die „natürliche“ Natur des Menschen und seine Lebensanforderungen gehen davon aus, dass der Mensch letztlich selbst an der Umsetzung seiner Anforderungen interessiert ist. Diese Tradition erreichte ihren Höhepunkt im Konzept des „vernünftigen Egoismus“. In der Geschichte einer klassenfeindlichen Gesellschaft gerieten moralische Anforderungen jedoch häufig in scharfen Konflikt mit den Bestrebungen des Einzelnen. Im moralischen Bewusstsein spiegelte sich dies in Gedanken über den ewigen Konflikt zwischen Neigung und Pflicht, praktischer Berechnung und erhabenem Motiv wider und diente in der Ethik als Grundlage für die zweite Tradition, in deren Rahmen die ethischen Konzepte von Stoizismus, Kantianismus, Christentum und östliche Religionen. Vertreter dieser Tradition halten es für unmöglich, davon fortzufahren
„Natur“ des Menschen und interpretieren Moral als etwas, das zunächst den praktischen Interessen und natürlichen Neigungen der Menschen entgegensteht. Aus diesem Gegensatz resultierte ein asketisches Verständnis moralischen Handelns als strenge Askese und Unterdrückung der natürlichen Impulse eines Menschen, und damit verbunden war auch eine pessimistische Einschätzung der moralischen Leistungsfähigkeit eines Menschen. Die Ideen der Irreduzibilität des moralischen Prinzips aus der menschlichen Existenz und der Unmöglichkeit, die Grundlage der Moral in der Sphäre der Existenz zu finden, führten in philosophischer und theoretischer Hinsicht zum Konzept der autonomen Ethik, das in der bürgerlichen Ethik des 20. Jahrhunderts verankert war. ausgedrückt in der Leugnung der gesellschaftlichen Zweckmäßigkeit moralischen Handelns (Existentialismus, protestantische Heterodoxie usw.). Eine besondere Schwierigkeit für die nichtmarxistische Ethik ist das Problem des Verhältnisses von Allgemeinem und Konkretem Historischem in der Moral: Der spezifische Inhalt moralischer Anforderungen wird entweder als ewig und allgemein verstanden (ethischer Absolutismus) oder als etwas nur Besonderes angesehen , relativ und vergänglich (ethischer Relativismus).
Basierend auf der bisherigen Geschichte der Entwicklung des ethischen Denkens hebt die marxistische Ethik die Traditionen des Materialismus und Humanismus in der Ethik auf eine neue Ebene, und zwar durch die organische Verbindung des objektiven Studiums der Gesetze der Geschichte mit der Anerkennung der wirklichen Interessen und der daraus resultierenden lebenswichtige Rechte des Menschen. Die marxistische Ethik sieht die Grundlage der Moral – moralische Ideen, Ziele und Bestrebungen – letztlich in den objektiven Gesetzen der fortschreitenden Entwicklung der Menschheit. Dank des sozialhistorischen Ansatzes zur Analyse der Moral überwindet die marxistische Ethik den Gegensatz von ethischem Relativismus und Absolutismus. Diese oder jene Klassenmoral drückt die Stellung verschiedener gesellschaftlicher Gruppen im Prozess der gesellschaftlichen Kulturproduktion und ihrer historischen Entwicklung aus und spiegelt letztlich auf die eine oder andere Weise die objektiven Gesetze der Geschichte wider. Wenn darüber hinaus die gesellschaftliche Stellung einer bestimmten Klasse historisch fortschrittlich ist und, insbesondere wenn es sich um die Stellung der arbeitenden Massen handelt, die Unterdrückung durch Ausbeutung, Ungleichheit und Gewalt erfährt und daher objektiv an der Schaffung humanerer, gleichberechtigter und freierer Beziehungen interessiert ist, dann trägt diese Moral, während sie Klassenmoral bleibt, zum moralischen Fortschritt der Gesellschaft als Ganzes bei und bildet Elemente der universellen Moral. Dies gilt insbesondere für die revolutionäre Moral der Arbeiterklasse, die
„… unternimmt aufgrund seiner Sonderstellung die Emanzipation der gesamten Gesellschaft“ (K. Marx, siehe K. Marx und F. Engels, Werke, 2. Aufl., Bd. 1, S. 425), zum ersten Die Zeit setzt das Ziel der Zerstörung von Klassen im Allgemeinen und damit der Bekräftigung einer wahrhaft universellen Moral. Die konkrete historische Herangehensweise der marxistischen Ethik an die Phänomene der Moral ermöglicht es also nur, die Beziehung einzelner, klassenbezogener Standpunkte in der Moral mit den einheitlichen Gesetzen der fortschreitenden Entwicklung der Moral zu verstehen und in der widersprüchlichen Natur der Moral zu erkennen Die Bildung der Moral in der Klassengesellschaft ist eine einzige Linie universellen moralischen Fortschritts.
Bei der Lösung moralischer Fragen ist nicht nur das kollektive, sondern auch das individuelle Bewusstsein zuständig: Die moralische Autorität eines Menschen hängt davon ab, wie richtig er die allgemeinen moralischen Prinzipien und Ideale der Gesellschaft (oder einer revolutionären Bewegung) und die darin widergespiegelte historische Notwendigkeit versteht. Die Objektivität der moralischen Grundlage ermöglicht es dem Einzelnen, im Rahmen seines eigenen Bewusstseins selbstständig gesellschaftliche Anforderungen wahrzunehmen und umzusetzen, Entscheidungen zu treffen, für sich Lebensregeln zu entwickeln und das Geschehen zu bewerten. Es stellt sich das Problem des Verhältnisses von Freiheit und Notwendigkeit. Die richtige Bestimmung der allgemeinen Grundlagen der Moral bedeutet noch nicht die eindeutige Ableitung spezifischer moralischer Normen und Prinzipien daraus oder die direkte Verfolgung der einzelnen „historischen Tendenz“.
Zu den moralischen Aktivitäten gehört nicht nur die Umsetzung, sondern auch die Schaffung neuer Normen und Prinzipien sowie die Suche nach Idealen und Wegen zu ihrer Umsetzung, die der modernen Zeit am besten entsprechen.
Dies bestimmt auch die Formulierung der Frage nach moralischen Kriterien in der marxistischen Ökonomie. Die Gesetze der historischen Entwicklung bestimmen den Inhalt moralischer Ideen nur in der allgemeinsten Form, ohne ihre spezifische Form vorzugeben. Da jede konkret zweckmäßige gesellschaftliche Tätigkeit von der Moral unter dem Gesichtspunkt der Erfüllung eines allen Menschen und vielen besonderen Situationen gemeinsamen Gesetzes – einer Norm, eines Prinzips, eines Ideals, die als eigentliche moralische Kriterien fungieren – vorgeschrieben und beurteilt wird, heißt dies dass wirtschaftliche, politische, ideologische und andere spezifische Aufgaben nicht nur nicht die Lösung jedes einzelnen moralischen Problems vorgeben, sondern im Gegenteil die Wege und Methoden zur Umsetzung dieser Aufgaben von der Moral unter dem Gesichtspunkt der Kriterien beurteilt werden Güte, Gerechtigkeit, Menschlichkeit, Ehrlichkeit usw.
Die relative Unabhängigkeit dieser Kriterien liegt keineswegs darin, dass sie aus einer anderen Quelle als spezifischen sozialen Bedürfnissen stammen, sondern darin, dass sie diese Bedürfnisse in der universellsten Form widerspiegeln und nicht nur die Erreichung einiger besonderer Ziele bedeuten , sondern vielseitig auf die Bedürfnisse des gesellschaftlichen Lebens in einer bestimmten Phase seiner kulturellen Entwicklung ein. Daher verbietet und verurteilt die Moral manchmal Handlungen, die aus der Sicht des gegenwärtigen Augenblicks, der besonderen Aufgaben eines bestimmten Falles, am effektivsten und angemessensten erscheinen mögen.
Angesichts dieses Widerspruchs neigen nichtmarxistische Ethiker meist entweder zu einer pragmatisch-utilitaristischen Interpretation moralischer Kriterien oder sehen einen ewigen Konflikt zwischen den Anforderungen von Moral und Zweckmäßigkeit, Moral und Politik (Ökonomie). In Wirklichkeit ist dieser Widerspruch nicht absolut, sondern selbst Ausdruck bestimmter sozialgeschichtlicher Widersprüche. Im Laufe des gesellschaftlichen Fortschritts und insbesondere der revolutionären Transformationen wurde jedes Mal festgestellt, dass die Anforderungen der sozialen Zweckmäßigkeit, betrachtet unter dem Gesichtspunkt der allgemeinen Aussichten für die fortschreitende Entwicklung der Gesellschaft, letztendlich mit den Kriterien der Gerechtigkeit zusammenfallen. Freiheit, Menschlichkeit, solange das moralische Bewusstsein der Massen sie in einer perspektivisch-historischen und daher universellsten Form zum Ausdruck bringt.
Ein utilitaristischer, opportunistischer Ansatz zur Lösung spezifischer Probleme widerspricht nicht nur den Anforderungen der kommunistischen Moral, sondern ist auch politisch kurzsichtig und im Hinblick auf umfassendere und weiter entfernte gesellschaftliche Ziele und Konsequenzen unangemessen. Das Verständnis der unauflöslichen Einheit des allgemeinen Sozialen und Moralischen ermöglicht es der marxistischen Ökonomie erstmals, den Widerspruch zwischen Moral und Politik, zwischen Zielen und Mitteln, praktischen Bedürfnissen und moralischen Anforderungen, gesellschaftlicher Notwendigkeit und Kriterien der Menschlichkeit, zwischen dem allgemeinen moralischen Prinzip rational aufzulösen und private Zweckmäßigkeit. Die marxistische Ökonomie ist sowohl dem Geist des Utilitarismus als auch dem Standpunkt der absoluten Moralisierung, der dies behauptet, gleichermaßen fremd
„höchstes“ moralisches Urteil über die objektive Notwendigkeit der Gesetze der Geschichte.
Die marxistische Ethik lässt bei der Beurteilung moralischen Handelns auch die traditionelle Alternative von Motiv und Handlung zu. Das moralische Handeln eines Menschen muss immer als ganzheitliches Handeln beurteilt werden, als die Einheit eines Ziels und seiner Umsetzung, seines Denkens und seiner Erfüllung. Dies ist jedoch nur möglich, wenn die Handlung als privater Moment der gesamten sozialen Aktivität einer Person betrachtet wird. Wenn
Es scheint, dass jeder Mensch im Laufe seines Lebens seine eigene Wertepyramide entwickelt. Tatsächlich wird es bereits in der Kindheit im Unterbewusstsein verankert. Informationen, die ein Kind unter 6 Jahren erhält, gehen direkt dorthin. Dies gilt auch für die ethischen Verhaltensstandards, die Kinder erhalten, indem sie das Handeln ihrer Eltern beobachten und ihren Gesprächen zuhören.
Ethik ist ein sehr altes Konzept, das darauf abzielt, die Handlungen von Menschen und ihre Rechtmäßigkeit sowie ihre moralischen und ethischen Qualitäten zu untersuchen.
Die Wissenschaft von Gut und Böse
Das einst von Aristoteles verwendete Wort Ethika wurde später zu einer Wissenschaft, deren Erforschung und Entwicklung sich viele Philosophen auf der ganzen Welt widmeten. Wenn der antike Denker daran interessiert war, eine Antwort auf die Frage zu finden, was die Grundlage menschlichen Handelns ist, dann interessierten sich nachfolgende Generationen von Weisen für das Konzept von Ethik und Moral in der Pyramide menschlicher Werte.
Als Wissenschaft studiert sie:
- Welchen Platz nimmt die Moral in den sozialen Beziehungen ein?
- seine bestehenden Kategorien;
- Hauptprobleme.
Der Begriff und Gegenstand der Ethik beziehen sich auf folgende Branchen:
- normative Indikatoren, deren Hauptuntersuchung das Handeln von Menschen aus der Perspektive von Kategorien wie Gut und Böse ist;
- Die Metaethik beschäftigt sich mit der Erforschung ihrer Typen;
- Angewandte Wissenschaft dieser Art untersucht individuelle Situationen aus einer moralischen Perspektive.
Moderne Ethik ist ein umfassenderes Konzept, als die antiken Philosophen es sich vorgestellt haben. Heute hilft es nicht nur, Handlungen unter dem Gesichtspunkt der Richtigkeit zu bewerten, sondern weckt auch ein bewertendes Bewusstsein im Menschen.
Ethik in der Antike
Die Weisen der Antike unterschieden sie nicht als eigenständige wissenschaftliche Disziplin, sondern ordneten sie den Zweigen Philosophie und Recht zu.
Damals ähnelte es vor allem moralisierenden Aphorismen, die dazu beitrugen, in den Menschen ihre besten und edelsten Charaktereigenschaften zu erwecken. Es war Aristoteles, der sie als eigenständige Disziplin auszeichnete und sie zwischen Psychologie und Politik einordnete.
In einem Werk mit dem Titel „Eudamische Ethik“ befasst sich Aristoteles mit Fragen zum menschlichen Glück und den Gründen für dessen Entstehung. Die tiefen Gedanken dieses Wissenschaftlers zielten darauf ab, dass ein Mensch, um erfolgreich zu sein, tatsächlich ein Ziel und die Energie haben muss, es umzusetzen. Er glaubte, dass es große Torheit sei, das Leben nicht seinem Erfolg unterzuordnen.
Für Aristoteles selbst wurden Konzept und Inhalt der Ethik zur Grundlage für die Bildung von Normen wie menschlichen Tugenden in den Köpfen seiner Zeitgenossen. Antike Philosophen schrieben ihnen und anderen Gerechtigkeit zu.
Schon vor dem Aufkommen des griechischen Wortes „Ethika“, das die Wissenschaft zu bezeichnen begann, die die Moral und Rechtmäßigkeit menschlichen Handelns untersucht, interessierte sich die Menschheit zu verschiedenen Zeiten für Fragen nach Gut, Böse und dem Sinn des Lebens. Sie sind auch heute noch von grundlegender Bedeutung.
Moralkonzept
Das Hauptkriterium für die Moral eines Menschen ist die Fähigkeit, zwischen den Konzepten von Gut und Böse zu unterscheiden, sowie die Entscheidung für Gewaltlosigkeit, Nächstenliebe und die Einhaltung der spirituellen Gesetze des Guten.
Manchmal werden Konzepte als Synonyme betrachtet, die dasselbe bedeuten. Das ist nicht so. Tatsächlich sind Moral und Moral Kategorien, die die Ethik als Wissenschaft untersucht. Spirituelle Gesetze, die in der Antike von Menschen aufgestellt wurden, erfordern, dass ein Mensch nach den Regeln der Ehre, des Gewissens, der Gerechtigkeit, der Liebe und der Güte lebt. Das Studium und die Einhaltung moralischer Gesetze wurden einst von der Kirche überwacht, indem sie den Gläubigen die 10 Gebote lehrte. Heutzutage geschieht dies eher auf Familien- und Schulebene, wo Ethik gelehrt wird.
Eine Person, die spirituelle Gesetze in die Tat umsetzt und verbreitet, wurde zu allen Zeiten als gerecht bezeichnet. Das Konzept der moralischen Ethik ist die Entsprechung der Kategorien Güte und Liebe zu den Handlungen, die eine Person begeht.
Die Geschichte ist bekannt für Beispiele der Zerstörung starker Reiche, nachdem die spirituellen Werte ihres Volkes ersetzt wurden. Das auffälligste Beispiel ist die Zerstörung des antiken Roms – eines mächtigen, wohlhabenden Reiches, das von Barbaren besiegt wurde.
Moral
Moral ist der Grad der menschlichen Verbesserung in Tugenden wie Güte, Gerechtigkeit, Ehre, Freiheit und Liebe für die Welt um uns herum. Es charakterisiert das Verhalten und Handeln von Menschen aus der Perspektive dieser Werte und gliedert sich in persönliche und öffentliche.
Die öffentliche Moral zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:
- Einhaltung allgemein anerkannter Verbote für eine bestimmte Bevölkerungsgruppe oder Religion (z. B. dürfen Juden kein Schweinefleisch essen);
- charakteristisch für eine bestimmte Gesellschaft (zum Beispiel wird in Mursi den Frauen ein Teller in die Lippen gesteckt, was für die Völker anderer Länder völlig inakzeptabel ist);
- von religiösen Kanonen vorgeschriebene Handlungen (z. B. das Halten der Gebote);
- in jedem Mitglied der Gesellschaft eine moralische Qualität wie Selbstaufopferung zu fördern.
Nicht nur zwischenmenschliche Beziehungen, sondern auch zwischen Ländern und Völkern basieren auf moralischen Werten. Zu Kriegen kommt es, wenn eine der Parteien gegen anerkannte Normen verstößt, die zuvor die Grundlage für ein friedliches Zusammenleben bildeten.
Geschichte der Berufsethik
Das Konzept der Berufsethik entstand bereits im ersten Handwerk. Der hippokratische Eid, der allen Ärzten bekannt ist, gehört zum Beispiel zu solchen antiken Gesetzen. Soldaten, Olympiateilnehmer, Priester, Richter, Senatoren und andere Vertreter der Bevölkerung hatten ihre eigenen ethischen Maßstäbe. Einige wurden mündlich dargelegt (gehen Sie nicht mit Ihren eigenen Regeln in das Kloster eines anderen), andere wurden auf Tafeln oder Papyri niedergeschrieben, die bis heute erhalten sind.
Einige ähnliche Regeln der Antike werden heute als Empfehlungen und Verbote wahrgenommen.
Eher dem Konzept einer Zunftordnung ähnlich, die im 11.-12. Jahrhundert in jeder Handwerksgemeinschaft auf ihre eigene Weise ausgearbeitet wurde. Sie zeigten nicht nur die Pflichten jedes Ladenarbeiters gegenüber seinen Kollegen und dem Artel auf, sondern auch seine Rechte.
Ein Verstoß gegen eine solche Satzung hatte den Ausschluss aus der Handwerkergemeinschaft zur Folge, was dem Ruin gleichkam. Bekannt ist der Begriff des Kaufmannswortes, das auch als Beispiel einer mündlichen Vereinbarung zwischen Vertretern einer oder verschiedener Zünfte bezeichnet werden kann.
Arten der Berufsethik
Das Konzept und in jedem Beruf impliziert die Merkmale der Tätigkeit, die dieser bestimmten Arbeit innewohnen. Die für jeden Beruf bestehenden Regelungen bestimmen das Handeln der Arbeitnehmer im Rahmen anerkannter Regeln und Verfahren.
Es gibt zum Beispiel so etwas wie medizinische, rechtliche, wirtschaftliche, militärische Geheimnisse und sogar Geständnisse. Zur Berufsethik gehören nicht nur die Verhaltensregeln, die jeder menschlichen Tätigkeit innewohnen, sondern auch die eines einzelnen Teams.
Wenn ein Arbeitnehmer bei einem Verstoß gegen die Arbeitsvorschriften mit einer Verwaltungsstrafe oder einer Entlassung belegt wird, kann er bei Nichteinhaltung der Berufsmoral nach den Gesetzen des Landes vor Gericht gestellt werden. Wenn beispielsweise ein medizinischer Mitarbeiter bei der Sterbehilfe erwischt wird, wird er wegen Mordes verhaftet.
Zu den wichtigsten Arten der Berufsethik gehören:
- medizinisch;
- Militär;
- legal;
- wirtschaftlich;
- pädagogisch;
- kreativ und andere.
Die Hauptregel hierbei ist hohe Professionalität und Hingabe an die eigene Arbeit.
Unternehmensethik
Das Konzept der Wirtschaftsethik gehört zur Kategorie der Berufsmoral. Es gibt viele ungeschriebene Gesetze (in einigen Fällen sind sie in den Satzungen von Unternehmen festgelegt), Gesetze, die nicht nur den Kleidungsstil für Geschäftsleute und Geschäftsleute vorschreiben, sondern auch die Kommunikation, den Abschluss von Transaktionen oder die Führung von Dokumentationen. Nur wer die moralischen Maßstäbe von Ehre und Anstand einhält, wird als Unternehmer bezeichnet.
Geschäftsethik ist ein Konzept, das seit der ersten Transaktion verwendet wird. Verschiedene Länder haben ihre eigenen Regeln für die Führung von Verhandlungen, unabhängig davon, ob es sich um geschäftliche oder diplomatische Beziehungen handelt oder um die Orte, an denen Geschäfte abgeschlossen werden. Zu allen Zeiten gab es Stereotypen über einen erfolgreichen Menschen. In der Antike waren dies reiche Häuser, Bedienstete oder die Menge an Land und Sklaven, in unserer Zeit teure Accessoires, ein Büro in einer prestigeträchtigen Gegend und vieles mehr.
Ethische Kategorien
- Güte ist eine Tugend, die alles Positive verkörpert, was auf dieser Welt existiert;
- Das Böse ist das Gegenteil von Gut und dem allgemeinen Konzept von Unmoral und Gemeinheit;
- gut – betrifft die Lebensqualität;
- Gerechtigkeit ist eine Kategorie, die die gleichen Rechte und die Gleichheit der Menschen angibt;
- Pflicht – die Fähigkeit, die eigenen Interessen zugunsten anderer unterzuordnen;
- Gewissen – die individuelle Fähigkeit einer Person, ihre Handlungen unter dem Gesichtspunkt von Gut und Böse zu bewerten;
- Würde ist die Beurteilung der Qualitäten einer Person durch die Gesellschaft.
Ethik der Kommunikation
Das Konzept der Kommunikationsethik umfasst die Fähigkeiten, mit anderen Menschen zu kommunizieren. Dieser Wissenschaftszweig untersucht das Niveau der menschlichen Kultur anhand seiner Sprache, der Qualität und Nützlichkeit der von ihm präsentierten Informationen sowie seiner moralischen und moralischen Werte.
VORTRAG Nr. 1.
Grundbegriffe der Ethik
1. Der Begriff der Ethik
Der Begriff „Ethik“ stammt vom altgriechischen Ethos (Ethos). Zunächst wurde unter Ethos ein Ort des gemeinsamen Aufenthalts, ein Haus, eine Behausung, ein Tierlager, ein Vogelnest verstanden. Dann begannen sie hauptsächlich die stabile Natur eines Phänomens, Charakters, Brauchs, Charakters zu bezeichnen. Heraklit glaubte beispielsweise, dass das Ethos eines Menschen seine Gottheit sei. Dieser Bedeutungswandel des Konzepts drückte die Verbindung zwischen dem sozialen Umfeld einer Person und ihrem Charakter aus.
Aristoteles verstand das Wort „Ethos“ als Charakter und führte das Adjektiv „ethisch“ ein, um eine besondere Klasse menschlicher Eigenschaften zu bezeichnen, die er ethische Tugenden nannte. Ethische Tugenden sind daher Eigenschaften des menschlichen Charakters, seines Temperaments und seiner spirituellen Qualitäten.
Sie unterscheiden sich einerseits von Affekten, Eigenschaften des Körpers, andererseits von dianoetischen Tugenden, Eigenschaften des Geistes. Insbesondere Angst ist ein natürlicher Affekt und Erinnerung eine Eigenschaft des Geistes. Folgende Charaktereigenschaften kommen in Betracht: Mäßigung, Mut, Großzügigkeit. Um das System der ethischen Tugenden als einen besonderen Wissensbereich zu bezeichnen und dieses Wissen als eigenständige Wissenschaft abzugrenzen, führte Aristoteles den Begriff „Ethik“ ein.
Für eine genauere Übersetzung des aristotelischen Begriffs „ethisch“ aus dem Griechischen ins Lateinische führte Cicero den Begriff „moralis“ (moralisch) ein. Er bildete es aus dem Wort „mos“ (mores – Plural), das wie im Griechischen zur Bezeichnung von Charakter, Temperament, Mode, Schnitt der Kleidung, Sitte verwendet wurde.
Cicero beispielsweise diskutierte die Moralphilosophie und bezog sich dabei auf dasselbe Wissensgebiet, das Aristoteles Ethik nannte. Im 4. Jahrhundert n. Chr e. Auch im Lateinischen tauchte der Begriff „moralitas“ (Moral) auf, der ein direktes Analogon zum griechischen Begriff „Ethik“ darstellt.
Diese Wörter, eines griechischen und das andere lateinischen Ursprungs, gelangten in die modernen europäischen Sprachen. Daneben gibt es in einer Reihe von Sprachen eigene Wörter, die dasselbe bedeuten wie die Begriffe „Ethik“ und „Moral“. Im Russischen wurde dieses Wort insbesondere zu „Moral“, im Deutschen zu „Sittlichkeit“. Diese Begriffe wiederholen die Entstehungsgeschichte der Konzepte „Ethik“ und „Moral“ aus dem Wort „Moral“.
Somit sind „Ethik“, „Moral“, „Moral“ in ihrer ursprünglichen Bedeutung drei verschiedene Wörter, obwohl sie ein Begriff waren. Im Laufe der Zeit hat sich die Situation geändert. Im Laufe der Entwicklung der Philosophie, als die Einzigartigkeit der Ethik als Wissensgebiet offenbar wird, beginnen diesen Wörtern unterschiedliche Bedeutungen zuzuordnen.
Unter Ethik verstehen wir also zunächst das entsprechende Wissensgebiet, die Wissenschaft, und unter Moral (oder Ethik) das von ihr untersuchte Fach. Obwohl Forscher verschiedene Versuche unternommen haben, die Begriffe „Moral“ und „Moral“ zu unterscheiden. Hegel verstand beispielsweise Moral als den subjektiven Aspekt von Handlungen und Moral als die Handlungen selbst, ihr objektives Wesen.
So bezeichnete er als Moral die Art und Weise, wie ein Mensch die Handlungen einer Person in seinen subjektiven Einschätzungen, Schulderfahrungen, Absichten sieht, und Moral ist das, was die Handlungen eines Individuums im Leben einer Familie, eines Staates und einer Nation tatsächlich sind. In Übereinstimmung mit der kulturellen und sprachlichen Tradition werden unter Moral häufig hohe Grundpositionen verstanden, unter Moral dagegen bodenständige, historisch sehr wandelbare Verhaltensnormen. Insbesondere Gottes Gebote können als moralisch bezeichnet werden, aber auch die Regeln eines Schullehrers können als moralisch bezeichnet werden.
Im Allgemeinen werden im allgemeinen kulturellen Vokabular alle drei Wörter weiterhin synonym verwendet. Beispielsweise können im umgangssprachlichen Russisch sogenannte ethische Normen genauso zu Recht als moralische oder moralische Normen bezeichnet werden. In einer Sprache, die wissenschaftliche Strenge beansprucht, wird vor allem der Unterscheidung zwischen den Begriffen Ethik und Moral (Moral) eine wichtige Bedeutung beigemessen, die jedoch nicht vollständig eingehalten wird. Daher wird Ethik als Wissensgebiet manchmal als Moralphilosophie bezeichnet, und der Begriff „Ethik“ wird verwendet, um bestimmte moralische Phänomene zu bezeichnen (z. B. Umweltethik, Wirtschaftsethik).
In den Vorlesungen werden wir an der Position festhalten, dass „Ethik“ eine Wissenschaft, ein Wissensgebiet, eine intellektuelle Tradition ist, und wir werden die Begriffe „Moral“ oder „Moral“ als Synonyme verwenden und unter ihnen verstehen, was von der Ethik untersucht wird , sein Thema.
2. Ethik und Moral als Gegenstand der Ethik
Was ist Moral? Diese Frage ist für die Ethik in der gesamten Geschichte dieses Wissensgebiets von zentraler Bedeutung. Es umfasst etwa zweieinhalbtausend Jahre.
Verschiedene philosophische Schulen und Denker gaben darauf sehr unterschiedliche Antworten. Es gibt noch keine unbestreitbare, einheitliche Definition von Moral, die in direktem Zusammenhang mit den Merkmalen dieses Phänomens steht. Es ist kein Zufall, dass Diskussionen über Moral oder Moral sich als unterschiedliche Bilder der Moral selbst herausstellen.
Moral ist viel mehr als die Summe der erforschten Fakten. Es handelt sich auch um eine Aufgabe, die ihre Lösung sowie theoretische Reflexion erfordert. Moral ist nicht einfach etwas, das ist. Sie ist höchstwahrscheinlich das, was sein sollte.
Daher kann die Beziehung zwischen Ethik und Moral nicht auf ihre Reflexion und Erklärung beschränkt werden. Die Ethik muss daher ihr eigenes Moralmodell anbieten.
Aus diesem Grund vergleichen einige Forscher Moralphilosophen mit Architekten, deren berufliche Berufung darin besteht, neue Gebäude zu entwerfen und zu schaffen.
Es gibt einige sehr allgemeine Merkmale der Moral, die heute in der Ethik weit verbreitet und in der Kultur sehr fest verankert sind.
Diese Definitionen stimmen eher mit allgemein akzeptierten Ansichten zur Moral überein.
Moral erscheint in zwei verschiedenen Erscheinungsformen:
1) als Merkmal einer Person die Summe moralischer Eigenschaften und Tugenden (Wahrhaftigkeit, Freundlichkeit);
2) als Merkmal der Beziehungen in der Gesellschaft zwischen Menschen die Summe moralischer Regeln („lüge nicht“, „stehle nicht“, „töte nicht“).
Daher wird die allgemeine Analyse der Moral normalerweise auf zwei Kategorien reduziert: die moralische (moralische) Dimension des Einzelnen und die moralische Dimension der Gesellschaft.
Moralische (ethische) Dimension der Persönlichkeit Moral wird bereits seit der griechischen Antike als Maß für die Überlegenheit eines Menschen verstanden, als Indikator dafür, inwieweit ein Mensch für sein Handeln, für das, was er tut, verantwortlich ist. Ethische Überlegungen entstehen oft im Zusammenhang mit dem Bedürfnis einer Person, Fragen von Schuld und Verantwortung zu verstehen. Es gibt ein Beispiel in Plutarchs Leben, das dies bestätigt.
Einmal tötete ein Fünfkämpfer während eines Wettkampfs versehentlich einen Mann mit einem Pfeil. Perikles und Protagoras, der berühmte Herrscher Athens und Philosoph, stritten den ganzen Tag darüber, wer für das Geschehene verantwortlich sei – entweder der Pfeil, oder derjenige, der ihn geworfen hat, oder derjenige, der den Wettbewerb organisiert hat.
Somit ist die Frage der Herrschaft des Menschen über sich selbst in größerem Maße eine Frage der Herrschaft der Vernunft über die Leidenschaften. Moral ist, wie die Etymologie des Wortes zeigt, mit dem Charakter eines Menschen, seinem Temperament, verbunden. Es ist ein qualitatives Merkmal seiner Seele. Wenn eine Person als aufrichtig bezeichnet wird, bedeutet dies, dass sie auf Menschen reagiert und freundlich ist. Wenn man im Gegenteil von jemandem sagt, dass er seelenlos ist, meinen sie damit, dass er böse und grausam ist. Aristoteles begründete die Bedeutung der Moral als qualitative Bestimmung der menschlichen Seele.
Vernunft ermöglicht es einem Menschen, richtig, objektiv und ausgewogen über die Welt nachzudenken. Irrationale Prozesse laufen manchmal unabhängig vom Geist ab, manchmal hängen sie von ihm ab. Sie finden auf der vegetativen Ebene statt.
Ihre affektiven und emotionalen Manifestationen sind auf den Geist angewiesen. In dem, was mit Freuden und Leiden verbunden ist. Affekte (Leidenschaften, Wünsche) können unter Berücksichtigung der Befehle des Geistes oder im Widerspruch zu diesen entstehen.
Wenn also Leidenschaften im Einklang mit der Vernunft stehen, haben wir eine tugendhafte, vollkommene Struktur der Seele. In einem anderen Fall, wenn Leidenschaften einen Menschen beherrschen, haben wir eine bösartige Struktur der Seele.
Moral kann als die Fähigkeit einer Person betrachtet werden, sich in ihren Wünschen zu beschränken. Sie muss der sinnlichen Zügellosigkeit widerstehen. Bei allen Völkern und zu allen Zeiten wurde Moral als Zurückhaltung verstanden, vor allem natürlich als Zurückhaltung gegenüber Affekten und selbstsüchtigen Leidenschaften. Unter den moralischen Eigenschaften nahmen Mäßigung und Mut einen der ersten Plätze ein, was bezeugte, dass ein Mensch der Völlerei und Angst, den stärksten instinktiven Wünschen, zu widerstehen und sie auch zu kontrollieren weiß.
Aber man sollte nicht denken, dass Askese die wichtigste moralische Tugend und die Vielfalt des Sinneslebens ein schwerwiegendes moralisches Laster ist. Über seine Leidenschaften zu herrschen und sie zu verwalten bedeutet nicht, sie zu unterdrücken. Da die Leidenschaften selbst auch „erleuchtet“ sein können, sind sie mit richtigen Urteilen des Geistes verbunden. Daher ist es notwendig, zwischen zwei Positionen zu unterscheiden: der besten Beziehung zwischen Vernunft und Gefühlen (Leidenschaften) und wie eine solche Beziehung zustande kommt.
3. Ethische Werte
Schauen wir uns einige grundlegende ethische Werte an.
Vergnügen. Unter den positiven Werten gelten Vergnügen und Nutzen als die offensichtlichsten. Diese Werte entsprechen direkt den Interessen und Bedürfnissen eines Menschen in seinem Leben. Ein Mensch, der von Natur aus nach Vergnügen oder Nutzen strebt, scheint sich auf völlig irdische Weise zu manifestieren.
Vergnügen (oder Vergnügen) ist ein Gefühl und eine Erfahrung, die mit der Befriedigung der Bedürfnisse oder Interessen einer Person einhergeht.
Die Rolle von Lust und Leid wird aus biologischer Sicht dadurch bestimmt, dass sie die Funktion der Anpassung erfüllen: Die menschliche Aktivität, die die Bedürfnisse des Körpers befriedigt, hängt von der Lust ab; Mangel an Freude und Leid hemmen die Handlungen eines Menschen und sind gefährlich für ihn.
In diesem Sinne spielt Vergnügen natürlich eine positive Rolle, es ist sehr wertvoll. Der Zustand der Zufriedenheit ist ideal für den Körper und der Mensch muss alles tun, um diesen Zustand zu erreichen.
In der Ethik wird dieses Konzept Hedonismus genannt (von griechisch hedone – „Vergnügen“). Die Grundlage dieser Lehre liegt! die Idee, dass das Streben nach Vergnügen und die Leugnung von Leiden die Hauptbedeutung menschlichen Handelns, die Grundlage für menschliches Glück ist.
In der Sprache der normativen Ethik wird der Grundgedanke dieser mentalen Struktur wie folgt ausgedrückt: „Vergnügen ist das Ziel des menschlichen Lebens, alles, was Freude bereitet und dazu führt, ist gut.“ Freud leistete einen großen Beitrag zur Erforschung der Rolle des Vergnügens im menschlichen Leben. Der Wissenschaftler kam zu dem Schluss, dass das „Lustprinzip“ der wichtigste natürliche Regulator geistiger Prozesse und geistiger Aktivität ist. Die Psyche ist laut Freud so beschaffen, dass unabhängig von der Einstellung eines Menschen Gefühle der Lust und Unlust ausschlaggebend sind. Die lebhaftesten und auch relativ zugänglichen Freuden können als körperliche, sexuelle und mit der Befriedigung des Bedürfnisses nach Wärme, Nahrung und Ruhe verbundene Freuden angesehen werden. Das Lustprinzip steht im Widerspruch zu gesellschaftlichen Anstandsnormen und dient als Grundlage persönlicher Unabhängigkeit.
Es ist die Freude, dass ein Mensch sich wie er selbst fühlen und sich von äußeren Umständen, Verpflichtungen und gewohnheitsmäßigen Bindungen befreien kann. Somit sind Freuden für einen Menschen eine Manifestation des individuellen Willens. Hinter dem Vergnügen steckt immer ein Verlangen, das von gesellschaftlichen Institutionen unterdrückt werden muss. Der Wunsch nach Vergnügen verwirklicht sich in der Abkehr von verantwortungsvollen Beziehungen zu anderen Menschen.
Natürlich ist Vergnügen für jeden einzelnen Menschen angenehm und daher wünschenswert. Dadurch kann es für den Einzelnen einen Wert haben und die Beweggründe seines Handelns bestimmen und beeinflussen.
Gewöhnliches Verhalten, das auf Besonnenheit und dem Erwerb von Vorteilen beruht, ist das Gegenteil einer Orientierung am Vergnügen. Hedonisten unterschieden zwischen psychologischen und moralischen Aspekten, psychologischer Basis und ethischem Inhalt. Aus moralischer und philosophischer Sicht ist Hedonismus ein Ethos des Vergnügens.
Vergnügen als Position und Wert darin wird sowohl anerkannt als auch akzeptiert. Der Wunsch eines Menschen nach Vergnügen bestimmt die Motive eines Hedonisten und die Hierarchie seiner Werte und seines Lebensstils. Nachdem er Gutes Vergnügen genannt hat, baut der Hedonist seine Ziele bewusst auf, nicht im Einklang mit dem Guten, sondern mit dem Vergnügen.
Kann Vergnügen ein grundlegendes moralisches Prinzip sein? In der Geschichte der Philosophie lassen sich drei Ansätze finden. Der erste ist positiv und gehört den Vertretern des ethischen Hedonismus. Der andere ist negativ und gehört sowohl religiösen Denkern als auch philosophischen Universalisten (B. S. Solovyov und anderen). Sie kritisierten den Hedonismus und glaubten, dass die Vielfalt der Vorlieben, Geschmäcker und Bindungen es uns nicht erlaube, Vergnügen als moralisches Prinzip anzuerkennen. Der dritte Ansatz wurde von Eudaimonisten (Epikur und klassischen Utilitaristen) entwickelt. Eudaimonisten bestritten die Unbedingtheit sinnlicher Freuden. Aber sie akzeptierten erhabene Freuden, betrachteten sie als echt und betrachteten sie als universelle moralische Grundlage für ihr Handeln.
Nutzen. Dies ist ein positiver Wert, der auf Interessen und der Einstellung einer Person zu verschiedenen Objekten basiert und deren Verständnis es ihr ermöglicht, ihren sozialen, politischen, wirtschaftlichen, beruflichen und kulturellen Status aufrechtzuerhalten und zu verbessern. Das Prinzip des Nutzens lässt sich also in der Regel ausdrücken: „Nutze alles nach deinem Interesse.“
Da Interessen in den Zielen zum Ausdruck kommen, die eine Person mit ihrer Tätigkeit verfolgt, kann sowohl etwas als nützlich angesehen werden, das zur Zielerreichung beiträgt, als auch das, wodurch die Ziele erreicht werden.
Der Nutzen charakterisiert somit die Mittel, die zur Erreichung eines Ziels erforderlich sind. Neben dem Nutzen umfasst das utilitaristische Denken auch andere Wertvorstellungen, beispielsweise „Erfolg“, „Effizienz“. Somit gilt etwas als nützlich, wenn:
1) entspricht den Interessen einer Person;
2) stellt die Erreichung der gesetzten Ziele sicher;
3) trägt zum Erfolg von Maßnahmen bei;
4) fördert die Wirksamkeit von Maßnahmen. Wie andere praktische Werte (Erfolg, Zweckmäßigkeit, Effizienz, Vorteil usw.) ist der Nutzen ein relativer Wert im Gegensatz zu absoluten Werten (Gut, Wahrheit, Schönheit, Vollkommenheit).
Das Prinzip des Nutzens wurde aus verschiedenen sozialmoralischen Positionen kritisiert – patriarchalisch und aristokratisch, religiös, revolutionär und anarchistisch. Doch egal von welcher Position aus die Kritik geäußert wurde, sie stellte irgendwie ein sozialethisches Problem dar: Das Streben nach Nutzen ist eigennützig, unermessliches Streben nach Erfolg führt zur Missachtung von Verpflichtungen, das konsequent angewandte Nutzenprinzip lässt keinen Raum für Humanität -sti, und aus der Sicht des gesellschaftlichen Lebens nährt es weitgehend Zentrifugalkräfte.
Als Wert liegt der Nutzen im Interesse der Menschen. Die Akzeptanz des Nutzens als einziges Handlungskriterium führt jedoch zu einem Interessenkonflikt. Der charakteristischste Ausdruck nutzenorientierten menschlichen Handelns ist Unternehmertum als eine Tätigkeit, die darauf abzielt, durch die Produktion von Gütern und die Erbringung verschiedener Dienstleistungen Gewinne zu erzielen.
Sie sind erstens für eine Gesellschaft privater Konsumenten notwendig und zweitens in der Lage, mit ähnlichen Gütern und Dienstleistungen anderer Hersteller zu konkurrieren. Patriarchalisch-traditionalistische Konzepte stellen das Prinzip des Nutzens dem öffentlichen Interesse gegenüber. Und die Orientierung am Nutzen darin Der Fall wird als Eigennutz interpretiert, der Nutzen selbst wird nur als allgemeiner Nutzen, als Gemeinwohl anerkannt und hochgeschätzt.
Gerechtigkeit. Etymologisch kommt das russische Wort „Gerechtigkeit“ von den Wörtern „Wahrheit“, „Gerechtigkeit“. In europäischen Sprachen stammen die entsprechenden Wörter vom lateinischen Wort „justitia“ – „Gerechtigkeit“, was auf den Zusammenhang mit dem Rechtsrecht hinweist.
Gerechtigkeit ist eines der Prinzipien, die die Beziehungen zwischen Menschen hinsichtlich der Verteilung oder Umverteilung, auch gegenseitiger (im Austausch, Schenkung), gesellschaftlicher Werte regeln.
Soziale Werte werden im weitesten Sinne verstanden. Dies sind beispielsweise Freiheit, Chancen, Einkommen, Zeichen von Respekt oder Prestige. Diejenigen, die die Gesetze erfüllen und Gutes mit Gutem vergelten, werden als gerecht bezeichnet, und diejenigen, die Willkür begehen, die Rechte der Menschen verletzen und sich nicht an das Gute erinnern, das sie getan haben, werden als ungerecht bezeichnet. Als gerecht gilt die Belohnung eines jeden entsprechend seinen Verdiensten, als ungerecht gelten unverdiente Strafen und Ehrungen.
Die Tradition, Gerechtigkeit in zwei Arten zu unterteilen, geht auf Aristoteles zurück: verteilende (oder belohnende) und ausgleichende (oder leitende) Gerechtigkeit. Die erste bezieht sich auf die Verteilung von Eigentum, Ehren und anderen Vorteilen unter den Mitgliedern der Gesellschaft. In diesem Fall besteht die Gerechtigkeit darin, dass ein bestimmter Leistungsbetrag im Verhältnis zum Verdienst verteilt wird. Die zweite ist mit Austausch verbunden, und Gerechtigkeit soll die Parteien ausgleichen. Gerechtigkeit setzt ein gewisses Maß an Übereinstimmung zwischen den Mitgliedern der Gesellschaft hinsichtlich der Grundsätze, nach denen sie leben, voraus. Diese Prinzipien können sich ändern, aber das Verständnis von Gerechtigkeit hängt davon ab, welche Regeln in einer bestimmten Gesellschaft festgelegt wurden.
Barmherzigkeit. In der Geschichte der Ethik wurde die barmherzige Liebe in der einen oder anderen Form von vielen Denkern als moralisches Prinzip anerkannt. Allerdings wurden auch durchaus ernsthafte Zweifel geäußert: Erstens, ob Barmherzigkeit als ethisches Prinzip angesehen werden kann und zweitens, ob das Gebot der Liebe als Gebot, insbesondere als grundlegendes Gebot, angesehen werden kann. Das Problem wurde darin gesehen, dass Liebe, auch im weitesten Sinne, ein Gefühl, ein subjektives Phänomen ist, das nicht bewusst reguliert werden kann. Gefühle können nicht zugeschrieben werden („Du kannst deinem Herzen nicht befehlen“). Daher kann das Gefühl nicht als universelle Grundlage für moralische Entscheidungen angesehen werden.
Das Gebot der Liebe wurde vom Christentum als universelle Forderung aufgestellt, die alle Forderungen des Dekalogs enthält. Doch zugleich wird sowohl in den Predigten Jesu als auch in den Briefen des Apostels Paulus ein Unterschied zwischen dem Gesetz des Mose und dem Gebot der Liebe skizziert, das neben der theologischen Bedeutung auch einen bedeutsamen ethischen Inhalt hatte. Der ethische Aspekt der Unterscheidung zwischen dem Dekalog und dem Gebot der Liebe wurde im modernen europäischen Denken wahrgenommen.
Laut Hobbes verbieten die Regeln des Dekalogs den Eingriff in das Leben anderer Menschen und schränken den Anspruch jedes Einzelnen, alles zu besitzen, erheblich ein. Barmherzigkeit befreit und schränkt nicht ein.
Es erfordert, dass der eine dem anderen alles zugesteht, was ihm selbst zugestanden werden soll. Hobbes wies auf die Gleichheit und Äquivalenz des Goldenen Gebots hin und interpretierte es als Maßstab für soziale Beziehungen.
Daher ist Barmherzigkeit das höchste moralische Prinzip. Aber es gibt keinen Grund, dies immer von anderen zu erwarten. Barmherzigkeit muss als Pflicht und nicht als Verantwortung eines Menschen betrachtet werden. In Beziehungen zwischen Menschen ist Barmherzigkeit nur eine empfohlene Voraussetzung. Barmherzigkeit kann einem Menschen als moralische Pflicht auferlegt werden, er selbst hat jedoch das Recht, von anderen nur Gerechtigkeit und nicht mehr zu verlangen.