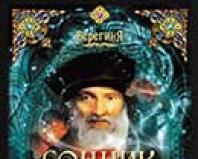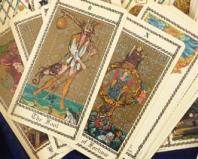Rauch. Rauch Interne Sanitärinstallationen Teil 1 Heizung
Name: Verzeichnis von Industrie-, Wohn- und Industriedesignern Öffentliche Gebäude und Strukturen Teil 2. Belüftung und Klimaanlage (interne Sanitäranlagen). technische Geräte)
I. G. Staroverova
Herausgeber: Verlag für Bauliteratur
Jahr: 1969
Seiten: 408
Format: DjVu
Größe: 13,1 MB
ISBN: -
Qualität: Gut
Serie oder Ausgabe: -
Vom Verlag
Das Buch enthält Referenzinformationen zur Berechnung und Bemessung von Fundamenten und Fundamenten von Gebäuden und Bauwerken für verschiedene Zwecke. Werden in Betracht gezogen physikalische Eigenschaften und die Grundgesetze der Bodenmechanik, die neuesten Gründungskonstruktionen, Besonderheiten ihrer Gestaltung und Funktionsweise, je nach Bodenbeschaffenheit. Sind gegeben moderne Methoden Berechnung der Setzung und Stabilität von Fundamenten sowie der Festigkeit von Fundamenten. Es werden Methoden zur künstlichen Verstärkung von Fundamenten und zur Stärkung bestehender Fundamente skizziert. Der Text des Nachschlagewerks entspricht dem neuesten Stand Regulierungsdokumente, insbesondere mit der Neuauflage der Bauordnungen und Bauordnungen. Besondere Aufmerksamkeit Das Nachschlagewerk befasst sich mit den Anforderungen der Grenzzustandsberechnung und -bemessung unter Berücksichtigung der modernen Mechanisierung der Arbeit und neuer industrieller Fundamenttypen.
Das Buch richtet sich an Ingenieure und technische Mitarbeiter in den Bereichen Design und Bauorganisationen.
Abschnitt I. ein gemeinsamer Teil
Kapitel 1. Einige physikalische Größen
Abschnitt II. Thermische Bedingungen von Gebäuden
Kapitel 2. Intern und extern Klimabedingungen
Kapitel 3. Wärmeübertragung durch Barrieren
Kapitel 4. Luftdurchlässigkeit Baumaterial und Designs
Kapitel 5. Feuchtigkeitsübertragung und Feuchtigkeitsbedingungen Fechten
Kapitel 6. Schutzeigenschaften Außenzaun. Allgemeiner Berechnungsablauf
Kapitel 7. Hitzeschutzeigenschaften von Zäunen
Kapitel 8. Luftfeuchtigkeitsbeständige Eigenschaften von Zäunen
Kapitel 9. Außenluftinfiltration durch Gehäuse
Abschnitt III. Heizung
Kapitel 10. Klassifizierung von Heizsystemen und ihr Anwendungsbereich
Kapitel 11. Geschätzte Wärmeleistung der Gebäudeheizung
Kapitel 12. Heizgeräte
Kapitel 13. Wassererwärmung
Kapitel 14. Dampfheizung von niedrigen und hoher Druck
Kapitel 15. Luftheizung
Kapitel 16. Flächenheizung
Kapitel 17. Elektrische Heizung
Kapitel 18. Merkmale der Beheizung landwirtschaftlicher Gebäude und Bauwerke
Kapitel 19. Ofenheizung
Abschnitt IV. Warmwasserversorgung
Kapitel 20. Interne Systeme Warmwasserversorgung
Abschnitt V. Wärmeeinträge
Kapitel 21. Anschluss von Wohngebäuden sowie öffentlichen und Versorgungsverbraucher Wärme-Wasser-Heizungsnetze
Kapitel 22. Beitritt Industrieunternehmen zu Wasserheizungsnetzen und Dampfleitungen
Kapitel 23. Instrumentierung und Automatisierung
Kapitel 24. Berechnung und Auswahl der Ausrüstung für Wärmeeinträge
Abschnitt VI. Wasserrohre
Kapitel 25. allgemeine Informationen
Kapitel 26. Sanitärsysteme und Diagramme
Kapitel 27. Regulatorische Daten
Kapitel 28. Wasserversorgungsnetze
Kapitel 29. Wasserdurchflussmesser (Wasserzähler)
Kapitel 30. Hydraulische Berechnung Wasserversorgungsnetze
Kapitel 31. Pumpen und Pumpeinheiten
Kapitel 32. Wassertanks und Reservoirs
Kapitel 33. Bau einer Wasserleitung unter besonderen natürlichen Bedingungen
Abschnitt VII. Kanalisation
Kapitel 34. Allgemeine Informationen
Kapitel 35. Abwassersysteme und -systeme
Kapitel 36. Empfänger Abwasser
Kapitel 37. Kanalnetze
Kapitel 38. Hydraulische Berechnung von Rohrleitungen
Kapitel 39. Pumpeinheiten
Kapitel 40. Lokale Kläranlagen und andere Spezialgeräte
Kapitel 41. Gebäudeabflüsse
Kapitel 42. Abwassernetze beim Bau von Gebäuden unter besonderen natürlichen Bedingungen
Abschnitt VIII. Gas Versorgung
Kapitel 43. Allgemeine Informationen
Kapitel 44. Gasversorgung von Wohn- und öffentlichen Gebäuden
Kapitel 45. Gasversorgung von Industrieunternehmen
Abschnitt IX. Berechnungstabellen
Kapitel 46. Tabellen zur hydraulischen Berechnung von Heizungsanlagen
Kapitel 47. Tabellen zur hydraulischen Berechnung von Wasserversorgungsnetzen
Kapitel 48. Tabellen zur hydraulischen Berechnung von Kanalnetzen
Anwendungen
1. Rohre und Verbindungsteile dazu
2. Beschläge
3. Ausrüstung für Wasser und Dampfheizung
4. Systemausrüstung Elektroheizung
5. Ausrüstung für Warmwasserversorgungs- und Gasversorgungssysteme
6. Ausrüstung für Wasserversorgungs- und Abwassersysteme
7. Allzweckausrüstung
Seien Sie nicht faul, Ihren Kommentar zum Buch zu hinterlassen
HANDBUCH FÜR PLANUNG VON INDUSTRIE-, WOHN- UND ÖFFENTLICHEN GEBÄUDEN UND STRUKTUREN, LÜFTUNG UND KLIMAANLAGE (INTERNE SANITÄRGERÄTE), Teil II Moskau – 1969
Dieses Buch ist der zweite Teil eines Nachschlagewerks für die Gestaltung innerer sanitärer und technischer Einrichtungen von Gebäuden und Bauwerken. Es enthält Anleitungs- und Regulierungsmaterialien sowie Informationen zur Berechnung und Auslegung von Lüftung, Klimatisierung usw Brief Information zur Automatisierung von Sanitärgeräten.
Das Verzeichnis richtet sich an ein breites Spektrum von Ingenieuren und Technikern in Planungs-, Installations-, Bau- und Betriebsorganisationen und kann auch für Studenten höherer und weiterführender technischer Einrichtungen nützlich sein.
VORWORT
Die Hauptaufgabe der Lüftung und Klimatisierung besteht darin, die Arbeitsbedingungen zu verbessern und die Gesundheit der Arbeitnehmer zu erhalten. Eine erfolgreiche Lösung von Sanitärproblemen kann durch erreicht werden effiziente Arbeit konzipierte Installationen. Basierend auf den neuesten Errungenschaften von Wissenschaft und Technik haben Ingenieure und Techniker eine Reihe wertvoller Arbeiten zu Design, Installation und Betrieb abgeschlossen Lüftungsgeräte und bietet die beste Qualität Luftumgebung im Arbeitsbereich Industriegebäude und Strukturen,
Das Nachschlagewerk fasst und systematisiert Erfahrungen in der Gestaltung von Lüftungs-, Klima- und Automatisierungssystemen für sanitäre und technische Geräte. Erstmals wurde versucht, für die Gestaltung notwendige Referenzmaterialien bereitzustellen, die dabei helfen sollen praktische Arbeit Ingenieure, Techniker und Studenten von Universitäten und Fachschulen. Leit- und Regelungsmaterialien werden in gekürzter Form bereitgestellt und in Form von Tabellen, Grafiken und Nomogrammen dargestellt.
Das Nachschlagewerk befasst sich mit Fragen und Methoden zur Bestimmung der in Gebäuden und Bauwerken freigesetzten (überschüssigen) Restgefahren (Wärme, Gase, Feuchtigkeit, Staub) und empfiehlt Maßnahmen zu deren Bekämpfung. Der Leitfaden konzentriert sich auf die Grundlagen natürliche Belüftung(Belüftung) und alle Arten der mechanischen Belüftung, einschließlich Absaugsysteme und pneumatischer Transport von Holzabfällen. Das Maßnahmenpaket zur Auslegung von Klimaanlagen wird ausführlich vorgestellt, wobei die Notwendigkeit berücksichtigt wird, konstante Luftparameter (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Reinigung) sowohl für Produktionszwecke als auch für die Gewährleistung eines Komforts aufrechtzuerhalten sanitäre Bedingungen. Allgemeine Bestimmungenüber die Berechnung und Auswahl von Geräten für Lüftungs- und Klimaanlagen, die im Nachschlagewerk enthalten sind, können bei der Auslegung von Lüftungsanlagen in Zivilschutzschutzbauten verwendet werden.
Da die Fragen der automatischen Steuerung und Überwachung des Betriebs von Sanitäranlagen ein komplexes Tätigkeitsfeld darstellen und in der Fachliteratur ausreichend ausführlich behandelt werden, werden sie in diesem Nachschlagewerk nur sehr kurz und nur mit dem Ziel behandelt Verknüpfung mit internen Geräten.
Die Anhänge enthalten Daten zu den wichtigsten von der Industrie hergestellten Lüftungsgeräten (Stand 31. Dezember 1968 – Ventilatoren, Lufterhitzer, Klimaanlagen, Staubabscheider, Filter und Zuluftkammern).
ABSCHNITT 1
LÜFTUNG UND KLIMAANLAGE
KAPITEL 1
GRUNDPUNKTE
II. METEOROLOGISCHE UND SANITÄRBEDINGUNGEN IN DEN RÄUMEN
Die meteorologischen Bedingungen an ständigen Arbeitsplätzen, im Arbeitsbereich von Industriegebäuden und im Servicebereich von öffentlichen Gebäuden und Wohngebäuden werden gemäß den Anweisungen von SNiP P-G.7-62 „Heizung, Lüftung und Klimatisierung“ ermittelt. Designstandards“. Die in der Tabelle angegebenen Standards. 1.1 werden die zulässige Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit und Luftgeschwindigkeit in Abhängigkeit von den Eigenschaften der Räumlichkeiten, der Menge an überschüssiger sensibler Wärme, der Arbeitskategorie und der Jahreszeit festgelegt.
Als Arbeits- oder Servicebereich gilt ein bis zu 2 Liter hoher Raum über dem Boden oder der Plattform, in dem sich Personen aufhalten oder Arbeitsplätze vorhanden sind. Gilt als dauerhaft Arbeitsplatz, wo sich der Arbeitnehmer befindet am meisten Zeit. Wenn Prozesse an verschiedenen Stellen bedient werden Arbeitsbereich, dann gilt der gesamte Arbeitsbereich als Arbeitsplatz.
In der Tabelle 1.1 Industrieräume zeichnen sich durch einen spezifischen Überschuss an sensibler Wärme in kcal/m3h aus, d. und die Menge an Wärme, die durch die Gebäudezäune des Geländes verloren geht.
Bei der Bestimmung der in den Raum eintretenden spezifischen Überschusswärme wird die im Raum freigesetzte, die Luft erwärmende und anschließend durch lokale Absaugung oder allgemeine Abluft abgeführte spürbare Wärme berücksichtigt. Lediglich die fühlbare Wärme, die im Raum erzeugt wurde, aber ohne Erwärmung der Raumluft aus dem Raum abgeleitet wurde (z. B. mit Gasen durch Schornsteine oder mit Luft aus lokalen Abluftanlagen von Geräten), sollte nicht berücksichtigt werden. Bei der Ermittlung des spezifischen Überschusses an sensibler Wärme sollte auch „latente“ Wärme, die mit abgegebener Feuchtigkeit in die Raumluft eingebracht wird, nicht berücksichtigt werden. In Tabelle. 1.1 gibt die durchschnittlichen Luftgeschwindigkeiten an, und in Fällen, in denen die niedrigsten und höchsten Grenzwerte angegeben sind, sollte eine höhere Geschwindigkeit mit einer höheren kombiniert werden hohe Temperatur Innenluft und weniger - von unten.
In der Kälte und Übergangsfristen Jahr in Produktionsgelände Bei mittelschweren und schweren Arbeiten sowie bei Einsatz von Heizungs- und Lüftungsanlagen mit konzentrierter Luftzufuhr gelten auch bei leichten Arbeiten die in der Tabelle angegebenen Luftgeschwindigkeiten. 1.1 ist eine Erhöhung auf 0,7 m/s bei gleichzeitiger Erhöhung der Lufttemperatur im Arbeitsbereich um 2 °C über den in der Tabelle angegebenen Wert zulässig, wenn dies technisch und wirtschaftlich gerechtfertigt ist. Zulässige Temperaturen und relative Luftfeuchtigkeit in Räumen, geregelt in der Tabelle. 1.1 ist zu beachten; V kalte Periode Jahr unter allen Außenluftbedingungen im Bereich von Auslegungsparametern A oder B (je nach Zweck der Lüftungs- und Klimaanlagen) bis zu einer Außentemperatur von 10 °C; während der warmen Jahreszeit unter allen Außenluftbedingungen von einer Temperatur von 10 °C und mehr bis zu den Auslegungsparametern A für die warme Jahreszeit. Die berechneten Parameter der Außenluft A und B sind in SNiP P-G.7-62 angegeben.
Die zulässigen Parameter der Innenluft für die warme Jahreszeit (siehe Tabelle 1.1) sind für alle Bereiche verbindlich, in denen die berechnete Außenlufttemperatur für Parameter A 25 °C nicht überschreitet; In Bereichen, in denen die Temperatur 25 ° C übersteigt, ist es an festen Arbeitsplätzen in Produktionsräumen zulässig, eine höhere Lufttemperatur anzunehmen oder diese mit einer höheren relativen Luftfeuchtigkeit zu kombinieren, wie in der Tabelle angegeben. 1.2. In öffentlichen Gebäuden und Wohngebäuden ist bei einer Erhöhung der Auslegungstemperatur der Außenluft eine entsprechende Erhöhung der Innentemperatur der Räumlichkeiten zulässig. In Produktionsräumen, in denen die Bodenfläche pro Arbeiter 100 m2 übersteigt, sind die in der Tabelle angegebenen zulässigen Temperaturen, relativen Luftfeuchtigkeiten und Luftgeschwindigkeiten einzuhalten. 1.1 und 1.2 im gesamten Arbeitsbereich ist aus technischen Gründen nicht möglich oder aus wirtschaftlichen Gründen nicht sinnvoll; die erforderlichen Luftparameter können nur an festen Arbeitsplätzen bereitgestellt werden.
In Produktionsräumen, in denen entsprechend den produktionstechnischen Bedingungen eine künstliche Regulierung der Temperatur oder der Temperatur und relativen Luftfeuchtigkeit der Luft erforderlich ist, dürfen in der Kälte- und Übergangszeit des Jahres meteorologische Parameter gemäß Tabelle 1 akzeptiert werden. 1,1 für die warme Jahreszeit.
In Räumen mit erheblicher Feuchtigkeitsabgabe, an Dauerarbeitsplätzen oder in Servicebereichen ist eine Erhöhung der in der Tabelle angegebenen relativen Luftfeuchtigkeit zulässig. 1,1 für die warme Jahreszeit. Unter signifikant verstehen wir solche Feuchtigkeitsfreisetzungen, bei denen das Wärme-Feuchte-Verhältnis, d. h. das Verhältnis der Gesamtmenge an fühlbarer und latenter Wärme (in kcal/h) zur Menge an freigesetzter Feuchtigkeit (in kg/h), weniger als 2000 beträgt kcal/kg.
Wenn das Wärme-Feuchtigkeits-Verhältnis weniger als 2000 kcal/kg, aber mehr als 1000 kcal/kg beträgt, darf die relative Luftfeuchtigkeit um maximal 10 % und bei einem Verhältnis von weniger als 1000 kcal/kg um maximal 10 % erhöht werden maximal 20 %, jedoch in beiden Fällen nicht höher als 80 %. In diesem Fall sollte die Lufttemperatur im Raum nicht überschritten werden
Luftparameter im Versorgungsbereich von öffentlichen und Wohngebäuden, angegeben in der Tabelle. 1.1 bezieht sich für die warme Jahreszeit auf Räumlichkeiten, für die laut SNiP eine Berechnung des Luftaustauschs erforderlich ist (z. B. Theater- und Restaurantsäle sowie Auditorien). In Industrieräumen öffentlicher Gebäude (z. B. in Küchen, Bäckereien, Wäschereien etc.) sind die zulässigen Parameter der Innenluft gemäß Tabelle zu ermitteln. 1.1 und 1.2 wie für Produktionsräume.
Zusätzlich zu den zulässigen meteorologischen Bedingungen in der Tabelle. 1.1 zeigt optimale Bedingungen. Sie werden durch die für das Wohlbefinden der meisten normal gekleideten Menschen günstigsten Kombinationen von Temperatur, relativer Luftfeuchtigkeit und Luftgeschwindigkeit bestimmt. Optimale Luftparameter werden durch die Art der von einem Menschen verrichteten Arbeit bestimmt und unterscheiden sich in der kalten und warmen Jahreszeit etwas, da die Menschen in diesen Jahreszeiten unterschiedlich gekleidet sind und unterschiedlichen äußeren Einflüssen ausgesetzt sind. Die in der Tabelle angegebenen Bedingungen. 1,1 sind optimal, wenn sich Personen unabhängig von der Außentemperatur mindestens 3 Stunden im Raum aufhalten.
Bei einem kurzen Aufenthalt (weniger als 3 Stunden) von Personen im Raum optimale Temperatur Etwas höher ist der ungefähre Wert und die Methode zur Bestimmung in Kapitel 7 angegeben.
Für folgende öffentliche Gebäude und Wohngebäude ist die Einhaltung optimaler Luftparameter zwingend erforderlich:
1) Operationssäle, Entbindungsstationen, Stationen für Neugeborene, postoperative Stationen und Stationen für Patienten, die besondere meteorologische Bedingungen benötigen, in Krankenhäusern der Kategorien 1, 2 und 3;
2) Auditorien und Theaterfoyers;
3) Säle von Kinos, Clubs und Kulturpalästen mit 600 Sitzplätzen oder mehr;
4) Speisesäle von Restaurants und Kantinen der 1. Kategorie mit 250 oder mehr Sitzplätzen;
5) Verkaufsräume großer Geschäfte mit einer Anzahl von Arbeitsplätzen von 75 oder mehr;
6) Teile von Hotelzimmern mit 500 Zimmern oder mehr.
In Kunstgalerien, Museen, Buchdepots und Archiven von nationaler Bedeutung ist es zur Gewährleistung der Erhaltung kultureller und künstlerischer Werte ohne besondere Anforderungen an das interne Regime auch erforderlich, optimale Parameter als Gestaltungsbedingungen auszuwählen. Die Einhaltung optimaler Luftparameter entsprechend der Kategorie leichter Arbeiten (siehe Tabelle 1.1) ist auch in Ruheräumen für Arbeitnehmer und in begrenzten Ruhebereichen in der Nähe des Arbeitsplatzes obligatorisch. Zusätzlich zu den oben aufgeführten Fällen empfiehlt sich die Verwendung optimaler oder nahe bei ihnen liegender Luftparameter, wenn deren Einhaltung keine zusätzlichen Kosten verursacht (z. B. der Einsatz künstlicher Luftkühlung in der warmen Jahreszeit) oder wenn wissenschaftliche Forschungsarbeiten durchgeführt wurden Versuchsmaterial und entsprechende Berechnungen belegen die technische und wirtschaftliche Machbarkeit zusätzlicher Kapital- und Betriebskosten, die mit der Aufrechterhaltung solcher Bedingungen in den Räumlichkeiten verbunden sind. Unabhängig von den akzeptierten meteorologischen Bedingungen sollte der Gehalt an giftigen Gasen, Dämpfen, Staub und anderen Aerosolen in der Luft des Arbeitsbereichs des Betriebsgeländes die in SNiP P-G.7-62 und SN angegebenen maximal zulässigen Konzentrationen nicht überschreiten 245-63, unter Berücksichtigung der Änderungen und Ergänzungen in den Listen des Gesundheitsministeriums der UdSSR Nr. 473-64, 505a-64, 526-65, 543-65 und 620-66.
1.2. DESIGNPARAMETER DER AUSSENLUFT
Zulässige und optimale Raumluftparameter müssen von Lüftungs- und Klimaanlagen je nach Art und Zweck der Anlagen innerhalb der Auslegungsparameter der Außenluft A, B und C bereitgestellt werden (siehe SNiP P-G.7-62).
Bei der Berechnung von Lüftungs- und Klimaanlagen ist Folgendes zu berücksichtigen:
a) für natürliche und mechanische allgemeine Belüftung, zur Bekämpfung übermäßiger Hitze-, Feuchtigkeits- oder Gasgefahren, die durch maximal zulässige Konzentrationen von mehr als 100 mg/mA gekennzeichnet sind, einschließlich zur Belüftung durch Verdunstungskühlung der Luft durch Versprühen von Wasser in Innenräumen oder in Bewässerungskammern – Design-Parameter Außenluft A;
b) zur allgemeinen Belüftung zur Bekämpfung von Gasgefahren, die durch maximal zulässige Konzentrationen von 100 mg/m3 oder weniger gekennzeichnet sind, oder zum Ausgleich der durch örtliche Absaugung und technologische Geräte (z. B. Verbrennung, pneumatischer Transport, Trockner usw.) entfernten Luft. ), auch für die Belüftung mit Verdunstungskühlung der Luft durch Versprühen von Wasser in Innenräumen oder in Bewässerungskammern, - berechnete Parameter der Außenluft B für die kalte Jahreszeit und A für die warme Jahreszeit;
c) für Luftduschsysteme zur Bekämpfung von Strahlungswärme, die in der Außenluft betrieben werden – berechnete Parameter der Außenluft B; für Luftduschsysteme für andere Zwecke - berechnete Parameter der Außenluft A für die warme Jahreszeit und B für die kalte Jahreszeit;
d) bei Klimaanlagen in der Regel die berechneten Parameter der Außenluft B;
e) für Luftheizungssysteme, Luft- und Luftwärmevorhänge – berechnete Parameter der Außenluft B für die kalte Jahreszeit.
Für die Klimatisierung ist die Übernahme des Außenluftparameters B nur in begründeten Fällen zulässig technologische Anforderungen. Für Gebäude und Räumlichkeiten, die während eines Teils des Tages (z. B. nur in den Abendstunden) betrieben werden, sind begründete Abweichungen von den in SNiP P-G.7-62 festgelegten Auslegungsparametern der Außenluft zulässig.
Dauer des berechneten oder höheren Wärmegehalts der Außenluft für eine Reihe von Städten der UdSSR im Jahr warme Zeit Jahr kann aus der Tabelle ermittelt werden. 1.3. Diese Daten können bei der Berechnung von Klimaanlagen verwendet werden, um die Kaltströmungsraten in der warmen Jahreszeit zu ermitteln.
...4. Auflage. Es werden grundlegende Informationen zur Berechnung der thermischen Bedingungen von Räumlichkeiten sowie zur Auswahl, Auslegung und Berechnung von Heizsystemen für Gebäude und Bauwerke bereitgestellt. Es wird eine Methodik zur Nutzung der Wärme von geothermischem Wasser und Solarenergie skizziert. Die 3. Auflage erschien 1975 unter dem Titel. „Heizung, Sanitär und Kanalisation.“ Für Ingenieure und technische Mitarbeiter von Design- und Bauorganisationen.
Vorwort
Abschnitt I. Thermische Bedingungen des Gebäudes
Kapitel 1. Klimatische Bedingungen im Innen- und Außenbereich
1.1. Meteorologische Bedingungen in Innenräumen
1.2. Geschätzte Eigenschaften des Außenklimas für die kalte Jahreszeit
Kapitel 2. Wärmeübertragung durch Barrieren
2.1. Stationäre Wärmeübertragung
2.2. Transiente Wärmeübertragung
2.3. Wärmeübertragung durch eine komplexe Umhüllung mit zweidimensionalen Elementen
Kapitel 3. Luftdurchlässigkeit von Baumaterialien und Bauwerken
Kapitel 4. Feuchtigkeitstransport und Feuchtigkeitsregime des Zauns
Kapitel 5. Schutzeigenschaften von Außenzäunen
5.1. Allgemeiner Berechnungsablauf
5.2. Erforderlicher (minimal zulässiger) Wärmeübergangswiderstand
5.3. Optimaler (wirtschaftlich vertretbarer) Widerstand gegen Wärmeübertragung des Zauns
5.4. Wärmeschutz von Lichtöffnungen und Türen
5.5. Erforderlicher Wärmewiderstand des Zauns
5.6. Erforderlicher Wärmewiderstand von Böden
5.7. Erforderlicher Luftdurchlässigkeitswiderstand
5.8. Erforderlicher Dampfdurchlässigkeitswiderstand
Kapitel 6. Eindringen von Außenluft durch das Gehäuse
6.1. Infiltration der Außenluft in Industriegebäuden und einstöckigen öffentlichen Gebäuden
6.2. Luftinfiltration in mehrstöckigen öffentlichen Gebäuden, die mit mechanischen Lüftungssystemen ausgestattet sind
Abschnitt II. Heizung
Kapitel 7. Klassifizierung und Auswahl von Heizsystemen
7.1. Haupttypen von Heizsystemen
7.2. Auswahl eines Heizsystems
7.3. Merkmale der Auswahl eines Heizsystems in einem Gebäude mit variablen thermischen Bedingungen
Kapitel 8. Wärmeleistung des Heizsystems
8.1. Raumwärmehaushalt
8.2. Wärmeverlust im Raum
8.3. Wärmeeintrag in den Raum
8.4. Geschätzte Wärmeleistung des Heizsystems
8.5. Wärmeverlust eines Gebäudes nach vergrößerten Zählern
Kapitel 9. Heizgeräte
9.1. Arten von Heizgeräten
9.2. Auswahl und Platzierung von Heizgeräten
9.3. Wärmeübertragung von Heizgeräten
9.4. Geschätzte Temperatur des Wasserkühlmittels in Heizgeräten
9.5. Thermische Berechnung von Geräten
9.6. Beispiele thermische Berechnung Heizgeräte
9.7. Regulierung der Wärmeübertragung von Heizgeräten
9.8. Installation von Heizgeräten
Kapitel 10. Warmwasserbereitung
10.1. allgemeine Informationen
10.2. Systemklassifizierung
10.3. Systemdesign-Sequenz
10.4. Systemauswahl
10.5. Hydraulischer Druck im System
10.6. System-Design
10.7. Auslegungszirkulationsdruck im System
10.8. Methoden zur hydraulischen Berechnung einer Heizungsanlage
10.9. Hydraulische Berechnung des Systems auf Basis spezifischer linearer Druckverluste
10.10. Hydraulische Berechnung des Systems anhand von Widerstandskennlinien
10.11. Hydraulische Berechnung eines Einrohrsystems mit Steigleitungen einheitlicher Bauart und toter Wasserbewegung im Leitungsnetz entsprechend den Eigenschaften des hydraulischen Widerstands
10.12. Hydraulische Berechnung des Schwerkraftsystems
Kapitel 11. Dampfheizung
11.1. Klassifizierung von Dampfheizsystemen
11.2. Richtlinien zur Auswahl von Dampfheizsystemen und -kreisläufen
11.3. Designrichtlinien
11.4. Berechnung von Dampfleitungen
11.5. Berechnung von Kondensatleitungen
11.6. Anleitung zur Auswahl und Berechnung der Ausrüstung
Kapitel 12. Luftheizung
12.1. allgemeine Informationen
12.2. Berechnung von Luftheizungssystemen
12.3. Beispiele zur Berechnung von Luftheizungssystemen
Kapitel 13. Flächenheizung
13.1. allgemeine Informationen
13.2. Heizpaneel-Designs und Systemdiagramme
13.3. Thermische Berechnung der Flächenheizung
Kapitel 14. Elektrische Heizung
14.1. Klassifizierung und Anwendungsbereich elektrischer Heizsysteme
14.2. Strahlungskonvektive elektrische Heizung
14.3. E-Lok mit stickiger Heizung
14.4. Infrarot-Elektroheizung
Kapitel 15. Merkmale der Beheizung landwirtschaftlicher Gebäude und Bauwerke
15.1. Heizsysteme in Tierställen
15.2. Geflügelbetrieb
15.3. Anbauanlagen für den ganzjährigen Gemüseanbau
Kapitel 16. Nutzung der Wärme der Sonnenenergie
16.1. Klassifizierung solarer Warmwasserversorgungs- und Heizsysteme
16.2. Schätzung der verfügbaren Solarenergie
16.3. Klassifizierung und Auswahl von Solarenergiekollektoren (SEC)
16.4. Klassifizierung und Auswahl von Wärmespeichern
16.5. Allgemeine Bestimmungen für Systemberechnungen Solarheizung und Warmwasserversorgung
16.6. Berechnung saisonaler Warmwasserversorgungssysteme
16.7. Klärung der thermischen Berechnung des SST unter Berücksichtigung der tatsächlichen Eigenschaften des Systems
Kapitel 17. Nutzung der Wärme geothermischer Gewässer
17.1. Klassifizierung geothermischer Wässer
17.2. Besonderheiten des geothermischen Kühlmittels
17.3. Technische und wirtschaftliche Bewertung von Möglichkeiten für Systeme zur Nutzung der Wärme geothermischer Wässer
17.4. Schematische Darstellungen geothermischer Heizsysteme
17.5. Erdwärmeverbraucher
Anhang I. Einige physikalische Größen
Anhang II. Tabellen zur hydraulischen Berechnung von Heizungsanlagen
Anhang III. Stahlrohre und Verbindungsteile damit
Anhang IV Allgemeine Informationen zur Ausstattung
Anhang V. Kräne
Anhang VI. Absperrventile
Anhang VII. Ventile
Anhang VIII. Ventile
Anhang IX. Kondensatableiter
Anhang X. Heizgeräte
Anhang XI. Heizgeräte
Anhang XII. Ausrüstung für elektrische Heizsysteme
Anhang XIII. Pumps
Subject Index