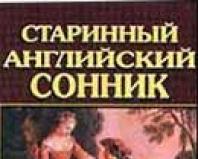Was sind die Sakramente? Sakramente der Orthodoxen Kirche. Beichte und Kommunion – Orthodoxe Sakramente für den Alltag
Das Wort „Sakrament“ hat in der Heiligen Schrift mehrere Bedeutungen:
1. Ein tiefer, intimer Gedanke, eine Sache oder eine Handlung.
2. Die göttliche Heilsökonomie der Menschheit, die als Geheimnis dargestellt wird, das für niemanden, nicht einmal für Engel, unverständlich ist.
3. Die besondere Wirkung der Vorsehung Gottes gegenüber den Gläubigen, durch die ihnen die unsichtbare Gnade Gottes im Sichtbaren mitgeteilt wird.
In Bezug auf kirchliche Riten umfasst das Wort „Sakrament“ den ersten, zweiten und dritten Begriff.
Im weitesten Sinne ist alles, was in der Kirche getan wird, ein Sakrament.
Dies gilt nicht nur für die Dienste der Priester, sondern auch für das Leben der Gemeindemitglieder – der Gläubigen, die die Kirche als Leib Christi bilden. Der Appell eines Menschen an Gott, das Gebet und die göttliche Antwort, die jeder, der von ganzem Herzen betet, zwangsläufig erhält, ist ein unverständliches Geheimnis. Aber das Leben der Gläubigen ist von diesem Geheimnis erfüllt, sie tauchen immer wieder darin ein und gehen anders aus dieser Erfahrung hervor – getröstet im Leid, erfüllt mit spiritueller Kraft und Freude. Im Laufe seines Lebens lernt ein Mensch zu verstehen, was Gott ihm sagt – in Zeichen oder Symbolen, in zufälligen Begegnungen, in den Worten von Kirchenliedern, in Büchern und Filmen, in den Ereignissen des umgebenden Lebens.
Selbst die Tatsache, dass jemand plötzlich über den Glauben nachdachte, stehen blieb und zufällig in die Kirche schaute, ist zweifellos Gottes Vorsehung für diesen Menschen. Die gesamte Kette von Umständen, aufgrund derer sich ein Mensch an der Schwelle eines Tempels befindet und etwas Unbekanntes, völlig Ungewöhnliches in seine innere Welt aufnimmt, ist nichts anderes als das Wirken Gottes im Leben eines einzelnen Menschen.
Die Apostel schreiben darüber, die ersten Christen haben das sehr gut verstanden, in den Werken christlicher Heiliger – Lehrer der Kirche und Heiliger Gottes – wird mit besonderer Kraft und Klarheit die Idee vermittelt, dass das ganze Leben eines Menschen in der Nachfolge Christi besteht ein unvorstellbares und großes Geheimnis.
In der alten Kirche gab es keinen besonderen Begriff für die Sakramente als eigenständige Kategorie kirchlicher Handlungen. Der Begriff Misterion wurde zunächst im weiteren und allgemeineren Sinne von „Heilsgeheimnis“ verwendet und erst in einer zweiten, zusätzlichen Bedeutung zur Bezeichnung privater Gnadenhandlungen, also der Sakramente selbst. Unter dem Wort Sakrament verstanden die Heiligen Väter also alles, was mit der göttlichen Ökonomie unseres Heils zusammenhängt.
In den folgenden Jahrhunderten unterschied die christliche Tradition, die sich im 15. Jahrhundert in theologischen Schulen entwickelte, von den vielen gnadenvollen kirchlichen Riten die sieben Sakramente selbst: Firmung, Kommunion, Buße, Priestertum, Ehe, Salbungssegen.
Die Sakramente zeichnen sich durch folgende Pflichteigenschaften aus:
1. Die Sakramente werden von Gott eingesetzt
2. Im Sakrament kommt die Kraft Gottes auf den Menschen herab – die unsichtbare Gnade
3. Das Sakrament wird durch sichtbare und verständliche heilige Riten gespendet
Äußere Handlungen („sichtbares Bild“) haben an sich keine Bedeutung, sie sind für die Person bestimmt, die sich dem Sakrament nähert. Dies erklärt sich aus der Tatsache, dass der Mensch von Natur aus sichtbare Mittel benötigt, um die unsichtbare Kraft Gottes wahrzunehmen.
Drei Sakramente werden im Evangelium direkt erwähnt – Kommunion und Buße. Hinweise auf den göttlichen Ursprung anderer Sakramente finden sich in der Apostelgeschichte und den Apostolischen Briefen sowie in den Werken der Kirchenlehrer der ersten Jahrhunderte des Christentums (der heilige Märtyrer Justinus, der heilige Clemens von Alexandria, der heilige St. Irenäus von Lyon, Origenes, Tertullian, St. Cyprian usw.)
In jedem Sakrament wird dem Gläubigen eine bestimmte Gnadengabe zuteil:
1. Einem Menschen wird Gnade geschenkt, die ihn von seinen früheren Sünden befreit und ihn heiligt.
2. B Sakrament der Firmung Wenn Teile des Körpers mit heiliger Myrrhe gesalbt werden, erhält der Gläubige Gnade, die ihn auf den Weg des spirituellen Lebens bringt.
3. B Sakrament der Buße Wer seine Sünden bekennt, erhält durch eine sichtbare Vergebungsbekundung des Priesters die Gnade, die ihn von seinen Sünden befreit.
4. B Das Sakrament der Kommunion (Eucharistie) Der Gläubige erhält die Gnade der Vergöttlichung durch die Vereinigung mit Christus.
5. B Das Sakrament der Salbung Bei der Salbung des Körpers mit Öl (Öl) wird dem Kranken die Gnade Gottes zuteil, wodurch geistige und körperliche Gebrechen geheilt werden.
6. B Sakrament der Ehe Den Ehegatten wird Gnade zuteil, die ihre Vereinigung (im Bild der geistlichen Vereinigung Christi mit der Kirche) sowie die Geburt und christliche Erziehung ihrer Kinder heiligt.
7. B Sakrament des Priestertums Durch die hierarchische Ordination (Ordination) wird dem zu Recht Auserwählten unter den Gläubigen die Gnade verliehen, die Sakramente zu spenden und die Herde Christi zu hüten.
Die Sakramente der orthodoxen Kirche sind in die für alle Christen verbindlichen Sakramente unterteilt:
Taufe, Firmung, Buße, Kommunion und Salbung sowie die optionalen Sakramente sind die Sakramente der Ehe und des Priestertums. Darüber hinaus gibt es wiederholte Sakramente – Reue, Kommunion, Salbungssegen und unter bestimmten Bedingungen – Ehe; und nicht wiederholbar, dazu gehören Taufe, Firmung und Priestertum.
Einführung
1. Sakramente der Orthodoxen Kirche: Allgemeine Informationen
2. Sieben Sakramente der Orthodoxen Kirche
2.1 Das Sakrament der Heiligen Taufe
2.2 Sakrament der Firmung
2.3 Sakrament der Reue
2.4 Sakrament der Kommunion
2.5 Hochzeit
2.6 Priestertum
Abschluss
Einführung
Orthodoxe Sakramente sind heilige Riten, die in orthodoxen Kirchenriten offenbart werden und durch die den Gläubigen die unsichtbare göttliche Gnade oder Heilskraft Gottes mitgeteilt wird.
Die Sakramente sind etwas Unveränderliches, ontologisch Inhärentes der Kirche. Im Gegensatz dazu haben sich im Laufe der Kirchengeschichte nach und nach sichtbare heilige Riten (Riten) herausgebildet, die mit der Ausübung der Sakramente verbunden sind.
Historisch gesehen erlaubte die Orthodoxie die Verwendung verschiedener Riten, doch nach dem Großen Schisma etablierte sich fast ausschließlich die Verwendung des byzantinischen Ritus.
Der Ausführende der Sakramente ist Gott, der sie mit den Händen des Klerus vollzieht.
Die formulierte Isolierung der sieben Sakramente vom Gottesdienst stammt aus der lateinischen scholastischen Theologie am Ende des 16. Jahrhunderts, die in Konstantinopel durch theologische Polemik mit Protestanten und in Moskau durch den starken Einfluss der Kiewer Schule (Kiew-Mohyla-Akademie) verursacht wurde. über die entstehende akademische Theologie. Die Tradition, die Sakramente von anderen heiligen Riten der Kirche (klösterliche Tonsur, Trauergottesdienst, große Wassersegnung usw.) zu unterscheiden, war jedoch fest in der späteren Schultheologie verankert.
Der Zweck dieser Arbeit: die Sakramente der orthodoxen Kirche zu charakterisieren.
Sakramente der Orthodoxen Kirche: Allgemeine Informationen
Die Kirche auf Erden ist der Mittelpunkt des wahren spirituellen Lebens, der Heiligtümer, der Wahrheit Gottes, der Weisheit, der Stärke, des Friedens und der Freiheit. Die Kirche ist eine Gesellschaft der Geretteten, eine heilige und geheimnisvolle Vereinigung rechtschaffener Seelen, die zu Gott gegangen sind und bereits im Himmel regieren, und Menschen orthodoxer Gläubiger, die demütig und freudig ihr Kreuz im irdischen Leben tragen. Sie sind durch das Oberhaupt der Kirche – unseren Herrn Jesus Christus – vereint, und der Heilige Geist belebt, heiligt und stärkt diese Vereinigung. Die Institutionen, Rituale und Bräuche der orthodoxen Kirche entstehen durch den Willen ihres Oberhauptes – des Herrn Jesus Christus und ihres Steuermanns – des Heiligen Geistes …
Sakrament (griech. mysterion – Geheimnis, Sakrament) – heilige Handlungen, bei denen den Gläubigen die unsichtbare Gnade Gottes unter einem sichtbaren Bild mitgeteilt wird.
Das Wort „Sakrament“ hat in der Heiligen Schrift mehrere Bedeutungen.
Ein tiefer, intimer Gedanke, eine Sache oder eine Handlung.
Die göttliche Heilsökonomie der Menschheit, die als Geheimnis dargestellt wird, das für niemanden, nicht einmal für die Engel, unverständlich ist.
Die besondere Wirkung der Vorsehung Gottes gegenüber den Gläubigen, durch die ihnen die unsichtbare Gnade Gottes im Sichtbaren unverständlich mitgeteilt wird.
Wenn es auf kirchliche Zeremonien angewendet wird, umfasst das Wort Sakrament den ersten, zweiten und dritten Begriff.
Im weitesten Sinne des Wortes ist alles, was in der Kirche geschieht, ein Sakrament: „Alles in der Kirche ist ein heiliges Sakrament. Jede heilige Zeremonie ist ein heiliges Sakrament. - Und selbst das Unbedeutendste? „Ja, jede von ihnen ist tief und rettend, wie das Geheimnis der Kirche selbst, denn selbst die „unbedeutendste“ heilige Handlung im theanthropischen Organismus der Kirche steht in einer organischen, lebendigen Verbindung mit dem gesamten Geheimnis der Kirche und der Gottmensch selbst, der Herr Jesus Christus“ (Archim. Justin (Popovich)).
Wie Rev. bemerkte. John Meyendorff: „In der patristischen Ära gab es nicht einmal einen speziellen Begriff, um „Sakramente“ als eine besondere Kategorie kirchlicher Handlungen zu bezeichnen: Der Begriff „Misterion“ wurde zunächst im weiteren und allgemeineren Sinne des „Heilsgeheimnisses“ verwendet. und nur im zweiten Hilfssinn wurde es verwendet, um private Handlungen, „Heilspenden“, also die Sakramente selbst, zu bezeichnen.
Unter dem Wort „Sakrament“ verstanden die Heiligen Väter also alles, was mit der göttlichen Ökonomie unseres Heils zusammenhängt.
Aber die Tradition, die ab dem 15. Jahrhundert in orthodoxen theologischen Schulen Gestalt anzunehmen begann, unterscheidet von den zahlreichen gnadenvollen heiligen Riten die sieben Sakramente selbst: Taufe, Firmung, Kommunion, Buße, Priestertum, Ehe, Salbungssegen.
Erläuterung des 10. Artikels des Glaubensbekenntnisses („Ich bekenne eine Taufe zur Vergebung der Sünden“), einem Katechismus namens „Orthodoxes Bekenntnis“, der im 18. und 19. Jahrhundert in Russland weit verbreitet war (die Originalausgabe wurde unter der Leitung von verfasst). Peter Mogila; die erste vollständige Ausgabe auf Griechisch im Jahr 1667) lautet: „Da er die Taufe, das erste Sakrament, erwähnt, gibt er uns Gelegenheit, über die sieben Sakramente der Kirche nachzudenken. Dies sind die folgenden: Taufe, Firmung, Eucharistie, Buße, Priestertum, ehrliche Ehe und Segen der Salbung. Diese sieben Sakramente entsprechen den sieben Gaben des Heiligen Geistes. Denn durch diese Sakramente gießt der Heilige Geist seine Gaben und seine Gnade auf die Seelen derer aus, die sie richtig nutzen. Patriarch Jeremia erörtert dieses Thema ausführlich in dem Buch, das Lutheraner zur Bekehrung geschrieben haben.“
Alle Aspekte des Lebens der Orthodoxie sind das Ergebnis der religiösen und historischen Entwicklung des lebendigen Leibes der Kirche. Dieser Vorgang wird oft damit verglichen, wie aus einem kleinen Samen ein mächtiger Baum wächst. Die sieben Sakramente nahmen in der Kirche nicht sofort Gestalt an; eine solche Anzahl wurde erst im 15.-16. Jahrhundert eingeführt. Der erste Versuch, die Sakramente zu systematisieren, ist mit dem Namen des Heiligen verbunden. Dionysios der Areopagit. In dem Buch „Über die Kirchenhierarchie“ identifizierte er sechs Sakramente. Die ersten Erwähnungen der Formel für die siebenfache Anzahl von Sakramenten in orthodoxen Quellen, ohne dass sich ihre Zusammensetzung von der aktuellen unterscheidet, finden sich in den Briefen von John Veccus (1277) und im sogenannten „Glaubensbekenntnis“ von der byzantinische Kaiser Michael Palaiologos und sein Sohn Andronikos.
Alle sieben Sakramente haben die folgenden notwendigen Eigenschaften:
) göttliche Einrichtung;
) unsichtbare Gnade, die im Sakrament gelehrt wird;
) sichtbares Bild (im Folgenden) seiner Fertigstellung.
Äußere Handlungen („sichtbares Bild“) in den Sakramenten haben an sich keinen Sinn. Sie richten sich an eine Person, die sich dem Sakrament nähert, da sie von Natur aus sichtbare Mittel benötigt, um die unsichtbare Kraft Gottes wahrzunehmen.
Die Sakramente der orthodoxen Kirche sind unterteilt in:
) unwiederholbar – Taufe, Firmung, Priestertum;
) wiederholt - Reue, Kommunion, Salbungssegen und unter bestimmten Bedingungen Ehe.
Darüber hinaus sind die Sakramente in zwei weitere Kategorien unterteilt:
) obligatorisch für alle Christen – Taufe, Firmung, Buße, Kommunion und Segnung der Salbung;
) optional für alle – Ehe und Priestertum.
Sieben Sakramente der Orthodoxen Kirche
In der Orthodoxie werden sieben Sakramente akzeptiert: Taufe, Firmung, Eucharistie (Komunion), Buße, Sakrament des Priestertums, Sakrament der Ehe und Segnung der Salbung (Salbung).
Taufe, Buße und Eucharistie wurden von Jesus Christus selbst eingeführt, wie im Neuen Testament direkt berichtet wird.
Die kirchliche Tradition bezeugt den göttlichen Ursprung anderer Sakramente. Hinweise auf den göttlichen Ursprung anderer Sakramente finden sich in der Apostelgeschichte, in den Apostolischen Briefen sowie in den Werken der apostolischen Männer und Lehrer der Kirche der ersten Jahrhunderte des Christentums (Heiliger Märtyrer Justin, St . Irenäus von Lyon, Clemens von Alexandria, Origenes, Tertullian, St. Cyprian usw.).
In jedem Sakrament wird dem christlichen Gläubigen eine bestimmte Gnadengabe mitgeteilt.
Im Sakrament der Taufe wird einem Menschen die Gnade geschenkt, die ihn von seinen früheren Sünden befreit und ihn heiligt.
Im Sakrament der Firmung wird dem Gläubigen durch die Salbung von Körperteilen mit heiligem Chrisam die Gnade zuteil, die ihn auf den Weg des geistlichen Lebens führt.
Im Sakrament der Buße erhält derjenige, der seine Sünden bekennt, durch eine sichtbare Vergebungsbekundung des Priesters die Gnade, die ihn von seinen Sünden befreit.
Im Sakrament der Kommunion (Eucharistie) empfängt der Gläubige die Gnade der Vergöttlichung durch die Vereinigung mit Christus.
Im Sakrament des Segens der Salbung wird dem Kranken bei der Salbung des Körpers mit Öl (Öl) die Gnade Gottes zuteil, die geistige und körperliche Gebrechen heilt.
Im Sakrament der Ehe wird den Ehegatten eine Gnade geschenkt, die ihre Verbindung (im Bild der geistlichen Vereinigung Christi mit der Kirche) sowie die Geburt und christliche Erziehung ihrer Kinder heiligt.
Im Sakrament des Priestertums wird dem rechtmäßig Auserwählten unter den Gläubigen durch die Einsetzung eines Hierarchen (Ordination) die Gnade verliehen, die Sakramente zu spenden und die Herde Christi zu hüten.
2.1 Das Sakrament der Heiligen Taufe
Wir alle wissen, dass einem Kind bei der Geburt in einer Familie eine Geburtsurkunde ausgehändigt wird. Demnach ist das Neugeborene vollwertiger Staatsbürger des Landes, in dem es geboren wurde. Jetzt können Eltern ihrem Kind nur nach und nach die grundlegenden Gesetze und Verhaltensnormen eines bestimmten Landes beibringen.
Fast dasselbe geschieht im Sakrament der Taufe. Allerdings mit einem wesentlichen Unterschied: Ein „Neugeborenes“, genauer gesagt ein Neugetaufter, kann sowohl ein Säugling als auch ein Erwachsener, sogar ein sehr alter Mensch sein; das Land, dessen „Bürger“ der Neugetaufte wird, ist eines für alle – das Himmelreich; die „Eltern“ der neu getauften Person werden Paten oder Pate und Mutter genannt; die Gesetze und Verhaltensnormen werden nicht von Menschen, sondern von Gott formuliert und in der Heiligen Schrift bzw. im Evangelium dargelegt; Im Gegensatz zu irdischen Staaten, in denen die Macht verschiedenen Menschen oder Menschengruppen zusteht, gibt es im Himmelreich einen Herrscher – Gott die Dreifaltigkeit, Gott den Schöpfer.
Um Subjekt oder Bürger des himmlischen Reiches Gottes zu werden, existiert das Sakrament der Heiligen Taufe.
Wenn ein Erwachsener oder sogar ein Jugendlicher getauft wird, wird er vor der Taufe bekannt gegeben. Das Wort „ankündigen“ oder „ankündigen“ bedeutet, den Namen der Person, die sich auf die Taufe vorbereitet, öffentlich zu machen, zu benachrichtigen, vor Gott bekannt zu geben. Während seiner Vorbereitung beschäftigt er sich mit den Grundlagen des christlichen Glaubens. Sein Name ist im Kirchengebet „für die Katechumenen“ enthalten. Wenn die Zeit der Heiligen Taufe kommt, betet der Priester zum Herrn, er möge aus diesem Menschen jeden bösen und unreinen Geist vertreiben, der in seinem Herzen verborgen und nistend ist, und ihn zu einem Mitglied der Kirche und zum Erben der ewigen Glückseligkeit machen; Der Getaufte verzichtet auf den Teufel, verspricht, nicht ihm, sondern Christus zu dienen, und bekräftigt durch die Lektüre des Glaubensbekenntnisses seinen Glauben an Christus als König und Gott.
Das Baby wird von seinen Paten (Paten) erklärt, die die Verantwortung für die geistige Erziehung des Kindes übernehmen. Von nun an beten Paten für ihren Patensohn (oder ihre Patentochter), bringen ihm das Beten bei und erzählen ihm vom Himmelreich und seinen Gesetzen.
Das Sakrament der Taufe vollziehen. Zuerst weiht der Priester das Wasser und betet zu diesem Zeitpunkt, dass das Weihwasser den Täufling von früheren Sünden wäscht und dass er sich durch diese Weihe mit Christus vereint. Anschließend salbt der Priester den Täufling mit gesegnetem Öl (Olivenöl).
Öl ist ein Bild der Barmherzigkeit, des Friedens und der Freude. Mit den Worten „im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes“ salbt der Priester die Stirn mit einem Kreuz (und prägt den Namen Gottes in den Geist ein), die Brust („zur Heilung von Seele und Körper“). , Ohren („für das Hören des Glaubens“), Hände (um Taten zu vollbringen, die Gott gefallen), Füße (um auf den Wegen der Gebote Gottes zu wandeln). Danach erfolgt ein dreimaliges Eintauchen in Weihwasser mit den Worten: „Der Diener Gottes (Name) wird auf den Namen des Vaters getauft.“ Amen. Und der Sohn. Amen. Und der Heilige Geist. Amen".
In diesem Fall erhält die getaufte Person den Namen eines Heiligen oder einer Heiligen. Von nun an wird dieser Heilige oder Heilige nicht nur zum Gebetbuch, Fürsprecher und Beschützer der Getauften, sondern auch zum Vorbild, zum Vorbild für das Leben in Gott und mit Gott. Dies ist der Schutzpatron der Getauften, und der Tag seiner Erinnerung wird zum Feiertag für die Getauften – der Namenstag.
Das Eintauchen ins Wasser symbolisiert den Tod mit Christus, und das Verlassen des Wassers symbolisiert neues Leben mit ihm und die bevorstehende Auferstehung.
Dann zieht der Priester mit dem Gebet „Gib mir ein Gewand aus Licht, kleide dich in Licht wie ein Gewand, o barmherziger Christus, unser Gott“, dem Neugetauften weiße (neue) Kleider (Hemd) an. Aus dem Slawischen übersetzt klingt dieses Gebet so: „Gib mir saubere, helle, makellose Kleidung, er selbst ist in Licht gekleidet, o barmherzigster Christus, unser Gott.“ Der Herr ist unser Licht. Aber nach welcher Kleidung fragen wir? Dass alle unsere Gefühle, Gedanken, Absichten, Handlungen – alles im Licht der Wahrheit und Liebe geboren werden würde, alles würde erneuert werden, wie unser Taufgewand. Danach legt der Priester dem Neugetauften ein Brustkreuz zum ständigen Tragen um den Hals – als Erinnerung an die Worte Christi: „Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme das Seine an.“ Kreuzt und folgt mir nach“ (Matthäus 16,24).
Unmittelbar danach wird das Sakrament der Salbung gespendet. So wie das Leben auf die Geburt folgt, so folgt die Taufe, das Sakrament der Neugeburt, auf die Konfirmation, das Sakrament des neuen Lebens. Der Priester salbt die getaufte Person mit heiligem Öl und macht an verschiedenen Stellen des Körpers das Kreuzzeichen mit den Worten „Siegel (d. h. Zeichen) der Gabe des Heiligen Geistes“. Zu dieser Zeit werden dem Getauften unsichtbar die Gaben des Heiligen Geistes geschenkt, mit deren Hilfe er im geistlichen Leben wächst und sich stärkt. Die Stirn oder Stirn wird mit Myrrhe gesalbt, um den Geist zu heiligen; Augen, Nasenlöcher, Lippen, Ohren – um die Sinne zu heiligen; Brust – um das Herz zu heiligen; Hände und Füße – zur Heiligung der Taten und allen Verhaltens. Danach folgen die Neugetauften und ihre Nachfolger mit brennenden Kerzen in der Hand dem Priester dreimal im Kreis um das Taufbecken und das Rednerpult (Ein Rednerpult ist ein geneigter Tisch, auf dem normalerweise das Evangelium, das Kreuz oder die Ikone platziert wird). auf dem das Kreuz und das Evangelium liegen. Das Bild eines Kreises ist ein Bild der Ewigkeit, denn ein Kreis hat weder Anfang noch Ende. Zu dieser Zeit wird der Vers gesungen: „Wer in Christus getauft wurde, zieht Christus an“, was bedeutet: „Wer in Christus getauft wurde, zieht Christus an.“
2.2 Sakrament der Firmung
So wie das Leben auf die Geburt folgt, so folgt die Taufe, das Sakrament der Neugeburt, auf die Konfirmation, das Sakrament des neuen Lebens. In diesem Sakrament erhält der Neugetaufte die Gabe des Heiligen Geistes. Ihm wird „Kraft von oben“ für ein neues Leben gegeben. Das Sakrament wird durch die Salbung mit der Heiligen Myrrhe gespendet.
Die Heilige Myrrhe wurde von den Aposteln Christi und dann von den Bischöfen der alten Kirche vorbereitet und geweiht. Von ihnen empfingen die Priester Myrrhe, als sie das Sakrament des Heiligen Geistes vollzogen, das seitdem Firmung genannt wird.
Der Heilige Chrisam wird alle paar Jahre zubereitet und geweiht. Der traditionelle Ort für die Zubereitung des Heiligen Chrisams in der russischen Kirche vom 15. bis 18. Jahrhundert waren die Metropolitan- und dann die Patriarchalkammern des Moskauer Kremls. Miro wurde in der Mariä Himmelfahrt-Kathedrale des Kremls geweiht. Nach der Abschaffung des Patriarchats unter Peter I. wurde neben dem Kreml die Kiewer Höhlenkloster zum zweiten Ort der Weltweihe. Mit der Wiederherstellung des Patriarchats in der russischen Kirche im Jahr 1917 war (und ist bis heute) der Ort der Zubereitung der Heiligen Myrrhe die Kleine Kathedrale des Donskoi-Klosters der Hauptstadt, wo zu diesem Zweck ein spezieller Ofen gebaut wurde. Und die Weihe der Welt begann in der Patriarchalischen Dreikönigskathedrale in Jelochow.
Bei der Firmung bringt der Priester das Kreuzzeichen auf Stirn, Augenlider, Nasenlöcher, Lippen und Ohren, Hände und Fußrücken an und spricht jedes Mal die Worte aus: „Siegel der Gabe des Heiligen Geistes.“ Amen".
Danach folgen die Neugetauften und ihre Nachfolger mit brennenden Kerzen in der Hand dem Priester dreimal im Kreis um das Taufbecken und das Rednerpult (Ein Rednerpult ist ein geneigter Tisch, auf dem normalerweise das Evangelium, das Kreuz oder die Ikone platziert wird). auf dem das Kreuz und das Evangelium liegen. Das Bild eines Kreises ist ein Bild der Ewigkeit, denn ein Kreis hat weder Anfang noch Ende. Zu dieser Zeit wird der Vers gesungen: „Wer in Christus getauft wurde, zieht Christus an“, was bedeutet: „Wer in Christus getauft wurde, zieht Christus an.“ Dies ist ein Aufruf, die Frohe Botschaft von Christus überall und überall zu verbreiten und Ihn in Worten, Taten und mit Ihrem ganzen Leben zu bezeugen.
2.3 Sakrament der Reue
Es gibt keinen Menschen, der auf der Erde leben und nicht sündigen würde. Wir sündigen gegen Gott, gegen unseren Nächsten und gegen uns selbst. Wir sündigen in Taten, Worten und sogar Gedanken. Wir sündigen auf Anstiftung des Teufels, unter dem Einfluss der Welt um uns herum und gemäß unserem eigenen bösen Willen.
Was soll jemand tun, der von seinem Gewissen gequält wird? Was tun, wenn die Seele schmachtet? Die orthodoxe Kirche antwortet: Bringt Reue. Die Buße ist ein Sakrament, in dem jemand, der seine Sünden aufrichtig bekennt, von Gott selbst Vergebung sowie Gnade und Kraft erhält, nicht noch einmal zu sündigen.
Um Vergebung (Auflösung) der Sünden zu erhalten, ist vom Reumütigen Folgendes erforderlich: Versöhnung mit allen seinen Nächsten, aufrichtige Reue für die Sünden und deren mündliches Bekenntnis, die feste Absicht, sein Leben zu korrigieren, Glaube an den Herrn Jesus Christus und Hoffnung auf seine Barmherzigkeit. Allerdings ist es schwierig, die eigene Schuld zu erkennen, und noch schwieriger ist es, sie vor einem Zeugen laut, offen und aufrichtig zuzugeben. Hier ist echter Mut gefragt, für den man weder einen Orden noch eine Medaille erhält. Es ist notwendig, sich im Voraus auf die Beichte vorzubereiten. Am besten lesen Sie die Gebote noch einmal und erinnern Sie sich so an Ihre Sünden gegen sie (und schreiben Sie sie auf). Wir müssen uns daran erinnern, dass vergessene, nicht bekannte Sünden auf der Seele lasten und schlechte Laune und psychische Erkrankungen verursachen. Die Sünde zerstört einen Menschen nach und nach und hindert ihn daran, geistig zu wachsen. Je gründlicher das Bekenntnis und die Gewissensprüfung, desto mehr wird die Seele von Sünden gereinigt, desto näher ist sie dem Himmelreich.
Die Beichte in der orthodoxen Kirche wird am Rednerpult abgelegt – einem hohen Tisch mit geneigter Tischplatte, auf dem das Kreuz und das Evangelium als Zeichen der Gegenwart Christi liegen, unsichtbar, aber alles hörend und wissend, wie tief unsere Reue ist und ob wir haben etwas aus falscher Scham oder absichtlich verheimlicht. Wenn der Priester aufrichtige Reue sieht, bedeckt er den gesenkten Kopf des Beichtvaters mit dem Ende der Stola und liest ein Erlaubnisgebet, in dem er im Namen Jesu Christi Sünden vergibt. Dann küsst der Beichtvater das Kreuz und das Evangelium als Zeichen der Dankbarkeit und Treue zu Christus.
Der Priester erwartet von denen, die zur Beichte kommen, ein Bewusstsein für seine Sünde und Reue: Er muss diese Sünde benennen, ohne nach einer Entschuldigung dafür zu suchen. Einzelheiten der Straftat werden bei einem Geständnis selten benötigt. Ihre Klärung ist nur manchmal notwendig, um dem Beichtvater zu helfen, die Wurzeln seiner spirituellen Krankheit zu erkennen und die Bedeutung und Konsequenzen seiner Taten besser zu verstehen.
Unter keinen Umständen sollten Sie bei der Beichte jemanden verurteilen oder über die Sünden anderer sprechen. Ein Versuch, bei der Beichte zu lügen, eine Sünde zu verheimlichen, eine Entschuldigung dafür zu finden oder damit zu rechnen, eine Sünde ungestraft zu wiederholen (im Sinne der weltlichen Weisheit „Wer nicht sündigt, wird nicht bereuen“). ) lässt einen Menschen ohne die im Sakrament geschenkte Gnade zurück. Die Kirchenväter warnten davor, dass der Herr in solchen Fällen in dem Moment, in dem der Priester ein Erlaubnisgebet spricht, sagt: „Aber ich verurteile.“
In einigen Fällen verschreibt der Priester dem Büßer eine Buße („Verbot“) – eine Art spirituelle Medizin, die darauf abzielt, das Laster auszurotten. Dies können Verbeugungen, Kanon- oder Akathistenlesen, intensives Fasten, Pilgerfahrt zu einem heiligen Ort sein – je nach Stärke und Fähigkeiten des Büßers. Die Buße muss streng durchgeführt werden und nur der Priester, der sie verhängt hat, kann sie aufheben.
2.4 Sakrament der Kommunion
Das Leben braucht Nahrung, um sich zu erhalten. Der Herr gewährt diese Nahrung im Sakrament der Kommunion oder auf Griechisch der Eucharistie, was „Danksagung“ bedeutet. In der Kommunion essen wir unter dem Deckmantel von Brot und Wein den Leib und das Blut des Herrn Jesus Christus selbst, und so wird Gott ein Teil von uns, und wir werden ein Teil von Ihm, eins mit Ihm, näher als unsere engsten Menschen und durch Ihn – ein Leib und eine Familie mit allen Mitgliedern der Kirche, jetzt unseren Brüdern und Schwestern.
Die Familie bereitet sich im Voraus auf die Kommunion der Heiligen Mysterien Christi vor. Zu dieser Vorbereitung gehören intensives Gebet, Gottesdienstbesuch, Fasten, gute Taten, Versöhnung mit allen und anschließende Beichte, also die Reinigung des Gewissens im Sakrament der Buße.
Das Sakrament der Heiligen Kommunion wurde von unserem Herrn Jesus Christus selbst beim letzten Abendmahl, am Vorabend seines Leidens und Sterbens, gestiftet. Er selbst vollzog dieses Sakrament: „Er nahm das Brot und dankte (Gott, dem Vater, für all seine Barmherzigkeit gegenüber der Menschheit), brach es und gab es den Jüngern mit den Worten: Nimm, iss: Das ist mein Leib, der hingegeben ist.“ Du. Er nahm auch den Kelch, dankte ihnen und reichte ihn ihnen mit den Worten: Trinket daraus, ihr alle! denn dies ist Mein Blut des Neuen Testaments, das für euch und für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis“ (Matthäus 26,26-28; Markus 14,22-24; Lukas 22,19-24; 1. Korinther 11,23-25).
Was die Kommunion im Zusammenhang mit dem christlichen Gottesdienst betrifft, ist zu beachten, dass dieses Sakrament den wichtigsten und wesentlichen Teil des christlichen Gottesdienstes darstellt. Nach dem Gebot Christi wird dieses Sakrament in der Kirche Christi ständig gespendet und wird bis zum Ende des Jahrhunderts während eines Gottesdienstes namens Liturgie gespendet, bei dem Brot und Wein durch die Kraft und Wirkung des Heiligen Geistes gespendet werden , werden in den wahren Leib und das wahre Blut Christi verwandelt oder transsubstantiiert.
Das Sakrament der Kommunion wird täglich, außer an einigen Tagen der Fastenzeit, gespendet, so dass immer die Möglichkeit besteht, die Kommunion zu empfangen. Die Meinungen darüber, wie oft man die Kommunion empfangen sollte, haben sich im Laufe der Zeit geändert. Die ersten Christen empfingen fast täglich die Kommunion, und wer ohne besonderen Grund drei Sonntagsgottesdienste versäumte, galt als aus der Kirche ausgetreten. Später begannen sie seltener, die Kommunion zu empfangen. Vor der Revolution in Russland galt es als die Norm, in jeder Fastenzeit (Groß-, Petrowski-, Mariä Himmelfahrt- und Weihnachtsfastenzeit) und an Ihrem Namenstag die Kommunion zu empfangen. Heutzutage wird die Praxis der häufigen Kommunion, mindestens einmal im Monat, immer weiter verbreitet.
Bilder orthodoxer heiliger Riten reichen bis tief ins Alte Testament zurück. Gott ersetzte Isaak durch ein Lamm; die Juden sollten das Lamm für das Passahfest vorbereiten und sich an den rettenden Auszug aus Ägypten erinnern. Die alttestamentliche Prophezeiung Jesajas spricht von einem Unschuldigen, der wie ein Lamm demütig zur Schlachtbank geht. Diese Worte werden in der orthodoxen Liturgie wiederholt. Als Lamm bezeichnet man das zur Kommunion zubereitete Brot.
Das Evangelium füllte alttestamentliche Bilder mit neuer Bedeutung. Der Soldat schlug Christus am Kreuz mit einem Speer, um seinen Tod zu bestätigen, und Wasser und Blut strömten aus der Wunde. Deshalb wird Wein mit Wasser, das eine Lebensbedingung ist, vermischt und in das Blut Christi umgewandelt. Eine Kopie ist ein Gegenstand, mit dem der Geistliche Partikel aus der Prosphora, dem Brot für die Kommunion, entfernt. Diese und viele andere Bilder aus dem Alten und Neuen Testament bilden ein einziges Gefüge der Anbetung. Darin sind die Erfahrungen der Gläubigen eingewoben, die das Geschehen mit der gesamten Heiligen Geschichte der Menschheit verbinden. Der Leib und das Blut Christi sind „geistliche Nahrung“, ein Feuer, das das Böse verbrennt, aber auch in der Lage ist, diejenigen zu „verbrennen“, die die Kommunion „unwürdig“ empfangen, das heißt unaufrichtig, ohne Ehrfurcht, ohne sich durch Fasten und Gebet auf die Kommunion vorzubereiten , weil sie Sünden auf ihrem Gewissen verborgen hatten. Anstatt „Seele und Körper zu heilen“, bereiten solche Menschen laut Kirche eine Strafe für sich selbst vor. „Er hat die Kommunion zur Verurteilung gebracht“, heißt es über solche Fälle in der Kirche.
Nach den erforderlichen heiligen Riten, den Gebeten des Priesters, der das Sakrament spendet, und der gesamten Kirche begeben sich die Kommunikanten zu den Stufen des Altars. Die Kinder werden weitergegeben und empfangen zuerst die Kommunion. Kinder in der orthodoxen Kirche empfangen unmittelbar nach der Taufe die Kommunion. Die Jüngsten, die noch keine feste Nahrung zu sich nehmen können, nehmen am Blut Christi teil. Nach dem Ausruf des Diakons: „Komm mit Gottesfurcht und Glauben!“ - Die Kommunikanten nähern sich abwechselnd dem Kelch, indem sie ihre Arme kreuzweise auf der Brust verschränken. Der Priester nimmt mit einem speziellen Löffel mit langem Stiel (Lügner) einen Teil der Heiligen Gaben aus dem Kelch und steckt ihn in den Mund des Kommunikanten. Nachdem sie das Teilchen angenommen haben, küssen die Kommunikanten den Boden des Kelchs und gehen zum Tisch, wo die Geistlichen sie dazu auffordern, die Kommunion mit einem geweihten warmen Getränk – Wein und Wasser – abzuspülen und ein Stück geweihtes Brot zu essen. Am Ende des Gottesdienstes hören die Kommunionempfänger ein Dankgebet und eine Predigt des Priesters. Am Tag der Kommunion versuchen orthodoxe Gläubige, sich besonders anständig zu verhalten und sich an sein Opfer und ihre Pflicht gegenüber Gott und den Menschen zu erinnern.
2.5 Hochzeit
Die Hochzeit oder Heirat ist ein Sakrament, in dem mit dem kostenlosen (vor dem Priester und der Kirche) Versprechen von Braut und Bräutigam der gegenseitigen Treue zueinander ihre eheliche Vereinigung gesegnet wird, nach dem Bild der geistlichen Vereinigung Christi mit dem Kirche, und die Gnade Gottes wird für gegenseitige Hilfe und Einmütigkeit sowie für die selige Geburt und christliche Erziehung der Kinder erbeten und gegeben. Die Ehe wurde von Gott selbst im Himmel gegründet. Nach der Erschaffung von Adam und Eva „segnete Gott sie, und Gott sprach zu ihnen: Sei fruchtbar und mehre dich, und fülle die Erde und unterwerfe sie“ (1. Mose 1,28).
Jedes Sakrament ist eine Erneuerung eines Menschen, als wäre er neu geboren. Und im Sakrament der Hochzeit wird auch ein Mensch wiedergeboren, aber nicht allein, sondern in einer Familie. Schließlich werden in einer christlichen Ehe zwei Menschen in Christus eine Seele und ein Fleisch. Zunächst wird die Verlobungszeremonie von Braut und Bräutigam durchgeführt, bei der der Priester unter Gebeten ihre Eheringe anlegt (im Wort „Verlobung“ sind die Wurzeln der Wörter „Reifen“ leicht zu erkennen , ein Ring und „Hand“). Ein Ring, der weder Anfang noch Ende hat, ist ein Zeichen der Unendlichkeit, ein Zeichen der Vereinigung in grenzenloser, selbstloser Liebe. Dann legt der Priester, nachdem er die Hände des Brautpaares gefaltet hat, sie vor das Rednerpult mit dem Kreuz und dem Evangelium, das heißt – vor das Angesicht des Herrn, in seiner Gegenwart. Gleichzeitig stehen Braut und Bräutigam auf einem neuen weißen Handtuch. Dies ist ein Symbol für den Beginn eines neuen gemeinsamen Lebensweges, jedoch nicht mehr getrennt, sondern gemeinsam.
Es folgen Gebete nacheinander mit der Bitte um Gottes Segen für die Heiratswilligen. Sie erinnern an die Vereinigungen von Adam und Eva, die Vorfahren Abraham und Sarah, Isaak und Rebekka, Jakob und Rahel, die Eltern der Jungfrau Maria – Joachim und Anna, die Eltern von Johannes dem Täufer – Sacharja und Elisabeth als Beispiele für Frischvermählte.
Im Namen der Kirche bittet der Priester Gott um eine neue Vereinigung der Stärke, Weisheit und des Mutes in Prüfungen, um gegenseitiges Verständnis, ein friedliches Leben und um gesunde Kinder, die dem Willen Gottes gehorchen. Der Priester nimmt die Kronen und setzt sie auf – eine auf dem Kopf des Bräutigams, die andere auf dem Kopf der Braut – und sagt dabei: „Der Diener Gottes (Name des Bräutigams) ist mit dem Diener Gottes (Name des Bräutigams) verheiratet die Braut) im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen". Und – „Der Diener Gottes (Name der Braut) wird im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes mit dem Diener Gottes (Name des Bräutigams) verheiratet. Amen". Danach segnet der Priester das Brautpaar und ruft dreimal aus: „Herr, unser Gott, kröne sie mit Herrlichkeit und Ehre.“ „Krone“ bedeutet: „vereine sie zu einem Fleisch“, d Krankheiten und Trauer.
Es folgt eine Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser und aus dem Johannesevangelium. Der Apostel Paulus fordert den Ehemann auf, seine Frau zu lieben, wie Christus die Kirche tut, ohne sein Leben zu schonen, und die Frau, ihren Ehemann zu lieben, zu ehren und ihm zu gehorchen, wie die Kirche Christus tut. Der Abschnitt aus dem Evangelium erzählt von einer Hochzeit in Kana in Galiläa, bei der der Herr sein erstes Wunder vollbrachte und gewöhnliches Wasser in guten Wein verwandelte. Für das Brautpaar, das bereits Ehemann und Ehefrau geworden ist, hat dies eine erhebliche Bedeutung. Jetzt müssen sie in ihrem gemeinsamen Leben ihre noch nicht starken Gefühle (wie frisches Wasser) in echte Liebe (wie guten Wein) umwandeln. Und alle Anwesenden wünschen zusammen mit dem Priester dem Brautpaar lange und glückliche Ehejahre.
2.6 Priestertum
Das Priestertum ist ein Sakrament, in dem eine ordnungsgemäß ausgewählte Person die Gnade des Heiligen Geistes für den heiligen Dienst der Kirche Christi empfängt. Die Priesterweihe wird Ordination oder Weihe genannt. In der orthodoxen Kirche gibt es drei Priestertumsgrade: den niedrigsten - Diakon, dann - Presbyter (Priester, Priester) und Bischof (Bischof).
Wer zum Diakon geweiht wird, erhält die Gnade, bei der Ausübung der Sakramente zu dienen (zu helfen). Wer zum Bischof (Bischof) geweiht wird, erhält nicht nur die Gnade, die Sakramente zu spenden, sondern auch andere zur Spendung der Sakramente zu weihen.
Die Weihe eines Priesters und eines Diakons kann nur durch einen Bischof vorgenommen werden. Dieses Sakrament wird während der Liturgie gespendet. Der Schützling (d. h. derjenige, der den Rang erhält) wird dreimal um den Thron herumgeführt, dann der Bischof, wobei er seine Hände und das Omophorion auf seinen Kopf legt (Omophorion ist ein Zeichen des bischöflichen Ranges in Form eines breiten Stoffstreifens). Auf den Schultern), was das Auflegen der Hände Christi bedeutet, wird ein besonderes Gebet gelesen. In der unsichtbaren Gegenwart des Herrn betet der Bischof für die Wahl dieser Person zum Priester, zum Assistenten des Bischofs.
Der Bischof überreicht dem Ordinierten die für seinen Dienst notwendigen Gegenstände und ruft aus: „Axios!“ (griechisch „würdig“), worauf der Chor und das ganze Volk mit dreimaligem „Axios!“ antworten. Damit bezeugt die Kirchenversammlung ihre Zustimmung zur Weihe ihres würdigen Mitglieds. Von nun an übernimmt der Geweihte, nachdem er Priester geworden ist, die Verantwortung, Gott und den Menschen zu dienen, wie es der Herr Jesus Christus selbst und seine Apostel getan haben in seinem irdischen Leben. Er predigt das Evangelium und vollzieht die Sakramente der Taufe und der Firmung, vergibt im Namen des Herrn die Sünden reuiger Sünder, feiert die Eucharistie und die Kommunion und vollzieht auch die Sakramente der Ehe und der Salbung. Schließlich setzt der Herr durch die Sakramente seinen Dienst in unserer Welt fort und führt uns zum ewigen Leben im Reich Gottes.
2.7 Segen der Salbung (Salbung)
Das Sakrament der Salbung oder Ölweihe, wie es in liturgischen Büchern genannt wird, ist ein Sakrament, bei dem bei der Salbung eines Kranken mit geweihtem Öl (Olivenöl) die Gnade Gottes an den Kranken gerufen wird, ihn zu heilen von körperlichen und seelischen Erkrankungen. Sie wird Salbung genannt, weil mehrere (sieben) Priester zusammenkommen, um sie durchzuführen, obwohl ein Priester sie bei Bedarf durchführen kann.
Das Sakrament der Ölweihe geht auf die Apostel zurück, die, nachdem sie von Jesus Christus „die Kraft zur Heilung von Krankheiten“ erhalten hatten, „viele Kranke mit Öl salbten und sie heilten“ (Markus 6,13). Das Wesen dieses Sakraments wird am deutlichsten vom Apostel Jakobus in seinem Konzilsbrief offenbart: „Ist einer von euch krank, so rufe er die Ältesten der Kirche und sie beten für ihn und salben ihn mit Öl im Namen der Kirche.“ Herr. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken heilen, und der Herr wird ihn auferwecken; und wenn er Sünden begangen hat, werden sie ihm vergeben“ (Jakobus 5,14-15).
Wie erfolgt die Salbung? In der Mitte des Tempels steht ein Rednerpult mit dem Evangelium. In der Nähe steht ein Tisch, auf dem ein Gefäß mit Öl auf einer Schüssel mit Weizen steht. Sieben brennende Kerzen und sieben Salbpinsel werden in den Weizen gelegt – entsprechend der Anzahl der gelesenen Passagen aus der Heiligen Schrift.
Die ganze Gemeinde hält brennende Kerzen in ihren Händen. Dies ist unser Zeugnis, dass Christus das Licht unseres Lebens ist. Mit dem Ausruf „Gesegnet sei unser Gott jetzt und in Ewigkeit und in alle Ewigkeit“ beginnt das Gebet und nennt die Namen der Versammelten. Dann gießt der Priester Wein mit Öl in das Gefäß und betet um die Weihe des Öls, um das Fleisch und den Geist derjenigen zu heilen und zu reinigen, die damit gesalbt werden sollen. Wein wird in Öl gegossen zum Gedenken an den barmherzigen Samariter, von dem der Herr in seinem Gleichnis sprach: Wie ein gewisser Samariter Mitleid mit einem Mann hatte, der von Räubern geschlagen und ausgeraubt wurde, und „seine Wunden verband und Öl und Wein übergoss“ (Lukas). 10:34).
Es gibt Gesänge, das sind Gebete an den Herrn und die Heiligen, die für ihre wundersamen Heilungen berühmt wurden. Anschließend werden sieben Passagen aus den Apostelbriefen und den Evangelien vorgelesen. Nach jeder Lesung des Evangeliums salben die Priester Stirn, Nasenlöcher, Wangen, Lippen, Brust und Hände auf beiden Seiten mit geweihtem Öl. Dies geschieht als Zeichen der Reinigung aller unserer fünf Sinne, Gedanken, Herzen und der Werke unserer Hände – von allem, womit wir hätten sündigen können.
Bei jeder Salbung wird das Gebet gelesen: „Heiliger Vater, Arzt der Seelen und Körper ...“ Darauf folgt eine betende Anrufung der Allerheiligsten Theotokos, des lebensspendenden Kreuzes, Johannes des Täufers, der Apostel und aller Heilige.
Die Segnung der Gemeinde endet mit der Auflegung des Evangeliums auf ihre Häupter. Und der Priester betet für sie.
Neben der Heilung von Krankheiten gewährt uns die Weihe des Öls auch die Vergebung vergessener Sünden (aber nicht bewusst versteckter). Aufgrund der Gedächtnisschwäche kann ein Mensch nicht alle seine Sünden bekennen, daher ist es nicht der Rede wert, wie groß der Wert der Salbung ist. Durch die Vergebung der Sünden kommt es zur Reinigung und oft auch zur Heilung oder zum geduldigen Ertragen von Krankheiten um des Herrn willen.
Bei Säuglingen wird keine Salbung durchgeführt, da ein Säugling nicht bewusst Sünden begehen kann. Körperlich gesunde Menschen können ohne den Segen eines Priesters nicht auf dieses Sakrament zurückgreifen.
Darsteller der Sakramente. Schon aus der Definition des Sakraments geht hervor, dass die „unsichtbare Gnade Gottes“ nur vom Herrn gegeben werden kann. Wenn man also über alle Sakramente spricht, muss man erkennen, dass ihr Vollstrecker Gott ist. Aber die Mitarbeiter des Herrn, die Menschen, denen Er selbst das Recht gegeben hat, die Sakramente zu spenden, sind die ordnungsgemäß ernannten Bischöfe und Priester der Orthodoxen Kirche. Die Grundlage dafür finden wir im Brief des Apostels Paulus: „Darum soll uns jeder als Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes verstehen“ (1. Kor. 4; 1).
Eine notwendige Voraussetzung für die Ausübung und Wirksamkeit des Sakraments ist das Vorhandensein von:
) die objektive Seite des Sakraments, die in der Ausübung durch einen ordnungsgemäß ernannten Geistlichen unter Beachtung einer bestimmten äußeren Form und verbalen Formel des Sakraments besteht. Wenn die objektive Seite beachtet wird, ist das vollendete Sakrament gültig;
) die subjektive Seite des Sakraments, die in der inneren Stimmung und Stimmung der Person liegt, die es in Anspruch nimmt. Für eine Person, die festen Glauben und Ehrfurcht hat, wird das vollendete Sakrament wirksam sein. Der demütig eingestandene Mangel an Glaubensfestigkeit ist jedoch bei weitem nicht dasselbe wie hartnäckiger Unglaube. Denn im Großen und Ganzen kann nur ein solcher Unglaube als Mediastinum zwischen Gott und den Menschen dienen.
Das Vorliegen von Verdiensten oder Verdiensten der Personen, die die Sakramente spenden und empfangen, ist keine Bedingung für die Gültigkeit des Sakraments. Ein sündiger Mensch muss sich der großen Bedeutung und Wichtigkeit des Sakraments bewusst sein und den aufrichtigen Wunsch und die Bereitschaft haben, es anzunehmen. Ohne eine solche innere Einstellung wird die Berufung einer Person auf das Sakrament nur dazu dienen, sie zu verurteilen (siehe: 1 Kor. 11; 26-30).
Korrekt gespendete und empfangene Sakramente verleihen der gesamten psychophysischen Natur eines Menschen Gnade und haben einen tiefgreifenden Einfluss auf sein inneres, spirituelles Leben.
Abschluss
Lassen Sie uns daher zum Abschluss der Arbeit noch kurz Folgendes anmerken.
Orthodoxe Sakramente sind heilige Riten, die in orthodoxen Kirchenriten offenbart werden und durch die den Gläubigen die unsichtbare göttliche Gnade oder die rettende Kraft Gottes mitgeteilt wird.
Taufe, Buße und Eucharistie wurden von Jesus Christus selbst eingeführt, wie im Neuen Testament berichtet. Die kirchliche Tradition bezeugt den göttlichen Ursprung anderer Sakramente. Jesus Christus: „Geht nun hin und macht alle Völker zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe“ (Matthäus 28,19-20). Mit diesen Worten hat uns der Herr deutlich gezeigt, dass er neben dem Sakrament der Taufe auch andere Sakramente eingesetzt hat.
Es gibt sieben Sakramente: das Sakrament der Taufe, der Firmung, der Buße, der Kommunion, der Ehe, des Priestertums und der Salbung.
Die Sakramente sind sichtbare Zeichen, durch die die Gnade des Heiligen Geistes, die rettende Kraft Gottes, unsichtbar auf den Menschen herabkommt. Alle Sakramente stehen in engem Zusammenhang mit dem Sakrament der Kommunion.
Taufe und Firmung führen uns in die Kirche ein: Wir werden Christen und können beginnen, die Kommunion zu empfangen. Im Sakrament der Buße werden unsere Sünden vergeben.
Durch den Empfang der Kommunion vereinen wir uns mit Christus und werden Teilnehmer am ewigen Leben.
Das Sakrament des Priestertums ermöglicht die Spendung aller Sakramente. Im Sakrament der Ehe wird ein Segen für das eheliche Familienleben gelehrt.
Im Sakrament der Salbung betet die Kirche um Vergebung der Sünden und die Wiederherstellung der Gesundheit der Kranken.
Die Sakramente bilden die Kirche. Erst in den Sakramenten überschreitet die christliche Gemeinschaft rein menschliche Maßstäbe und wird zur Kirche.
Literaturverzeichnis
Vasechko V.N. Vergleichende Theologie (Vorlesungsreihe) / V.N. Vasechko. - M.: Orthodoxe St. Tikhon's Humanitarian University, 2006. - 102 S.
Lortz J. Geschichte der Kirche. Christliches Russland. In 2 Bänden / J. Lortz. - M.: Neue Zeit, 2000. - 511 S.; 579 S.
Malkov P.Yu. Einführung in die liturgische Tradition. Sakramente der Orthodoxen Kirche (Vorlesungsverlauf) / P.Yu. Malkow; Ed. Erzpriester V. Worobjow. - M.: Orthodoxe St. Tikhon's Humanitarian University, 2008. - 322 S.
Ein Handbuch für Geistliche. Pochaev Lavra der Heiligen Mariä Himmelfahrt. Band 4. - M.: Orthodoxe St. Tikhon's Humanitarian University, 2008. - 862 S.
Ponomarev V. Handbuch einer orthodoxen Person. Sakramente der Orthodoxen Kirche. Teil 2. / V. Ponomarev. - M.: Orthodoxe St. Tikhon's Humanitarian University, 2008. - 182 S.
Tabak Yu. Orthodoxie und Katholizismus. Die wichtigsten dogmatischen und rituellen Unterschiede / Yu. Tabak. - M.: Treffen, 2002. - 73 S.
Ein Sakrament ist ein heiliger Akt, durch den die Gnade Gottes auf eine Person wirkt. Die Sakramente wurden von Christus oder seinen Aposteln gestiftet und sollen das Innenleben eines Menschen verändern.
1 Taufe
Das Wesen des Sakraments: Der Kirche beitreten, in Christus geboren werden.
Hauptritual: Dreimaliges Eintauchen in Wasser mit den ausgesprochenen Worten: „Der Diener Gottes (Name) wird auf den Namen des Vaters getauft.“ Amen. Und der Sohn. Amen.
Und der Heilige Geist. Amen".
2 Bestätigung
Das Wesen des Sakraments: Heiligung des ganzen Menschen, indem ihm die Gnade des Heiligen Geistes verliehen wird.
Hauptritual: Kreuzförmige Salbung der Stirn, Augen, Nasenlöcher, Ohren, Brust, Hände und Füße des Neugetauften durch den Priester mit dem geweihten Chrisam mit den Worten „Siegel der Gabe des Heiligen Geistes“. Amen".
3. Kommunion
Das Wesen des Sakraments: Die Vereinigung des Gläubigen mit Christus.
Hauptritual: Bei der Liturgie im Sakrament der Eucharistie werden Brot und Wein in den wahren Leib und das Blut Christi verwandelt (transsubstantiiert), das die Gläubigen essen. Der zentrale Punkt der Liturgie ist das Rezitieren des Anaphora-Gebets mit der Segnung von Brot und Wein. Aus diesem Gebet hören die Gläubigen im Tempel nur die Worte, die Christus bei der Eröffnung der Eucharistie beim Letzten Abendmahl gesprochen hat: „Nimm, iss, das ist mein Leib, gebrochen für dich zur Vergebung der Sünden!“ Amen. Trinken Sie alle daraus, dies ist Mein Blut des Neuen Testaments, das für Sie und für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird! Amen“ (siehe Matthäus 26:26-28).
4 Segen der Salbung
Das Wesen des Sakraments: Heilung geistiger und körperlicher Leiden durch die Gnade Gottes.
Hauptritual: Lesung von sieben Passagen aus den Apostolischen Briefen und dem Evangelium. Nach jeder Lesung spricht der Priester ein Gebet für den Kranken und salbt seine Stirn, Wangen, Brust und Hände mit geweihtem Öl. Am Ende der letzten Lesung legt der Priester das geöffnete Evangelium auf das Haupt des unkanthisierten Menschen und betet um Vergebung seiner Sünden.
5 Reue
Das Wesen des Sakraments: Bekennen Sie Ihre Sünden vor Gott und empfangen Sie Vergebung.
Hauptritual: Nachdem der Priester, der bei der Feier des Sakraments anwesend ist und Zeuge der Reue ist, seine Sünden offen vor Gott bekannt hat, spricht er zwei Gebete. Der erste enthält die Worte „Versöhne und vereinige ihn mit Deiner Heiligen Kirche.“ Die zweite wird „permissiv“ genannt: „Möge unser Herr und Gott, Jesus Christus, durch die Gnade und Großzügigkeit seiner Liebe zur Menschheit Ihrem Kind (Namen) alle Ihre Sünden vergeben, und ich, ein unwürdiger Priester, vergebe Ihnen durch die.“ Vollmacht, die mir gegeben wurde, und befreie dich von all deinen Sünden im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen".
6 Priestertum
Das Wesen des Sakraments: Durch die Handauflegung des Bischofs wird dem Gläubigen die Gnade gegeben, die Sakramente zu spenden.
Hauptritual: Die Ordination findet während der Liturgie statt. Der Rang und die Reihenfolge der Ernennung zu verschiedenen Priestertumsgraden (Diakon, Priester, Bischof) sind unterschiedlich. Am Ende des Ritus wird der Schützling in Gewänder gekleidet, die seinem neuen Rang entsprechen, während der Bischof (oder Bischofsrat), der das Sakrament spendet, „Axios!“ verkündet.
(Griechisch – „würdig“), worauf die Priester und der Chor mit dreimal „Axios!“ antworten. - „würdig!“
7 Ehe
Das Wesen des Sakraments: Der Segen der Ehe als gemeinsamer Weg zu Gott.
Hauptritual: Während des Sakramentes der Hochzeit setzt der Priester der Braut und dem Bräutigam Kronen auf und spricht dreimal die Bitte: „Herr, unser Gott, kröne (sie) mit Herrlichkeit und Ehre.“
Der Inhalt des Artikels
Orthodoxe Sakramente, heilige Riten, die durch die göttliche Vorsehung geschaffen wurden und in orthodoxen Kirchenriten offenbart werden, durch die den Gläubigen unsichtbare göttliche Gnade mitgeteilt wird. In der Orthodoxie gibt es sieben Sakramente, die sieben Gaben des Heiligen Geistes: Taufe, Firmung, Eucharistie (Komunion), Buße, das Sakrament des Priestertums, das Sakrament der Ehe und die Ölweihe. Taufe, Buße und Eucharistie wurden von Jesus Christus selbst eingeführt, wie im Neuen Testament berichtet. Die kirchliche Tradition bezeugt den göttlichen Ursprung anderer Sakramente.
Sakramente und Rituale.
Äußere Zeichen der Sakramente, d.h. Für den Menschen sind kirchliche Rituale notwendig, da die unvollkommene Natur des Menschen sichtbare symbolische Handlungen braucht, die helfen, das Wirken der unsichtbaren Kraft Gottes zu spüren. Neben den Sakramenten akzeptiert die orthodoxe Kirche auch andere liturgische Riten, die im Gegensatz zu den Sakramenten nicht göttlichen, sondern kirchlichen Ursprungs sind. Die Sakramente verleihen der gesamten psychophysischen Natur des Menschen Gnade und haben einen tiefgreifenden Einfluss auf sein inneres, spirituelles Leben. Rituale rufen Segen nur auf der äußeren Seite des irdischen menschlichen Lebens hervor ( cm. Sakramentalien). Die Feier jedes Sakraments bringt ein besonderes Geschenk der Gnade mit sich. In der Taufe wird die Gnade geschenkt, die von der Sünde reinigt; zur Bestätigung - Gnade, die einen Menschen im spirituellen Leben stärkt; Der Segen des Öls ist eine Gabe, die Krankheiten heilt; in der Buße wird die Vergebung der Sünden gewährt.
Die Wirksamkeit der Sakramente.
Nach der Lehre der orthodoxen Kirche erlangen die Sakramente erst dann wirksame Kraft, wenn zwei Bedingungen kombiniert werden. Es ist notwendig, dass sie von einer legitimen, hierarchisch ernannten Person korrekt ausgeführt werden und dass die innere Stimmung und Veranlagung eines Christen zur Annahme der Gnade vorhanden ist. Fehlt der Glaube und der aufrichtige Wunsch, das Sakrament anzunehmen, dient seine Ausübung der Verurteilung. Zur katholischen und protestantischen Sakramentelehre cm. GEHEIMNIS.
Sieben Sakramente der Orthodoxen Kirche
sollen die sieben wichtigsten Bedürfnisse des spirituellen Lebens eines Menschen erfüllen. Die Sakramente Taufe, Firmung, Kommunion, Buße und Ölweihe gelten für alle Christen als verpflichtend. Das Sakrament der Ehe und das Sakrament des Priestertums gewähren Wahlfreiheit. Auch die Sakramente werden im Laufe des Lebens eines Menschen in wiederholbare und nicht wiederholbare Sakramente unterteilt. Nur einmal im Leben werden die Sakramente der Taufe und der Firmung sowie das Sakrament des Priestertums gespendet. Die übrigen Sakramente sind wiederholbar.
Taufe
- das allererste christliche Sakrament, es markiert den Eintritt des Gläubigen in die Kirche Christi. Seiner Gründung ging den Evangelien zufolge die Taufe (reinigendes Eintauchen in Wasser) Jesu selbst im Jordan durch Johannes den Täufer voraus. Die christliche Taufe als Sakrament begann mit den Worten Jesu, die er vor seiner Himmelfahrt an die Apostel richtete: „...geht hin und macht alle Völker zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes“ ( Matthäus 28:19; Markus 16:16). Die Taufmethoden in der alten Kirche werden beschrieben in Lehren der Zwölf Apostel(1. – Anfang 2. Jahrhundert): „Taufe lebendig [d. h. fließendes Wasser im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wenn es kein lebendiges Wasser gibt, taufe in anderem Wasser; Wenn Sie es nicht kalt machen können, dann erwärmen Sie es. Und wenn es weder das eine noch das andere gibt, dann lege es dir dreimal auf den Kopf.“ Wasser als kosmisches und heiliges Element spielt eine entscheidende Rolle bei der Durchführung des Sakraments: Die Taufe erfolgt durch dreimaliges Untertauchen in Wasser mit der Verkündigung der Formel „Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes“. Die göttliche Gnade, die durch das Wasserelement wirkt, befreit einen Menschen von aller Sünde: Säuglinge – von den Erstgeborenen, Erwachsene – sowohl von der ursprünglichen als auch von denen, die im Laufe des Lebens begangen wurden. Der Apostel Paulus nannte die Taufe die Waschung der Wiedergeburt.
Bereits in nachapostolischer Zeit wurde die Kindertaufe akzeptiert. Erwachsene werden durch Katechismus (Katechese) auf den Empfang des Sakraments vorbereitet. Der Katechumenen dauerte in der Regel zwei Jahre, in denen den Katechumenen der wichtigste Teil der christlichen Lehre vermittelt wurde. Vor Ostern trugen sie ihre Namen in die Liste der Getauften ein. Die feierliche Taufe einer großen Zahl von Gläubigen wurde vom Bischof durchgeführt. In Zeiten der Christenverfolgung dienten natürliche Stauseen, Flüsse und Bäche als Orte der Taufe. Seit der Zeit Konstantins des Großen fand die Taufe in Baptisterien, speziell errichteten Becken an Kirchen, statt ( cm. Baptisterium). Unmittelbar nach dem Untertauchen salbte der Presbyter die Stirn des Täuflings mit Öl (Olivenöl), woraufhin er in weiße Gewänder gekleidet wurde, ein Symbol seiner erworbenen Reinheit und Gerechtigkeit. Nach der Taufe wurden die Heiligen Mysterien in der Kirche empfangen. Schwerkranke und Gefangene wurden durch Begießen oder Besprengen getauft.
Die Traditionen der alten Kirche werden heute in der Orthodoxie bewahrt. Die Taufe findet im Tempel statt (in besonderen Fällen ist es erlaubt, die Zeremonie im Haus durchzuführen). Erwachsene werden nach einer Glaubensunterweisung (Katechumen) getauft. Die Verkündigung erfolgt auch bei der Kindertaufe und die Täufer fungieren als Bürgen für ihren Glauben. Der Priester stellt die zu taufende Person mit dem Gesicht nach Osten und spricht Gebete, die den Teufel vertreiben. Der Katechumene wendet sich nach Westen und verzichtet auf Satan und alle seine Werke. Nach der Entsagung wendet er sich erneut dem Osten zu und drückt dreimal den Wunsch aus, sich mit Christus zu vereinen, woraufhin er niederkniet. Der Priester räuchert das Taufbecken mit drei brennenden Kerzen, reicht die Kerzen den Empfängern und segnet das Wasser. Nach der Segnung des Wassers wird das Öl gesegnet. Das Kreuzzeichen wird mit Öl über dem Wasser gemacht, als Symbol der Versöhnung mit Gott. Anschließend zeichnet der Priester das Kreuzzeichen auf Stirn, Ohren, Arme, Beine, Brust und Schultern des Täuflings und taucht ihn dreimal in das Taufbecken. Nach dem Taufbecken kleidet sich der Getaufte in weiße Gewänder, die meist ein Leben lang als Reliquie aufbewahrt werden. Bei Lebensgefahr wird das Ritual in reduzierter Reihenfolge durchgeführt. Wenn die Gefahr besteht, dass das Kind stirbt, darf die Taufe von einem Laien durchgeführt werden. In diesem Fall besteht es darin, das Baby dreimal ins Wasser zu tauchen, mit den Worten: „Der Diener Gottes ist getauft auf den Namen des Vaters Amen, des Sohnes Amen und des Heiligen Geistes Amen.“ Den Namen des Babys können die Eltern selbst wählen, während die Erwachsenen ihn selbst wählen. Wird einem Priester ein solches Recht eingeräumt, ist er verpflichtet, den Namen des Heiligen zu wählen, der der Feier zeitlich am nächsten nach dem Geburtstag des Täuflings liegt. Cm. TAUFE.

Bestätigung.
Nach den Kanonen (Regeln) der orthodoxen Kirche empfängt ein Christ unmittelbar nach der Taufe das Sakrament der Firmung. In diesem Sakrament empfangen die Gläubigen die Gaben des Heiligen Geistes, die ihnen die Kraft geben, fest im orthodoxen Glauben zu bleiben und die Reinheit ihrer Seelen zu bewahren. Das Recht zur Firmung steht nur Bischöfen und Priestern zu. Unabhängig von der Taufe wird sie bei der Salbung von Königen zu Königen sowie in Fällen durchgeführt, in denen Nichtchristen, die nach einem den Regeln der orthodoxen Kirche entsprechenden Ritus getauft, aber nicht gesalbt wurden, der Orthodoxie beitreten. Die Konfirmation nach der Taufe erfolgt wie folgt. Nachdem er den Getauften in weiße Gewänder gekleidet hat, spricht der Priester ein Gebet, in dem er Gott bittet, dem neuen Mitglied der Kirche das Siegel der Gabe des Heiligen Geistes zu verleihen, und bringt das Kreuzzeichen mit Chrisam auf seine Stirn. Augen, Nasenlöcher, Ohren, Brust, Arme und Beine. Dann gehen der Presbyter und die Neugetauften gemeinsam dreimal mit Kerzen in der Hand um das Taufbecken und singen dabei den Vers: „Wer in Christus getauft ist, zieht Christus an.“ Dieses Ritual symbolisiert den Eintritt des Getauften in die ewige Vereinigung mit Christus. Es folgt die Lesung des Apostels und des Evangeliums, danach die sogenannte. Waschung. Nachdem er seine Lippe in warmes Wasser getaucht hat, wischt der Priester die mit Myrrhe gesalbten Stellen mit den Worten ab: „Du wurdest getauft, du wurdest erleuchtet, du wurdest mit Myrrhe gesalbt ...“ Die Salbung, die während der Krönung von Königen durchgeführt wird, ist weder ein besonderes Sakrament noch eine Wiederholung dessen, was zuvor getan wurde. Die heilige Salbung eines Souveräns bedeutet nur ein höheres Maß an Weitergabe der Gaben des Heiligen Geistes, die für ihn notwendig sind, um den Dienst zu erfüllen, zu dem er von Gott berufen ist. Das Ritual der Krönung und Salbung des Königs ist ein feierlicher Akt, der durch die Einführung des Herrschers zum Altar abgeschlossen wird, wo er am Thron als Gesalbter Gottes, Schutzpatron und Beschützer der Kirche, die Kommunion empfängt. Cm. BESTÄTIGUNG.
Buße.
Dieses Sakrament reinigt den Gläubigen von den Sünden, die er nach der Taufe begangen hat, und gibt Kraft, die Leistung des irdischen christlichen Lebens fortzusetzen. Indem ein Christ einem Priester seine Sünden beichtet, erhält er von ihm Vergebung und wird auf mysteriöse Weise von Gott selbst von seinen Sünden freigesprochen. Nur ein Bischof oder Priester kann die Beichte annehmen, da er durch das Sakrament des Priestertums von Jesus Christus selbst das Recht zur Sündenvergebung erhält. Der Priester ist zur Wahrung des Beichtgeheimnisses verpflichtet; Wegen der Veröffentlichung der ihm bekannten Sünden wird ihm sein Rang entzogen. Die Lehre des Evangeliums versteht Buße nicht einfach als Reue für das, was getan wurde, sondern als Wiedergeburt, Erneuerung der menschlichen Seele. Das Sakrament der Buße wird wie folgt vollzogen. Vor der Ikone von Jesus Christus oder vor dem Heiligen Kreuz liest der Priester Gebete für die Büßer für alle, die zur Beichte in den Tempel kommen. Das eigentliche Sündenbekenntnis gegenüber dem Priester geschieht allein mit ihm. Der Büßer zählt seine Sünden auf, und als er fertig ist, verneigt er sich zu Boden. Nachdem der Priester das Epitrachelion auf dem Kopf des Beichtvaters platziert hat, liest er ein Gebet, in dem er ihn um Vergebung bittet, macht das Kreuzzeichen über seinem Kopf und lässt ihn dann das Kreuz küssen. In besonderen Fällen hat der Priester das Recht, Buße zu verhängen, d.h. eine bestimmte Art von Strafe entsprechend der Schwere der Sünde. In der orthodoxen Kirche gilt die Regel, dass jeder Christ mindestens einmal im Jahr zur Beichte gehen muss. BUSSE.
Kommunion oder Eucharistie
Sakrament des Priestertums.
Alle Sakramente, mit Ausnahme der Taufe, können nur auf legale Weise (d. h. gemäß den Kanonen der orthodoxen Kirche) von einem geweihten Priester gespendet werden, da er dieses Recht bei der Weihe durch das Sakrament des Priestertums erhält. Das Sakrament des Priestertums besteht darin, dass der Heilige Geist durch die Ernennung zum Hierarchen (Ordination) auf den hierarchisch Ernennten herabkommt. Die Gnade des Heiligen Geistes verleiht dem Eingeweihten eine besondere geistliche Kraft gegenüber den Gläubigen, gibt ihm das Recht, die Herde zu führen, sie im Glauben und der Verbesserung des geistlichen Lebens zu unterweisen und auch kirchliche Sakramente für sie zu vollziehen. Die Priestertumsgrade sind wie folgt: Diakon, Priester (Presbyter) und Bischof. Andere Personen des Klerus, die sogenannten. Geistliche werden nicht durch Ordination, sondern nur mit dem Segen des Bischofs geweiht. In die höchsten Stufen der Hierarchie gelangt man erst, nachdem man nach und nach die niedrigeren Stufen durchlaufen hat. Die Art und Weise der Ordination zum einen oder anderen Grad des Priestertums ist in den Anweisungen der Apostel, in den Zeugnissen der Kirchenväter und in den Regeln ökumenischer Konzilien angegeben. Gnade wird nicht jedem Grad in gleichem Maße zuteil: Weniger dem Diakon, mehr dem Presbyter und mehr dem Bischof. Gemäß dieser Gnade nimmt der Diakon bei der Feier der Sakramente und Gottesdienste die Rolle eines Mitzelebranten des Bischofs und des Priesters ein. Der Presbyter erhält durch die Weihe des Bischofs das Recht, alle Sakramente, mit Ausnahme des Sakraments des Priestertums, und alle Gottesdienste in seiner Pfarrei zu spenden. Der Bischof ist der Hauptlehrer und erste Geistliche, der Hauptverwalter der Kirchenangelegenheiten seiner Diözese. Nur ein mindestens zweiköpfiger Bischofsrat kann Bischöfe ordinieren. Das Sakrament des Priestertums wird während der Liturgie am Altar der Kirche gespendet, damit der Neugeweihte gemeinsam mit dem gesamten Klerus an der Weihe der Heiligen Gaben teilnehmen kann. In der Liturgie wird nur ein Bischof, ein Presbyter und ein Diakon geweiht. Der zum Diakon ordinierte Mann wird zur königlichen Tür gebracht, wo er von Diakonen empfangen wird, die ihn zum Altar führen. Am Altar verneigt er sich vor dem Thron, geht dreimal um ihn herum und küsst die Ecken des Throns, als würde er einen Eid leisten, die Heiligkeit des Altars und des Throns ehrfürchtig zu ehren. Als Zeichen der Demut vor dem Bischof, der ihn ordiniert, küsst er nach jeder Runde die Hand und das Knie des Bischofs, verneigt sich dann dreimal vor dem Thron und kniet auf einem rechten Knie, da dem Diakon ein Teilpriesterdienst anvertraut ist. Zum Gedenken an die Tatsache, dass er seine ganze Seelenkraft dem Dienst am Thron widmet, legt er seine Hände auf den Thron und legt seine Stirn dagegen. Der Initiation geht die Bescheinigung voraus, dass nicht nur die eingeweihte Person, sondern auch alle Mitglieder ihrer Familie orthodoxe Christen sind. Die orthodoxe Kirche hält sich an die Regel, die Ordination auch in nicht-orthodoxen Gesellschaften nicht zu wiederholen, wenn sie korrekt durchgeführt wurde. BISCHOF; KIRCHENHIERARCHIE; KLERUS; PRIESTER; PRIESTER.
Sakrament der Ehe
- ein Sakrament, das über Braut und Bräutigam gespendet wird, Gläubige, die den Weg des Ehelebens gewählt haben, bei dem sie dem Priester und der Kirche ein kostenloses Versprechen geben, einander treu zu bleiben, und der Priester ihre Verbindung segnet und sie darum bittet die Gnade der reinen Einmütigkeit für die Geburt und christliche Erziehung der Kinder. Die Ehe ist ein Bild der Vereinigung von Christus und der Kirche. Bevor nach der Liturgie mit dem Sakrament der Ehe in der Kirche begonnen wird, erfolgt eine Bekanntmachung, das heißt, der Geistliche nennt den Gemeindemitgliedern die Namen des Brautpaares und fragt, ob ihnen Hindernisse für den Abschluss dieser Ehe bekannt sind. Nach der Bekanntgabe erfolgt die eigentliche Trauung. Das Sakrament der Eheschließung findet immer im Tempel unter Anwesenheit von Zeugen statt. Die Zeremonie wird von einem Priester durchgeführt. Die Trauungszeremonie besteht aus zwei Teilen: Verlobung und Hochzeit. Zur Verlobung verlässt der Priester den Altar und legt ein Kreuz und das Evangelium, Symbole der unsichtbaren Gegenwart Christi selbst, auf ein Lesepult in der Mitte des Tempels. Er segnet das Brautpaar und schenkt ihnen brennende Kerzen, die ihre Reinheit symbolisieren. Nach dem Lesen bestimmter Gebete werden die auf dem Thron geweihten Ringe gebracht, und diejenigen, die heiraten, legen sich gegenseitig die Ringe als Zeichen des gegenseitigen Einverständnisses an. Während der Hochzeit wird die Ehe gesegnet und um die Herabkunft der göttlichen Gnade gebeten. Am Ende des Gebets nimmt der Priester die Kronen und setzt sie dem Brautpaar auf den Kopf. Die Kronen stellen eine Belohnung für ihr keusches Leben vor der Ehe dar. Nach dem Tod eines der Ehegatten kann die Ehe ein zweites oder drittes Mal geschlossen werden. Die Feier des Sakraments einer zweiten oder dritten Ehe ist nicht so feierlich. Denjenigen, die bigam oder dreifach verheiratet sind, werden weder Kerzen noch Kronen auf den Kopf gesetzt. Wiederverheiratungen sind von der Kirche nach vollzogener Buße erlaubt.
Segen von Öl oder Salbung.
In diesem Sakrament wird den Kranken bei der Salbung mit Öl Gnade zuteil, die geistige und körperliche Gebrechen heilt. Die Salbung erfolgt nur bei Kranken. Es ist verboten, es sowohl bei Gesunden als auch bei Toten durchzuführen. Vor der Ölweihe beichtet der Kranke und empfängt danach (oder vorher) die Kommunion. Die Spendung des Sakraments beinhaltet eine „Zusammenkunft der Gläubigen“, obwohl sie sowohl in der Kirche als auch zu Hause stattfinden kann. Wünschenswert ist auch ein Rat von sieben Presbytern entsprechend der Zahl der Gaben des Heiligen Geistes, aber auch die Anwesenheit von zwei oder drei Priestern ist zulässig. Im Extremfall darf ein Priester handeln, aber im Namen der Kathedrale Gebete sprechen. Um das Abendmahl zu vollziehen, wird ein Tisch aufgestellt, auf dem eine Schüssel mit Weizen steht. Weizenkörner dienen als Symbol der Wiedergeburt zu neuem Leben. Ein Gefäß mit Öl, ein sichtbares Zeichen der Gnade, wird auf den Weizen gestellt. Wein wird hineingegossen: Die Kombination von Öl und Wein geschieht in Erinnerung daran, dass der evangelische barmherzige Samariter genau dies getan hat, um die Kranken zu behandeln. In der Nähe werden Salbpinsel platziert und sieben Kerzen angezündet. Der Gottesdienst des Sakraments besteht aus drei Teilen. Der erste Teil ist Gebetsgesang. Der zweite Teil ist der Segen des Öls. Der erste Priester liest ein Gebet für die Weihe des Öls, der Rest wiederholt es leise und singt dann Troparien für die Mutter Gottes, Christus und die heiligen Heiler. Der dritte Teil besteht aus sieben Lesungen des Apostels, sieben Lesungen des Evangeliums und sieben Salbungen. Die Körperteile, durch die die Sünde in einen Menschen eindringt, werden gesalbt: Stirn, Nasenlöcher, Wangen, Lippen und beide Seiten der Hände. Nach der siebten Salbung legt der Priester das aufgeschlagene Evangelium auf den Kopf des Kranken, was die Hand des Erretters selbst bedeutet, der den Kranken heilt.
„Sieben kirchliche Sakramente“
Jeder Sonntagsschüler weiß, dass die Zahl der Sakramente in der Kirche sieben beträgt, obwohl diese Einteilung natürlich bedingt ist, da die Kirche selbst ein Geheimnis ist, da alles in ihr geheimnisvoll ist. Da jedoch eine solche Klassifizierung der Sakramente existiert, werden wir sie gemäß dieser Klassifizierung erklären.
1. Es ist nicht gut, kein Christ zu sein
Taufe. Dieses Sakrament wurde von Christus selbst gestiftet, indem er zu seinen Jüngern sagte: „Geht also hin und lehrt alle Nationen und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.“ Dieser Satz enthält eine der Hauptvoraussetzungen für die Regel der Taufe: Man wird in den orthodoxen Glauben getauft, indem man dreimal ins Wasser eintaucht – im Namen der Dreifaltigkeit. Doch schon in den ersten Jahrhunderten des Christentums tauchte eine Häresie (Eunomian) auf, deren Anhänger den Getauften einst in Wasser tauchten – als Zeichen des Todes und der Auferstehung Christi. Bei dieser Gelegenheit stellten die Apostel sogar eine Regel (fünfzigste) auf, nach der derjenige aus der Kirche ausgeschlossen wird, der den Getauften einmal und nicht dreimal untertaucht. Deshalb wird auch heute noch, wenn ein Christ einer nicht-orthodoxen Religion zur Orthodoxie konvertieren möchte, ein gründliches Studium der Regeln durchgeführt, nach denen er zuvor getauft wurde. Wenn sie einmal getauft wurden, gilt eine solche Taufe als ungültig, wenn sie jedoch nach der Dreifachformel getauft wurden, wird eine solche Taufe anerkannt. Da eine Person nur einmal getauft werden sollte, ist eine sorgfältige Recherche erforderlich.
In diesem Zusammenhang stellt sich oft die Frage: Ist es notwendig, die sogenannten Untergetauchten zu taufen, also diejenigen, die in den Dörfern von gläubigen Großmüttern getauft wurden? Wenn in solchen Fällen nicht festgestellt werden kann, wie korrekt die Taufformel befolgt wurde, muss das Sakrament der Taufe erneut durchgeführt werden, und der Priester wird dies auf jeden Fall tun, um das Verbot der Wiedertaufe nicht zu verletzen Sagen Sie: „Wenn Sie nicht getauft sind, essen Sie.“ Wenn ein Mensch richtig getauft wurde, dann kommt er zum Sakrament der Taufe, wird aber erst im Stadium der Salbung in die Feier des Sakraments einbezogen, da seine Großmütter ihn definitiv nicht mit Chrisam gesalbt haben.
2. Wir sind alle mit derselben Welt gesalbt
Obwohl die Firmung bei der Taufe unmittelbar nach dem Eintauchen in das Taufbecken vollzogen wird, handelt es sich dennoch um ein eigenständiges Sakrament. Bei diesem Sakrament versiegelt der Priester das „Siegel der Gabe des Heiligen Geistes“ durch die Salbung der Neugetauften mit heiliger Myrrhe. Myrrhe ist ein duftendes Öl, das in den letzten Tagen der Fastenzeit gekocht und am Gründonnerstag (Donnerstag der Karwoche) von Seiner Heiligkeit dem Patriarchen von Moskau und ganz Russland geweiht wird. Anschließend wird die Myrrhe in Gefäße gegossen und an alle Diözesen verteilt. Verschiedene Sekten, darunter auch solche, die sich willkürlich „orthodox“ nennen, haben kein Chrisam und daher auch nicht das Sakrament der Salbung.
Nach der Taufe und der Konfirmation beginnt das Leben eines Menschen wie bei Null: Alle seine früheren Sünden werden durch das „Bad der Wiedergeburt“ gereinigt, aber da es in dieser gefallenen Welt schwierig ist, nicht zu sündigen, hat die Kirche das Sakrament der Buße eingeführt , auf die ein Getaufter so oft wie möglich zurückgreifen muss.
3. Öffne die Tür der Reue
Reue (Geständnis). Egal wie schwer die Sünden eines Menschen auch sein mögen, der barmherzige Gott kann ihm vergeben, sofern er aufrichtig bereut. Es ist aufrichtig, nicht formell. Ein Mensch wird immer Gründe zur Reue finden, und dafür besteht keine Notwendigkeit, absichtlich zu sündigen. Darüber hinaus ist es unwahrscheinlich, dass eine Person, die absichtlich sündigt, in der Hoffnung, dass Gott ihr die Sünde bei der Beichte vergibt, diese Vergebung erhält.
In den letzten Jahren hat sich die Tradition herausgebildet, dass die Beichte in Kirchen in der Regel zu einem bestimmten Zeitpunkt, am Vorabend der Kommunion, abgenommen wird. Und um mit der Kommunion zu beginnen, müssen Sie mehrere Tage lang (fasten) sprechen und viele besondere Gebete lesen. In diesem Zusammenhang herrschte in den Köpfen neuer Christen die Überzeugung, dass dies alles am Vorabend der Beichte erfolgen sollte. Und da nicht jeder die festgelegten Regeln einhalten kann, sind viele immer noch nicht in der Lage, ihre angehäuften Sünden zu bekennen. Es sollte beachtet werden, dass die Buße ein eigenständiges Sakrament ist und eine Person nicht unbedingt nach strenger Vorbereitung in Form von Fasten und Gebeten damit beginnen kann. Es ist nur ratsam, Ihren Wunsch zur Beichte mit der in einer bestimmten Kirche festgelegten Zeit zu verknüpfen. Die einzige Voraussetzung für diejenigen, die beichten wollen, ist eine aufrichtige Verurteilung ihrer Sünden und der Wunsch, sie nicht zu wiederholen. Aber um mit der Kommunion beginnen zu können, muss man sich besonders vorbereiten.
4. Das ist mein Körper
Sakrament der Kommunion. Beim letzten Abendmahl sagte Christus, als er das Brot brach und es an seine Jünger verteilte: „Dies ist mein Leib“, und nachdem er den Kelch Wein gegeben hatte, sagte er: „Dies ist mein Blut des Neuen Testaments, für das vergossen wird.“ viele für die Vergebung der Sünden.“ Damit ersetzte Christus das blutige Opfer (die Juden schlachteten am Pessach-Lamm ein Lamm) durch ein unblutiges Opfer. Seitdem nehmen Christen beim Empfang der Kommunion im Sakrament der Kommunion den Leib und das Blut Christi in sich auf, in die sich Brot und Wein während des Gottesdienstes auf mysteriöse Weise verwandeln.
In der russisch-orthodoxen Kirche gibt es die Tradition, das Sakrament der Kommunion erst nach der Beichte zu beginnen, ausschließlich auf nüchternen Magen (ab 24 Stunden des Vortages), nachdem man am Vortag mindestens drei Tage lang gefastet und besondere Gebete gelesen hat. Kleinkinder unter sieben Jahren (bis einschließlich sechs Jahre) empfangen die Kommunion ohne Beichte. Schwer erkrankte Menschen, die nicht auf Tabletten verzichten können, dürfen am Vorabend der Kommunion bei Bedarf Medikamente einnehmen, da Medikamente nicht als Lebensmittel gelten. „Untergetauchte“ (von Laien getaufte Personen) können mit dem Empfang des Sakraments erst beginnen, nachdem die Taufe durch einen Priester abgeschlossen wurde. Es ist üblich, dass Laien mindestens fünfmal im Jahr (während vier langer Fastenzeiten und am Tag des Engels) sowie in besonderen Lebenssituationen, beispielsweise am Vorabend einer Hochzeit, die Kommunion empfangen.
5. Die Ehe ist ehrlich und das Bett ist makellos
Hochzeit. Wir stellen gleich fest, dass die Kirche die sogenannte „Zivilehe“, bei der Menschen ohne Anmeldung beim Standesamt zusammenleben, nicht als legal anerkennt. Um Missverständnisse zu vermeiden, dürfen daher nur Personen an einer Trauung teilnehmen, die über eine Heiratsurkunde verfügen. Die Kirche erkennt eine solche eingetragene Ehe als rechtmäßig an. Dennoch erinnert die Kirche daran, dass für orthodoxe Menschen eine Zivilregistrierung nicht ausreicht und dass es unerlässlich ist, Gottes Heiligung des Familienlebens zu empfangen.
Hochzeiten sind in unserer Zeit zu einem modischen Phänomen geworden, und leider ist sich nicht jeder, der sich darauf einlässt, ihrer Bedeutung und ihrer Verantwortung gegenüber Gott und ihrem Ehepartner bewusst, die sie während der Hochzeit übernehmen. Die Kirche möchte eine ehrliche Ehe und ein sauberes Ehebett führen und bittet Gott, die Jugendlichen während ihres gesamten gemeinsamen Lebens zu beschützen. Aber es kommt sehr oft vor, dass Ehepartner eine Hochzeit als eine Art magischen Ritus betrachten, der ihre Verbindung ohne gegenseitige Anstrengung automatisch besiegeln soll. Ohne den Glauben an Gott wird eine Hochzeit in den meisten Fällen bedeutungslos. Eine kirchliche Ehe ist nur dann stark, wenn die Ehegatten die Versprechen, die sie bei der Hochzeit gemacht haben, nicht vergessen und nicht vergessen, Gott um Hilfe bei der Erfüllung dieser Versprechen zu bitten. Und Gott wird ihnen immer helfen, genau wie denen, die sich während des Sakraments der Ölweihe oder Salbung an ihn wenden, wenn sie krank sind.
6. Heilung geistiger und körperlicher Gebrechen
Segen der Salbung (Salbung). Das Wesentliche dieses Sakraments wurde vom Apostel Jakobus am treffendsten dargelegt: „Wenn einer von euch krank ist, rufe er die Ältesten der Kirche, und sie sollen für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben.“ Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken heilen, und der Herr wird ihn auferwecken; und wenn er Sünden begangen hat, werden sie ihm vergeben“ (Brief des Apostels Jakobus, Kapitel 5, Verse 14-15). Viele Menschen nähern sich diesem Sakrament mit völlig unbegründeter Angst: Sie sagen, dass die Salbung dem Tod vorausgeht. Tatsächlich wird einem Menschen am Vorabend des Todes häufig die Salbung gespendet, wodurch er von allen unfreiwilligen Sünden gereinigt wird, die er im Leben begangen hat und die er aus Unwissenheit oder Vergesslichkeit (aber nicht absichtlich verborgen) in der Beichte nicht bereut hat . Es kommt jedoch häufig vor, dass scheinbar hoffnungslos erkrankte Menschen nach dem Sakrament der Salbung wieder auf die Beine kamen. Es besteht also kein Grund, vor diesem heilenden Sakrament Angst zu haben.
7. Pop – vom Wort Papa
Und das letzte (natürlich nicht der Wichtigkeit, aber der Zahl nach) Sakrament ist das Sakrament des Priestertums. Die orthodoxe Kirche hat die Kontinuität des Priestertums seit den Aposteln bewahrt, die Christus selbst ordiniert hat. Seit frühchristlicher Zeit wurde das Sakrament des Priestertums (Ordination) kontinuierlich in den Tiefen der Kirche bis in unsere Zeit weitergegeben. Daher gibt es in den christlichen Organisationen, die regelmäßig aus dem Nichts entstehen und behaupten, Kirche genannt zu werden, tatsächlich kein Priestertum als solches.
Das Sakrament des Priestertums wird nur an männlichen Personen gespendet, die sich zur Orthodoxie bekennen, in erster Ehe (verheiratet) sind oder die Mönchsgelübde abgelegt haben. In der orthodoxen Kirche gibt es eine dreistufige Hierarchie: Diakone, Priester und Bischöfe. Ein Diakon ist ein Geistlicher ersten Grades, der zwar an den Sakramenten teilnimmt, diese aber nicht selbst vollzieht. Ein Priester (oder Priester) hat das Recht, sechs Sakramente zu spenden, mit Ausnahme des Sakraments der Weihe. Der Bischof ist der höchste Geistliche, der alle sieben Sakramente der Kirche verwaltet und das Recht hat, diese Gabe an andere weiterzugeben. Der Überlieferung nach kann nur ein Priester Bischof werden, der den klösterlichen Rang angenommen hat.
Im Gegensatz zum Katholizismus, wo ausnahmslos alle Priester das Zölibat (Zölibatgelübde) ablegen, gibt es in der Orthodoxie weiße Geistliche (verheiratet) und schwarze (diejenigen, die den klösterlichen Rang angenommen haben). Für weiße Geistliche besteht jedoch die Verpflichtung, einmal verheiratet zu sein, d. h. eine Person, die wiederverheiratet ist, kann kein Geistlicher sein, und ein Geistlicher, der Witwer wird, kann nicht wieder heiraten. Oft nehmen verwitwete Priester den klösterlichen Rang an. Mönche, die gegen ihr Zölibatsgelübde verstoßen, werden aus der Kirche ausgeschlossen.
Nach alter Tradition werden Geistliche (Diakone und Priester) Väter genannt: Pater Paul, Pater Theodosius usw. Bischöfe werden normalerweise Herren genannt. In offiziellen Ansprachen werden die entsprechenden Titel des Klerus geschrieben: Der Diakon wird mit „Ihre Liebe zu Gott“ angesprochen, der Priester wird mit „Ihre Hochwürden“ angesprochen, der Erzpriester (Oberpriester) wird mit „Ihre Hochwürden“ angesprochen. Auch Äbte und Archimandriten (Oberpriester des Klosterordens) werden als Hochverehrer bezeichnet. Wenn ein Diakon oder Priester ein Mönch ist, dann wird er Hierodiakon bzw. Hieromonk genannt.
Bischöfe, auch Bischöfe genannt, können mehrere Verwaltungsgrade haben: Bischof, Erzbischof, Metropolit, Patriarch. Der Bischof wird offiziell mit „Eure Eminenz“, der Erzbischof und Metropolit mit „Eure Eminenz“ und der Patriarch mit „Eure Heiligkeit“ angesprochen. In der orthodoxen Kirche ist der Patriarch im Gegensatz zur katholischen Kirche (wo der Papst als Stellvertreter Christi auf Erden und daher als unfehlbar gilt) nicht mit dem Status der Unfehlbarkeit ausgestattet. Das Vorhandensein des Wortes „Heiligkeit“ im Titel des Patriarchen bezieht sich nicht auf ihn, sondern auf die Kirche selbst, eine der irdischen Strukturen, deren Oberhaupt er ist. Dennoch werden die wichtigsten kirchlichen Entscheidungen in der orthodoxen Kirche konziliar, also kollektiv, getroffen, da trotz des Vorhandenseins von Titeln und Titeln alle orthodoxen Christen Brüder und Schwestern in Christus sind und gemeinsam die Kirche selbst sind, die heilig und heilig ist unfehlbar.
Nun, was das Wort „Pop“ betrifft, das in der heutigen Zeit eine gewisse beleidigende und abfällige Konnotation angenommen hat, sollte beachtet werden, dass es vom griechischen Wort „papes“ stammt, was „liebender Vater“ oder „liebender Vater“ bedeutet!