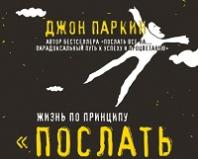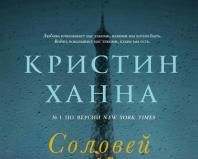Ursachen der Feuerfestigkeit. Feuerfestigkeit. Quantitatives Maß der Erregbarkeit. Aktionspotential und seine Phasen. Veränderungen der Erregbarkeit während der Erregung. Feuerfestigkeit, ihre Arten und Ursachen
Die ersten Phonendoskope waren gefaltete Papierbögen oder hohle Bambusstäbe, und viele Ärzte verwendeten nur ihr eigenes Hörorgan. Aber sie alle wollten hören, was im Inneren des menschlichen Körpers passiert, insbesondere wenn es um ein so wichtiges Organ wie das Herz ging.
Herztöne sind Geräusche, die bei der Kontraktion der Myokardwände entstehen. Normalerweise hat ein gesunder Mensch zwei Töne, die je nach pathologischem Prozess von weiteren Tönen begleitet sein können. Ein Arzt jeglicher Fachrichtung muss in der Lage sein, diese Geräusche zu hören und zu interpretieren.
Herzzyklus
Das Herz schlägt mit einer Frequenz von sechzig bis achtzig Schlägen pro Minute. Dies ist natürlich ein Durchschnittswert, aber neunzig Prozent der Menschen auf dem Planeten fallen darunter, was bedeutet, dass er als Norm angesehen werden kann. Jeder Schlag besteht aus zwei abwechselnden Komponenten: Systole und Diastole. Der systolische Herzton wiederum wird in atriale und ventrikuläre unterteilt. Dies dauert 0,8 Sekunden, aber das Herz hat Zeit, sich zusammenzuziehen und zu entspannen.
Systole

Wie oben erwähnt, sind zwei Komponenten beteiligt. Zuerst kommt es zur Vorhofsystole: Ihre Wände ziehen sich zusammen, unter Druck stehendes Blut gelangt in die Herzkammern und die Klappenklappen schließen sich. Es ist das Geräusch der sich schließenden Ventile, das durch ein Phonendoskop gehört wird. Dieser gesamte Vorgang dauert 0,1 Sekunden.
Dann kommt die ventrikuläre Systole, die eine viel komplexere Aufgabe ist als die Vorgänge in den Vorhöfen. Zunächst stellen wir fest, dass der Vorgang dreimal länger dauert – 0,33 Sekunden.
Die erste Periode ist ventrikuläre Spannung. Es umfasst Phasen asynchroner und isometrischer Kontraktionen. Alles beginnt damit, dass sich ein eklektischer Impuls im gesamten Myokard ausbreitet, einzelne Muskelfasern erregt und diese zu einer spontanen Kontraktion veranlasst. Dadurch verändert sich die Form des Herzens. Dadurch schließen sich die Atrioventrikularklappen fest und der Blutdruck steigt. Dann kommt es zu einer starken Kontraktion der Ventrikel und das Blut gelangt in die Aorta oder Lungenarterie. Diese beiden Phasen dauern 0,08 Sekunden und in den verbleibenden 0,25 Sekunden gelangt das Blut in die großen Gefäße.
Diastole
Auch hier ist nicht alles so einfach, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Die ventrikuläre Entspannung dauert 0,37 Sekunden und erfolgt in drei Phasen:
- Protodiastolisch: Nachdem das Blut das Herz verlassen hat, sinkt der Druck in seinen Hohlräumen und die Klappen, die zu großen Gefäßen führen, schließen sich.
- Isometrische Entspannung: Die Muskeln entspannen sich weiter, der Druck sinkt noch mehr und erreicht den Vorhofdruck. Dadurch öffnen sich die Atrioventrikularklappen und Blut aus den Vorhöfen gelangt in die Ventrikel.
- Füllung der Ventrikel: Je nach Druckgefälle füllt die Flüssigkeit die unteren Ventrikel. Bei Druckausgleich verlangsamt sich der Blutfluss allmählich und kommt dann zum Stillstand.
Dann wiederholt sich der Zyklus erneut, beginnend mit der Systole. Ihre Dauer ist immer gleich, die Diastole kann jedoch je nach Herzschlaggeschwindigkeit verkürzt oder verlängert werden.
Mechanismus der Bildung des ersten Tons
So seltsam es auch klingen mag, 1 Herzton besteht aus vier Komponenten:
- Ventil – es ist führend in der Klangbildung. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Vibrationen der atrioventrikulären Klappensegel am Ende der Ventrikelsystole.
- Muskulös - oszillierende Bewegungen der Ventrikelwände während der Kontraktion.
- Gefäß - Dehnung der Wände in dem Moment, in dem Blut unter Druck in sie eindringt.
- Vorhof - Vorhofsystole. Dies ist der unmittelbare Beginn des ersten Tons.
Der Mechanismus der Bildung des zweiten Tons und zusätzlicher Töne
Der 2. Herzton umfasst also nur zwei Komponenten: Klappen- und Gefäßton. Das erste ist das Geräusch, das durch Blutstöße auf die Klappen der Arterie und des Lungenstamms entsteht, wenn diese noch geschlossen sind. Die zweite, also die vaskuläre Komponente, ist die Bewegung der Wände großer Gefäße, wenn sich die Klappen schließlich öffnen.
Zusätzlich zu den beiden Haupttönen gibt es auch 3 und 4 Töne.
Das dritte Geräusch sind Vibrationen des ventrikulären Myokards während der Diastole, wenn Blut passiv in einen Bereich mit niedrigerem Druck fließt.
Der vierte Ton erscheint am Ende der Systole und ist mit dem Ende des Blutausstoßes aus den Vorhöfen verbunden.
Eigenschaften des ersten Tons
Herzgeräusche hängen von vielen Ursachen ab, sowohl intra- als auch extrakardial. Die Klangfülle eines Tons hängt vom objektiven Zustand des Myokards ab. Die Lautstärke wird also in erster Linie durch den dichten Verschluss der Herzklappen und die Geschwindigkeit, mit der sich die Herzkammern zusammenziehen, gewährleistet. Merkmale wie die Dichte der atrioventrikulären Klappensegel sowie deren Position in der Herzhöhle werden als zweitrangig angesehen.
Am besten hört man den ersten Herzton an seinem Scheitelpunkt – im Interkostalraum 4–5 links vom Brustbein. Für genauere Koordinaten ist es notwendig, in diesem Bereich eine Perkussion der Brust durchzuführen und die Grenzen der Herzdämpfung klar zu bestimmen.
Eigenschaften von Ton II
Um ihm zuzuhören, müssen Sie die Glocke des Phonendoskops über der Herzbasis platzieren. Dieser Punkt liegt etwas rechts vom Schwertfortsatz des Brustbeins.
Die Lautstärke und Klarheit des zweiten Tons hängt auch davon ab, wie fest die nunmehr halbmondförmigen Klappen schließen. Darüber hinaus beeinflusst die Geschwindigkeit ihrer Betätigung, also das Schließen und die Vibration der Tragegurte, den erzeugten Klang. Weitere Eigenschaften sind die Dichte aller an der Tonusbildung beteiligten Strukturen sowie die Stellung der Klappen beim Ausstoßen des Blutes aus dem Herzen.
Regeln zum Hören von Herztönen

Der Herzschlag ist nach weißem Rauschen wahrscheinlich der friedlichste Klang der Welt. Wissenschaftler haben die Hypothese, dass das Kind dies in der pränatalen Phase hört. Doch um eine Schädigung des Herzens zu erkennen, reicht es nicht aus, nur darauf zu hören, wie es schlägt.
Zunächst sollte die Auskultation in einem ruhigen und warmen Raum erfolgen. Die Körperhaltung der untersuchten Person hängt davon ab, auf welche Klappe genauer geachtet werden muss. Dies könnte eine Position sein, die auf der linken Seite liegt, aufrecht, aber mit nach vorne geneigtem Körper, auf der rechten Seite usw.
Der Patient sollte selten und flach atmen und auf Anweisung des Arztes den Atem anhalten. Um klar zu verstehen, wo sich die Systole und wo die Diastole befindet, muss der Arzt parallel zum Zuhören die Halsschlagader abtasten, deren Puls vollständig mit der systolischen Phase übereinstimmt.
Verfahren zur Auskultation des Herzens

Nach einer vorläufigen Feststellung der absoluten und relativen Herzdämpfung hört der Arzt die Herztöne ab. Es beginnt normalerweise an der Oberseite der Orgel. Dort ist die Mitralklappe deutlich hörbar. Anschließend gelangen sie zu den Klappen der Hauptarterien. Zuerst zur Aorta – im zweiten Interkostalraum rechts vom Brustbein, dann zur Pulmonalarterie – auf gleicher Höhe, nur links.
Der vierte Hörpunkt ist die Basis des Herzens. Es befindet sich an der Basis, kann aber zu den Seiten verschoben werden. Daher muss der Arzt die Form des Herzens überprüfen und die elektrische Achse genau abhören
Die Auskultation ist am Botkin-Erb-Punkt abgeschlossen. Hier können Sie es hören. Es befindet sich im vierten Interkostalraum links am Brustbein.
Zusätzliche Töne

Der Herzton ähnelt nicht immer einem rhythmischen Klicken. Manchmal, öfter als uns lieb ist, nimmt es bizarre Formen an. Ärzte haben gelernt, einige von ihnen nur durch Zuhören zu erkennen. Diese beinhalten:
Mitralklappenklick. Es ist in der Nähe der Herzspitze zu hören, geht mit organischen Veränderungen der Klappensegel einher und tritt nur bei erworbenen Herzerkrankungen auf.
Systolisches Klicken. Eine andere Art von Mitralklappenerkrankung. In diesem Fall schließen die Klappen nicht dicht und scheinen sich während der Systole nach außen zu drehen.
Recardton. Gefunden bei adhäsiver Perikarditis. Verbunden mit einer übermäßigen Dehnung der Ventrikel aufgrund der im Inneren gebildeten Verankerungen.
Wachtelrhythmus. Tritt bei Mitralstenose auf und äußert sich in einem Anstieg des ersten Tons, einer Betonung des zweiten Tons in der Lungenarterie und einem Klicken der Mitralklappe.
Galopprhythmus. Der Grund für sein Auftreten ist eine Abnahme des Myokardtonus, die vor dem Hintergrund einer Tachykardie auftritt.
Extrakardiale Ursachen für erhöhte und verminderte Geräusche

Das Herz schlägt ein Leben lang im Körper, ohne Pausen oder Ruhe. Das bedeutet, dass, wenn es abgenutzt ist, Fremde in den gemessenen Geräuschen seiner Arbeit auftauchen. Die Gründe hierfür können in direktem Zusammenhang mit einer Herzschädigung stehen oder auch nicht.
Die Stärkung der Töne wird erleichtert durch:
Kachexie, Anorexie, dünne Brustwand;
Atelektase der Lunge oder eines Teils davon;
Tumor im hinteren Mediastinum, der die Lunge verdrängt;
Infiltration der unteren Lungenlappen;
Blasen in der Lunge.
Verminderte Herztöne:
Übergewicht;
Entwicklung der Brustwandmuskulatur;
Subkutanes Emphysem;
Vorhandensein von Flüssigkeit in der Brusthöhle;
Intrakardiale Ursachen für erhöhte und verminderte Herztöne
Herztöne sind klar und rhythmisch, wenn eine Person ruht oder schläft. Wenn er sich zu bewegen beginnt, zum Beispiel die Treppe zur Arztpraxis hinaufsteigt, kann dies zu einer Erhöhung des Herztons führen. Eine erhöhte Herzfrequenz kann auch durch Anämie, Erkrankungen des endokrinen Systems usw. verursacht werden.
Bei erworbenen Herzfehlern wie einer Mitral- oder Aortenstenose oder einer Klappeninsuffizienz ist ein dumpfer Herzton zu hören. Die Aortenstenose in den herznahen Abschnitten leistet ihren Beitrag: der aufsteigende Teil, der Bogen, der absteigende Teil. Gedämpfte Herztöne sind mit einer Zunahme der Myokardmasse sowie mit entzündlichen Erkrankungen des Herzmuskels verbunden, die zu Dystrophie oder Sklerose führen.
Herzgeräusche

Neben Tönen kann der Arzt auch andere Geräusche wahrnehmen, sogenannte Geräusche. Sie entstehen durch die Turbulenzen des Blutflusses, der durch die Hohlräume des Herzens fließt. Normalerweise sollten sie nicht da sein. Alle Geräusche können in organische und funktionale Geräusche unterteilt werden.
- Organische treten auf, wenn im Organ anatomische, irreversible Veränderungen des Klappensystems auftreten.
- Funktionelle Geräusche sind mit Störungen der Innervation oder Ernährung der Papillarmuskulatur, einer Erhöhung der Herzfrequenz und der Blutflussgeschwindigkeit sowie einer Abnahme ihrer Viskosität verbunden.
Herzgeräusche können Herztöne begleiten oder unabhängig davon auftreten. Manchmal wird bei entzündlichen Erkrankungen der Herzschlag überlagert, und dann muss der Patient gebeten werden, den Atem anzuhalten oder sich nach vorne zu beugen und die Auskultation erneut durchzuführen. Dieser einfache Trick hilft Ihnen, Fehler zu vermeiden. In der Regel versuchen sie beim Abhören pathologischer Geräusche festzustellen, in welcher Phase des Herzzyklus sie auftreten, den Ort des besten Abhörens zu finden und die Eigenschaften des Geräusches zu erfassen: Stärke, Dauer und Richtung.
Geräuscheigenschaften
Es gibt verschiedene Arten von Geräuschen, die auf der Klangfarbe basieren:
Weich oder blasend (normalerweise nicht mit einer Pathologie verbunden, kommt häufig bei Kindern vor);
Rau, Schaben oder Sägen;
Musical.
Nach der Dauer werden unterschieden:
Kurz;
Lang;
Nach Ausgabe:
Laut;
Absteigend;
Zunehmend (insbesondere bei Verengung der linken AV-Öffnung);
Zunehmend abnehmend.
Die Volumenänderung wird während einer der Phasen der Herzaktivität aufgezeichnet.
Nach Höhe:
Hohe Frequenz (bei Aortenstenose);
Geringe Häufigkeit (mit Mitralstenose).
Es gibt einige allgemeine Muster bei der Auskultation von Geräuschen. Erstens sind sie aufgrund der Pathologie, aus der sie entstanden sind, an den Stellen der Klappen leicht zu hören. Zweitens strahlt der Lärm in Richtung des Blutflusses und nicht entgegen. Und drittens sind pathologische Geräusche ebenso wie Herztöne am besten dort zu hören, wo das Herz nicht von der Lunge bedeckt ist und eng an der Brust anliegt.
Es ist besser, in Rückenlage zuzuhören, da der Blutfluss aus den Ventrikeln leichter und schneller wird, und diastolisch – im Sitzen, da Flüssigkeit aus den Vorhöfen unter der Schwerkraft schneller in die Ventrikel gelangt.
Herzgeräusche können anhand ihrer Lokalisation und Phase des Herzzyklus unterschieden werden. Wenn sowohl in der Systole als auch in der Diastole an derselben Stelle ein Geräusch auftritt, deutet dies auf eine kombinierte Läsion einer Klappe hin. Wenn das Geräusch in der Systole an einer Stelle und in der Diastole an einer anderen Stelle auftritt, handelt es sich bereits um eine kombinierte Läsion zweier Klappen.
Die Refraktärzeit ist eine Periode der sexuellen Unerregbarkeit bei Männern, die nach der Ejakulation auftritt.
Unmittelbar nach dem Ende des Geschlechtsverkehrs, der mit einer Ejakulation mit Orgasmus endete, entwickelt ein Mann eine absolute sexuelle Unerregbarkeit. Es kommt zu einem starken Rückgang der nervösen Erregung, und keine Art erotischer Stimulation, einschließlich Liebkosungen der Genitalien durch einen Partner, kann bei einem Mann sofort eine wiederholte Erektion hervorrufen.
In diesem ersten Stadium der Refraktärzeit ist der Mann gegenüber der Wirkung sexueller Stimulanzien völlig gleichgültig. Nach einer bestimmten Zeit nach der Ejakulation (für jeden individuell) beginnt die nächste, längste Phase der Refraktärzeit – die relative sexuelle Unerregbarkeit. Während dieser Zeit ist es für einen Mann immer noch schwierig, sich auf neue Intimität einzustellen, aber die sexuelle Aktivität einer Partnerin, ihre intensiven und geschickten Liebkosungen können bei einem Mann zu einer Erektion führen.
Die Dauer der gesamten Refraktärzeit und ihrer einzelnen Phasen variiert je nach Alter des Mannes und seiner sexuellen Konstitution erheblich.
Wenn es bei Jugendlichen innerhalb weniger Minuten nach der Ejakulation zu einer wiederholten Erektion kommen kann, kann bei älteren Männern der Zeitraum der sexuellen Unerregbarkeit in Tagen gezählt werden. Manche Männer (meist unter 30-35 Jahren) haben eine so maskierte Refraktärzeit, dass sie nach der ersten Ejakulation wiederholten Geschlechtsverkehr durchführen können, ohne den Penis aus der Vagina zu entfernen. In diesem Fall kann es zu einer sehr kurzfristigen und nur teilweisen Abschwächung der Erektion kommen, die sich im Verlauf der Reibungen schnell wieder verstärkt. Solche „doppelten“ sexuellen Handlungen können sich oft bis zu mehreren zehn Minuten hinziehen, da nach der ersten Ejakulation die Erregbarkeit der Nervenzentren leicht nachlässt und es bei fortgesetztem Geschlechtsverkehr nach der längsten Zeitspanne zu einer erneuten Ejakulation beim Mann kommt von Zeit.
Bei Frauen gibt es keine Refraktärzeit. G. S. Vasilchenko weist auf den Zusammenhang zwischen diesen Merkmalen der Sexualität von Männern und Frauen und ihren unterschiedlichen biologischen Rollen im Prozess der Kopulation hin. Sexuelle Befriedigung ist aus biologischer Sicht nur eine Belohnung für Handlungen, die auf die Verlängerung der Rasse abzielen. Daher wurden im Laufe der Evolution zunächst jene Eigenschaften festgelegt, die zu einer wirksamen Befruchtung beitragen. In diesem Sinne besteht die Hauptaufgabe eines Mannes beim Geschlechtsverkehr in der Freisetzung vollwertiger Spermien, was bei wiederholtem Geschlechtsverkehr aufgrund einer Abnahme der Anzahl reifer und beweglicher Spermien unwahrscheinlich ist. Daraus wird deutlich, dass die Refraktärzeit nach jeder Ejakulation dazu dient, die sexuelle Aktivität eines Mannes einzuschränken, die Reifung der Keimzellen zu fördern und die Befruchtungsfähigkeit der Spermien zu erhöhen. Die biologische Aufgabe einer Frau besteht darin, Spermien wahrzunehmen, daher profitiert sie im Gegenteil vom Fehlen einer Refraktärzeit. Wenn es für eine Frau nach dem ersten Orgasmus unmöglich wäre, den Geschlechtsverkehr fortzusetzen, würde dies die Wahrscheinlichkeit einer Befruchtung erheblich verringern.
Während der Entwicklung des Aktionspotentials ändert sich die Erregbarkeit von Kardiomyozyten in Abhängigkeit vom Wert des Membranpotentials, was mit Veränderungen im Zustand der Natrium- und Calciumionenkanäle verbunden ist. Während der Membrandepolarisation werden spannungsgesteuerte Kanäle inaktiviert und die Erregbarkeit (die Fähigkeit, als Reaktion auf einen anderen Reiz ein Aktionspotential zu erzeugen) verringert. Mit fortschreitender Repolarisation verlassen die Ionenkanäle allmählich den inaktivierten Zustand und die Erregbarkeit des Kardiomyozyten wird wiederhergestellt. Der Zustand verminderter Erregbarkeit wird genannt Feuerfestigkeit, und der entsprechende Zeitraum ist Refraktärzeit. Es gibt mehrere Phasen der Refraktärzeit, die bei Zellen mit „schneller Reaktion“ eindeutig mit den Phasen des Aktionspotentials korrelieren (Abb. 4).
Die Zeit, in der der Kardiomyozyt nicht in der Lage ist, als Reaktion auf eine Stimulation jeglicher Stärke eine sich ausbreitende Erregung zu erzeugen, wird als bezeichnet effektive Refraktärzeit(ERP). Dieser Zeitraum fällt zeitlich mit den Phasen der schnellen Depolarisation, der anfänglichen schnellen Repolarisation, dem „Plateau“ und dem Beginn der letzten Repolarisationsphase des Aktionspotentials „schneller“ Kardiomyozyten zusammen. Die schnelle Depolarisationsphase ist durch die maximal mögliche Aktivierungsrate von Na + -Kanälen gekennzeichnet, wonach ihre schnelle Inaktivierung erfolgt (während der anfänglichen Repolarisations- und „Plateau“-Phasen). Zu diesem Zeitpunkt befindet sich der Kardiomyozyten in einem Zustand absolute Feuerfestigkeit, ohne in irgendeiner Weise auf irgendwelche Reize zu reagieren, auch nicht auf schädliche. Zu Beginn der letzten Repolarisationsphase des Aktionspotentials verlassen einige Na+-Kanäle den Inaktivierungszustand, reichen aber noch nicht aus, um die Ausbreitung der Erregung im gesamten Herzmuskel sicherzustellen. Während dieser kurzen Zeitspanne ist das Myokard nur zu lokalen Reizreaktionen fähig.
Abb.4. Veränderungen in der Erregbarkeit kontraktiler Kardiomyozyten
Die Zahlen geben die Phasen des Aktionspotentials an. (Der Rest der Erklärung steht im Text.)
Wenn das Membranpotential während der Repolarisation etwa -60 mV erreicht, sind so viele Na+-Kanäle zur Aktivierung fähig, dass die Entwicklung einer sich ausbreitenden Erregung möglich wird. Das Aktionspotential entsteht jedoch nur als Reaktion auf stärkere als gewöhnliche Reize (über der Schwelle) und die Geschwindigkeit der Erregungsausbreitung im gesamten Myokard ist verringert. Der Zeitraum, in dem sich der Kardiomyozyten in diesem Zustand befindet, wird als bezeichnet relative Refraktärzeit(ORP). Dieser Zeitraum entspricht der zweiten Hälfte der terminalen Repolarisationsphase des Aktionspotentials „schneller“ Kardiomyozyten und dauert sehr kurze Zeit (bis zu 50 ms) nach Erreichen des maximalen diastolischen Potentials.
Die Gesamtdauer der effektiven und relativen Refraktärperioden (d. h. die Gesamtzeit zur Wiederherstellung der normalen Erregbarkeit) in „schnellen“ Kardiomyozyten entspricht nahezu der Dauer des Aktionspotentials. Bei „langsamen“ Zellen ist eine vollständige Wiederherstellung der Erregbarkeit frühestens 100 ms nach Ende der Repolarisation möglich. Diese Verlängerung der Refraktärzeit im Verhältnis zur Dauer des Aktionspotentials erklärt sich dadurch, dass Ca 2+-Kanäle, die für die Erregung von Zellen mit „langsamer Reaktion“ verantwortlich sind, viel langsamer aus dem Inaktivierungszustand austreten als die Na-Kanäle + Kanäle „schneller“ Kardiomyozyten.
Die Feuerfestigkeit spielt eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung einer normalen Herzfunktion. Die Refraktärzeit des Herzmuskels „schließt“ fast die gesamte Periode seiner Kontraktion ab und schützt zu diesem Zeitpunkt das Myokard vor der Einwirkung von Reizstoffen, die eine vorzeitige erneute Erregung und Kontraktion verursachen könnten. Daher überschreitet die Herzfrequenz auch bei sehr hohen Stimulationsfrequenzen nicht den Wert, der durch die Dauer der Refraktärzeit bestimmt wird. Dadurch bleibt eine minimale Zeitreserve erhalten, damit die Herzkammern Zeit haben, sich zu entspannen und mit Blut zu füllen.
Die Feuerfestigkeit gewährleistet außerdem den normalen Ablauf der Erregungsausbreitung im Herzen und die elektrische Stabilität des Myokards. Da der Bereich des Myokards, durch den die Erregung verläuft, für einige Zeit feuerfest wird, ist ein Wiedereintritt der Erregung in diesen Bereich unmöglich. Dadurch „löschen“ sich Gegenerregungswellen im Myokard gegenseitig, was insbesondere das Entstehen einer Erregungszirkulation verhindert.
Im Endstadium jedes Herzerregungszyklus gibt es eine Zeitspanne, in der repolarisierende Kardiomyozyten aus dem refraktären Zustand austreten und ihre Leitfähigkeit wiederhergestellt wird. Dieser Prozess beginnt bei einigen Zellen früher als bei anderen. Infolgedessen für kurze Zeit angerufen gefährdete Zeit(UP) wird das Myokard in seiner Feuerfestigkeit heterogen und verliert an elektrischer Stabilität. Ein während dieser Zeit auf das Myokard einwirkender Reiz (z. B. ein elektrischer Stromimpuls oder ein frühzeitiges Aktionspotential aus anderen Teilen des Herzens) kann zu schwerwiegenden Störungen des normalen Erregungsverlaufs, insbesondere zum Auftreten von Kreisläufen, führen Erregungswellen mit dem „Wiedereintritts“-Mechanismus ( Wiedereintritt). Das „Re-entry“-Phänomen ist einer der Gründe für die Bildung ektopischer Selbsterregungsherde in verschiedenen Teilen des Myokards, deren Aktivität oft höher ist als die des Sinusknotens. Solche Automatismuszentren können zu pathologischen Schrittmachern des Herzens werden, was einer der Mechanismen für das Auftreten von Tachyarrhythmien (Störungen des Herzrhythmus mit Erhöhung seiner Frequenz) ist.
Starke Störungen des normalen Verhältnisses von Erregbarkeit und Refraktärität können zur Bildung mehrerer autonomer Erregungsherde im Myokard und zu einer vollständigen Desynchronisation und Diskoordination der Aktivität der Myokardfasern führen, wenn diese beginnen, unabhängig voneinander zu erregen und zusammenzuziehen. Dieser Zustand wird Flimmern genannt und geht mit einem fast vollständigen Verlust der Pumpfunktion des entsprechenden Teils des Herzens einher.
Kammerflimmern ist die gefährlichste Herzrhythmusstörung und eine der Hauptursachen für plötzliche Todesfälle durch Kreislaufstillstand. Manchmal ist es in diesem Fall möglich, die Herzaktivität mithilfe einer elektrischen Defibrillation wiederherzustellen – einer kurzen elektrischen Entladung von mehreren tausend Volt auf das Myokard. Eine solche Entladung bewirkt eine Erregung der meisten Kardiomyozyten und deren Synchronisierung entsprechend der Refraktärität, wonach der normale Rhythmus wiederhergestellt werden kann.
Vorhofflimmern (auch Vorhofflimmern genannt) ist in der Regel weniger gefährlich. In diesem Fall wird die chaotische Erregung der Vorhöfe zufällig über den AV-Übergang geleitet, breitet sich dann aber in der üblichen Reihenfolge durch das His-Purkinje-System aus. Dadurch wird das ventrikuläre Myokard synchron erregt, wodurch es seine Pumpfunktion in gewissem Maße ausüben kann. Allerdings ist der Rhythmus der ventrikulären Kontraktionen völlig unregelmäßig und bei jeder Kontraktion wird eine andere Menge Blut ausgestoßen, was Anlass gibt, diesen Zustand „Delirium cordis“ zu nennen.