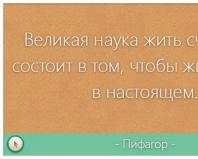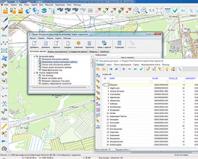Anatomie der oberen Etage der Bauchhöhle. Böden der Bauchhöhle. Aufteilung der Bauchhöhle in Etagen. Obergeschoss der Bauchhöhle
Die Bauchhöhle ist der Teil der Bauchhöhle, der vom parietalen Peritoneum bedeckt ist. Bei Männern ist es geschlossen, bei Frauen kommuniziert es jedoch über die Öffnungen der Eileiter mit der Gebärmutterhöhle.
Die viszerale Schicht des Peritoneums bedeckt die in der Bauchhöhle befindlichen Organe. Organe können allseitig (intraperitoneal), dreiseitig (mesoperitoneal) und extraperitoneal (einseitig oder extraperitoneal liegend) vom Peritoneum bedeckt sein. Organe, die intraperitoneal vom Peritoneum bedeckt sind, weisen eine erhebliche Beweglichkeit auf, die durch das Mesenterium oder die Bänder erhöht wird. Die Verschiebung der mesoperitonealen Organe ist unbedeutend (Abb. 123).
Ein Merkmal des Peritoneums ist, dass das Mesothel (die erste Schicht des Peritoneums) eine glatte Oberfläche bildet, die das Gleiten der Organe während der Peristaltik und bei Volumenänderungen ermöglicht. Unter normalen Bedingungen enthält die Bauchhöhle eine minimale Menge klarer seröser Flüssigkeit, die die Oberfläche des Bauchfells befeuchtet und die Lücken zwischen Organen und Wänden füllt. Bewegungen der Organe zueinander und zur Bauchdecke erfolgen leicht und reibungsfrei, da alle Kontaktflächen glatt und feucht sind. Zwischen der Vorderwand des Bauches und den inneren Organen befindet sich ein Netz. "
Im Bereich des Zwerchfells wird das Bauchfell an der Stelle der „Saugluken“ dünner. Das Lumen der Luken verändert sich bei den Atembewegungen des Zwerchfells, was für deren Saugwirkung sorgt. „Saugluken“ sind auch im Peritoneum des Recessus rectovesicalis bei Männern und des Recessus rectouterine bei Frauen vorhanden.
Es gibt Bereiche des Peritoneums, die die Bauchflüssigkeit transsudieren, absorbieren und gegenüber dieser indifferent sind. Transsudierende Bereiche sind der Dünndarm und die breiten Bänder der Gebärmutter. Die Saugteile des parietalen Peritoneums sind das Zwerchfell und die Beckengrube.
Die Bauchhöhle wird durch das Mesenterium des Colon transversum in zwei Stockwerke unterteilt: das obere und das untere, die von vorne durch die präepiploische Fissur und von den Seiten durch den rechten und linken Seitenkanal miteinander kommunizieren. Darüber hinaus wird der Peritonealboden des kleinen Beckens unterschieden
Der obere Boden der Bauchhöhle liegt zwischen dem Zwerchfell und dem Mesenterium des Colon transversum. Es enthält den Magen, die Milz und das mesoperitoneal bedeckte Intraperitoneal, die Leber, die Gallenblase und den oberen Teil des Zwölffingerdarms. Die Bauchspeicheldrüse gehört zur oberen Etage der Bauchhöhle, liegt jedoch retroperitoneal und ein Teil des Kopfes befindet sich unterhalb der Mesenterialwurzel des Colon transversum. Die aufgeführten Organe, ihre Bänder und das Mesenterium des Colon transversum begrenzen einzelne Räume, Spalten und Beutel im Obergeschoss der Bauchhöhle.
Oberbodentaschen. Der Raum zwischen Zwerchfell und Leber wird durch das Ligamentum falciforme in zwei Abschnitte geteilt: den linken und den rechten.
Der rechte Leberschleimbeutel oder Bursa hepatica dextra ist die Lücke zwischen dem rechten Leberlappen und dem Zwerchfell. Es wird oben vom Zwerchfell, unten vom rechten Leberlappen, hinten vom rechten Teil des Koronarbandes und links vom Ligamentum falciforme der Leber begrenzt. Es umfasst den rechten subphrenischen Raum und den subhepatischen Raum.
Der rechte subphrenische Raum liegt am tiefsten zwischen der hinteren Oberfläche des rechten Leberlappens, dem Zwerchfell und dem Koronarband. Im subdiaphragmatischen Raum, also an der tiefsten Stelle der Leberschleimbeutel, kann die in die Bauchhöhle eingefüllte Flüssigkeit zurückgehalten werden. Der subdiaphragmatische Raum geht in den meisten Fällen direkt in den rechten Seitenkanal der unteren Etage der Bauchhöhle über. Daher kann sich entzündliches Exsudat aus der rechten Beckengrube frei in den subphrenischen Raum bewegen und zur Bildung eines verkapselten Abszesses führen, der als subphrenischer Abszess bezeichnet wird. Es entwickelt sich am häufigsten als Komplikation eines perforierten Magen- und Zwölffingerdarmgeschwürs, einer destruktiven Blinddarmentzündung oder einer Cholezystitis.
Der subhepatische Raum ist der untere Teil der Fava der Leberschleimbeutel und liegt zwischen der unteren Oberfläche des rechten Leberlappens, dem Querkolon und seinem Mesenterium, rechts von der Porta hepatis und dem Ligamentum hepatoduodenale. Im subhepatischen Raum werden vordere und hintere Abschnitte unterschieden. Fast die gesamte peritoneale Oberfläche der Gallenblase und die obere Außenfläche des Zwölffingerdarms sind dem vorderen Abschnitt dieses Raums zugewandt. Der hintere Abschnitt, der sich am hinteren Rand der Leber befindet, ist der am wenigsten zugängliche Teil des subhepatischen Raums – eine Vertiefung, die als renal-hepatischer Recessus bezeichnet wird. Abszesse, die als Folge einer Perforation eines Zwölffingerdarmgeschwürs oder einer eitrigen Cholezystitis entstehen, sind häufiger im vorderen Abschnitt lokalisiert, während die Ausbreitung eines periappendizealen Abszesses hauptsächlich im hinteren Abschnitt des subhepatischen Raums erfolgt.
Der linke subphrenische Raum besteht aus weitläufig kommunizierenden Schleimbeuteln: dem linken Leber- und dem Prägastrium.
Der linke Leberschleimbeutel ist ein Spalt zwischen dem linken Leberlappen und dem Zwerchfell, der rechts vom Ligamentum falciforme der Leber, hinten vom linken Teil des Ligamentum koronar und dem linken Ligamentum triangulare der Leber begrenzt wird. Dieser Schleimbeutel hat eine viel geringere Breite und Tiefe als der rechte Leberschleimbeutel und wird normalerweise nicht als besonderer Teil des subdiaphragmatischen Raums unterschieden.
Die Bursa pregastricia wird nach hinten durch das Omentum minus und den Magen, den oberen linken Leberlappen und das Zwerchfell begrenzt, nach vorne durch die vordere Bauchwand, rechts durch die Ligamentum falciformis und rund der Leber, links durch die Bursa pregastricia hat keinen ausgeprägten Rand. Im äußeren hinteren Teil des linken subdiaphragmatischen Raums befindet sich die Milz mit Bändern: Magen- und Milzband. () Vom linken Seitenkanal ist es durch das linke Zwerchfell-Kolik-Band getrennt. Dieses Band ist oft breit, es bedeckt den unteren Pol der Milz und wird Milz-Fesselband genannt. Dadurch ist das Milzbett gut vom linken Seitenkanal abgegrenzt; es handelt sich um eine blinde Aussparung (Saccus caecus lienalis). Der linke Subdiaphragmaraum spielt als Ort der Abszessbildung eine deutlich geringere Rolle als der rechte. Eitrige Prozesse entwickeln sich selten in diesem Raum und neigen dazu, sich zwischen dem linken Leberlappen und dem Magen bis zum Querkolon oder nach links bis zum Blindsack der Milz auszubreiten. Die Kommunikation zwischen den rechten Schleimbeuteln der Leber und des Magens erfolgt durch einen schmalen Spalt zwischen der Leber und dem Pylorusteil des Magens vor dem Omentum minus.
Der Schleimbeutel omentalis (Bursa omentalis) ist ein großer, geschlossener, schlitzartiger Raum der Bauchhöhle, der isolierteste und tiefste.
Die vordere Wand der Bursa omentalis wird vom Omentum minus, der hinteren Wand des Magens und dem Lig. gastrocolicus (dem Anfangsteil des Omentum majus) gebildet. Das Omentum minus besteht aus drei ineinander übergehenden Bändern: dem hepatoduodenalen, dem hepatogastrischen und dem phrenic-gastrischen. Die untere Wand der Bursa omentalis wird vom Colon transversum und seinem Mesenterium gebildet. Von oben wird die Bursa omentalis durch den Schwanzlappen der Leber und das Zwerchfell begrenzt, die hintere Wand wird durch das parietale Peritoneum gebildet und bedeckt die Vorderseite der Bauchspeicheldrüse, die Aorta, die Vena cava inferior und den oberen Pol der linken Niere Nebenniere, links wird sie durch die Milz mit dem Ligamentum gastrosplenicalis begrenzt und die rechte Wand ist nicht ausgeprägt.
In der Bursa omentalis gibt es Vertiefungen oder Inversionen: Die obere befindet sich hinter dem Schwanzlappen der Leber und reicht bis zum Zwerchfell, die untere befindet sich im Bereich des Mesenteriums des Querkolons und der Milz.
Der Eintritt in die Bursa omentalis ist nur durch das Foramen omentalis möglich, das vorne durch das Ligamentum hepatoduodenale, hinten durch das Ligamentum hepatorenale begrenzt wird, in dessen Dicke die Vena cava inferior liegt, oben durch den Schwanzlappen der Leber, unten durch das Ligamentum hepatorenale nephroduodenales Band.
Durch die Öffnung des Omentums können ein oder zwei Finger hindurchgeführt werden. Wenn sich jedoch Verwachsungen bilden, kann diese verschlossen werden, und dann ist die Bursa omentalis ein völlig isolierter Raum. Bei der Perforation eines Geschwürs kann sich der Mageninhalt in der Bursa omentalis ansammeln;
Als Folge entzündlicher Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse treten eitrige Prozesse auf.
Zur Untersuchung, Revision von Organen und Operationen an der Bursa omentalis gibt es drei operative Zugänge (Abb. 124):
1. Durch das Magen-Darm-Band, was am meisten zu bevorzugen ist, da es weit geschnitten werden kann. Wird verwendet, um die hintere Wand des Magens und der Bauchspeicheldrüse auf Entzündungen und Verletzungen zu untersuchen.
2. Durch das Loch im Mesenterium des Querkolons an einer avaskulären Stelle können Sie die Höhle des Schleimbeutels untersuchen und eine gastrointestinale Anastomose durchführen.
3. Der Zugang über das Hepatogastralband ist bei einem Magenvorfall bequemer. Wird bei Operationen an der Zöliakie eingesetzt.
Kanäle und Nebenhöhlen der unteren Etage. Die untere Etage der Bauchhöhle nimmt den Raum zwischen dem Mesenterium des Colon transversum und dem kleinen Becken ein. Der aufsteigende und absteigende Dickdarm und die Wurzel des Mesenteriums des Dünndarms unterteilen den unteren Boden der Bauchhöhle in vier Abschnitte: den rechten und linken Seitenkanal sowie den rechten und linken (Mesenterialsinus (Abb. 125).
Der rechte Seitenkanal liegt zwischen dem aufsteigenden Dickdarm und der rechten Seitenwand des Abdomens. Oben gelangt der Kanal in den subshaphragmatischen Raum, unten in die rechte Beckengrube und dann in das kleine Becken.
Der linke Seitenkanal wird durch den absteigenden Dickdarm und die linke Seitenwand des Abdomens begrenzt und geht in ihn über
linke Beckenregion. Am tiefsten sind in horizontaler Lage die oberen Abschnitte der Kanäle.
Der rechte Sinus mesenterica wird rechts vom aufsteigenden Dickdarm, oben vom Mesenterium des Colon transversum und links und unten vom Mesenterium des Dünndarms begrenzt. Dieser Sinus ist weitgehend von anderen Teilen der Bauchhöhle abgegrenzt. In horizontaler Position ist der obere rechte Winkel des Sinus am tiefsten.
Der linke Mesenterialsinus ist größer als der rechte. Es wird nach oben durch das Mesenterium des Colon transversum, nach links durch das Colon Descensus und das Mesenterium sigmoideum und nach rechts durch das Mesenterium des Dünndarms begrenzt. Der Sinus ist von unten nicht begrenzt und kommuniziert direkt mit der Beckenhöhle. In horizontaler Position ist der obere Sinuswinkel am tiefsten. Beide Mesenterialnebenhöhlen kommunizieren miteinander durch die Lücke zwischen dem Mesenterium des Colon transversum und dem Anfangsteil des Jejunums. Entzündliches Exsudat aus den Mesenterialnebenhöhlen kann sich in die Seitenkanäle der Bauchhöhle ausbreiten. Der linke Sinus mesenterica ist größer als der rechte Sinus, und aufgrund der fehlenden anatomischen Einschränkungen in seinen unteren Teilen neigen eitrige Prozesse, die sich im Sinus entwickeln, dazu, viel häufiger in die Beckenhöhle abzusteigen als vom rechten Sinus mesenterica.
Neben der Tendenz, dass sich entzündliche Exsudate in allen Spalten der Bauchhöhle ausbreiten, gibt es anatomische Voraussetzungen für die Bildung einer zystischen Peritonitis sowohl in den Seitenkanälen als auch in den Mesenterialhöhlen, insbesondere in der rechten, da diese geschlossener ist . Bei Operationen an den Bauchorganen, insbesondere bei Peritonitis, ist es wichtig, die Dünndarmschlingen zunächst nach links, dann nach rechts umzuleiten und Eiter und Blut aus den Mesenterialnebenhöhlen zu entfernen, um die Bildung verkapselter Abszesse zu verhindern.
Bauchtaschen. Das Peritoneum, das sich von Organ zu Organ bewegt, bildet Bänder, neben denen sich Vertiefungen befinden, die als Taschen (Recessus) bezeichnet werden.
Recessus duodenojejunalis bildet sich am Übergang vom Zwölffingerdarm zum Jejunum, Recessus iliocaecalis superior entsteht am Übergang vom Ileum zum Blinddarm im Bereich des oberen Ileozökalwinkels, Recessus iliocaecalis inferior entsteht im Bereich von der untere Ileozökalwinkel, Recessus retrocaecalis, liegt hinter dem Blinddarm, Recessus intersigmoideus ist eine trichterförmige Vertiefung zwischen dem Mesenterium des Sigmas und dem parietalen Peritoneum, sein Anfang ist dem linken Seitenkanal zugewandt.
Taschen des Peritoneums können zur Bildung innerer Hernien führen. Peritonealtaschen mit inneren Hernien können sehr große Ausmaße erreichen. Innere Hernien können strangulieren und einen Darmverschluss verursachen.
Topografische Anatomie des Magens. Der Magen ist das Hauptorgan des Verdauungssystems und eine mystische beutelförmige Erweiterung des Verdauungstrakts, die sich zwischen der Speiseröhre und dem Zwölffingerdarm befindet.
Holotopie. Der Magen wird auf die vordere Bauchwand im linken Hypochondrium und seine eigene Magengegend projiziert.
Abteilungen. Der Eingang des Magens wird Herz genannt, der Ausgang heißt Pylorus. Eine von der Speiseröhre zur großen Krümmung absteigende Senkrechte teilt den Magen in den Herzabschnitt, bestehend aus Fundus und Körper, und den Pylorusabschnitt, bestehend aus Vestibulum und Pyloruskanal. Der Magen ist in größere und kleinere Krümmungen, Vorder- und Hinterflächen unterteilt.
Syntopie. Es wird das Konzept der „syntopischen Felder des Magens“ unterschieden. Dies sind die Stellen, an denen der Magen mit benachbarten Organen in Kontakt kommt. Bei kombinierten Verletzungen, der Durchdringung von Geschwüren und der Keimung von Magentumoren müssen syntope Felder des Magens berücksichtigt werden. An der Vorderwand des Magens werden drei syntopische Felder unterschieden: Leber, Zwerchfell und freies Feld, das mit der Vorderwand des Bauches in Kontakt steht. Dieses Feld wird auch Magendreieck genannt. Diese Stelle wird üblicherweise für Gastrotomien und Gastrostomien genutzt. Die Größe des Magendreiecks hängt von der Füllung des Magens ab. An der hinteren Magenwand werden fünf syntopische Felder unterschieden: Milz-, Nieren-, Nebennieren-, Pankreas- und Darmkoliken.
Position. In der Bauchhöhle nimmt der Magen im Obergeschoss eine zentrale Stellung ein. Der größte Teil des Magens befindet sich im linken Subphrenicusraum und begrenzt die Schleimbeutel prägastrisch hinten und die Schleimbeutel omentalis vorne. Die Position des Magens entspricht dem Grad der Neigung der Magenlängsachse. Shevkunenko identifizierte entsprechend der Lage der Magenachse drei Arten von Positionen: vertikal (Hakenform), horizontal (Hornform), schräg. Es wird angenommen, dass die Position des Magens direkt vom Körpertyp abhängt.
Beziehung zum Peritoneum. Der Magen nimmt eine intraperitoneale Position ein. An der Verbindung der Schichten des Peritoneums an der kleinen und großen Krümmung bilden sich Magenbänder. Die Bänder des Magens sind in oberflächliche und tiefe Bänder unterteilt. Oberflächliche Bänder:
1) gastrokolisch (Teil des Omentum majus);
2) gastrosplenisch, kurze Magengefäße verlaufen durch sie, die Milzgefäße befinden sich hinter dem Band;
3) gastrodiaphragmatisch;
4) Zwerchfell-Ösophagus, der Ösophagusast der linken Magenarterie verläuft durch ihn;
5) hepatogastrisch, bei dem die linke Magenarterie und -vene entlang der kleinen Krümmung verläuft;
6) hepatisch-pylorisch – Fortsetzung des Hepato-/Magenbandes. Es hat die Form eines schmalen Streifens, der zwischen den Pforten der Leber und dem Pylorus gespannt ist, es bildet einen Zwischenteil zwischen den hepatogastrischen und hepatoduodenalen Drüsen und dient als rechte Grenze bei der Präparation der Magenbänder.
Tiefe Bänder:
1) Magen-Pankreas (am Übergang des Peritoneums vom oberen Rand der Bauchspeicheldrüse zur hinteren Oberfläche des Magens);
2) mit dem Pylorus-Pankreas (zwischen der Pylorus-Otikregion des Magens und dem rechten Teil des Pankreaskörpers);
3) seitliches Zwerchfell-Pipiektal.
Blutversorgung des Magens. Der Magen ist von einem Ring umgeben
Weitgehend anastomosierende Gefäße, die intramurale Äste abgeben und ein dichtes Netzwerk in der Submukosa bilden (Abb. 126). Die Quelle der Blutversorgung ist der Truncus coeliacus, von dem die linke Magenarterie abgeht und direkt zur kleinen Magenkurvatur führt. Die rechte Magenarterie geht von der Arteria hepatica communis ab, die mit der linken anastomosiert und an der kleinen Magenkrümmung den Arterienbogen der kleinen Magenkrümmung bildet. Die linken und rechten gastroepiploischen Arterien bilden den Bogen der großen Krümmung, außerdem gibt es kurze Magenarterien.
Innervation des Magens. Der Magen verfügt über einen komplexen Nervenapparat. Die Hauptquellen der Innervation sind die Vagusnerven, der Zöliakieplexus und seine Derivate: Magen-, Leber-, Milz- und oberer Mesenterialplexus. Die Vagusnerven, die sich an der Speiseröhre verzweigen, bilden den Ösophagusplexus, und die ersten Äste beider Nerven vermischen sich und verbinden sich viele Male. Auf dem Weg von der Speiseröhre zum Magen sind die Äste des Plexus oesophagus in mehreren Stämmen konzentriert: Der linke verläuft zur Vorderfläche des Magens und der rechte verläuft zur Hinterfläche des Magens und gibt Äste an den ab Leber, Solarplexus, Niere und andere Organe. Vom linken Vagusnerv verläuft ein langer Latarget-Ast zum Pylorusteil des Magens. Die Vagusnerven sind ein komplexes Reizleitungssystem, das den Magen und andere Organe mit Nervenfasern für verschiedene funktionelle Zwecke versorgt. In der Brust- und Bauchhöhle gibt es eine Vielzahl von Verbindungen zwischen dem linken und dem rechten Nerv, wo Fasern ausgetauscht werden. Daher kann nicht von einer ausschließlichen Innervation der vorderen Magenwand durch den linken Vagusnerv und durch den rechten Vagusnerv der hinteren Wand gesprochen werden. Der rechte Vagusnerv verläuft oft in Form eines einzigen Stammes, während der linke ein bis vier Äste bildet, häufiger sind es zwei.
Lymphknoten des Magen-Darm-Trakts. Regionale Lymphknoten des Magens befinden sich entlang der kleinen und großen Krümmung sowie entlang der linken Magen-, Leber-, Milz- und Zöliakiearterie. Laut A. V. Melnikov (1960) erfolgt die Lymphdrainage aus dem Magen über vier Hauptsammler (Pools), von denen jeder 4 Stufen umfasst.
Der erste Lymphdrainagesammler sammelt Lymphe aus der Pyloroangralregion des Magens, angrenzend an die große Krümmung. Das 11. Stadium sind die Lymphknoten, die sich in der Dicke des Magen-Darm-Bandes entlang der großen Krümmung in der Nähe des Pylorus befinden, das zweite Stadium sind die Lymphknoten entlang des Randes des Pankreaskopfes unter und hinter dem Pylorus, das dritte Stadium die Lymphknoten befinden sich in der Dicke des Mesenteriums des Dünndarms und der vierte - retroperitoneale paraaortale Lymphknoten.
Im 7/-Lymphdrainagesammler fließt die Lymphe aus dem an die kleine Kurvatur angrenzenden Teil des Pylorusantrums und teilweise aus dem Magenkörper. Das erste Stadium sind die retropylorischen Lymphknoten, das zweite sind die Lymphknoten im Omentum minus im diätischen Teil der kleinen Kurvatur, im Bereich des Pylorus und des Zwölffingerdarms, unmittelbar hinter dem Pylorus, das dritte Stadium ist die Lymphe Knoten in der Dicke des hepatischen Magenbandes. Als viertes Stadium betrachtete A V. Melnikov die Lymphknoten an der Leberpforte.
Der III-Sammler sammelt Lymphe aus dem Magenkörper und der kleinen Kurvatur, den angrenzenden Abschnitten der Vorder- und Hinterwände, den Wänden, dem medialen Teil des Fornix und der abdominalen Speiseröhre. Das erste Stadium sind Lymphknoten, die sich in Form einer Kette entlang der kleinen Krümmung im Gewebe des Omentum minus befinden. Die oberen Knoten dieser Kette werden parakardial genannt; Bei Herzkrebs sind sie zunächst von Metastasen betroffen. Lymphknoten entlang der linken Magengefäße, in der Dicke des gastropankreatischen Bandes, sind die zweite Stufe. Stadium I – Lymphknoten am oberen Rand der Bauchspeicheldrüse und im Bereich ihres Schwanzes. Das vierte Stadium sind Lymphknoten im paraösophagealen Gewebe oberhalb und unterhalb des Zwerchfells.
Im IV-Sammler fließt Lymphe aus dem vertikalen Teil der großen Magenkrümmung, den angrenzenden Vorder- und Hinterwänden und einem erheblichen Teil des Magengewölbes. Lymphknoten im oberen linken Teil des Magen-Darm-Bandes sind das erste Stadium. Das zweite Stadium sind die Lymphknoten entlang der kurzen Arterien des Magens, das dritte Stadium sind die Lymphknoten im Milzhilus. A. V. Melnikov betrachtete das vierte Stadium als Schädigung der Milz.
Für eine ordnungsgemäße Magenchirurgie unter Beachtung onkologischer Grundsätze ist die Kenntnis der Anatomie der regionalen Lymphknoten aller Kollektoren äußerst wichtig.
Topographische Anatomie des Zwölffingerdarms. Der Zwölffingerdarm (Duodenum) ist der Anfangsabschnitt des Dünndarms. Vorn wird es vom rechten Leberlappen und dem Mesenterium des Colon transversum bedeckt; es selbst bedeckt den Kopf der Bauchspeicheldrüse, das Duodenum liegt also tief und grenzt nirgendwo direkt an die vordere Bauchwand. Der Zwölffingerdarm besteht aus vier Teilen. Es besteht aus einem oberen horizontalen, absteigenden, unteren horizontalen und aufsteigenden Teil. Die Kenntnis der Syntopie des Zwölffingerdarms hilft, die Richtung des Eindringens von Geschwüren, der Tumorkeimung und der Ausbreitung von Phlegmonen während einer retroperitonealen Ruptur des Organs zu erklären.
Der obere Teil des Zwölffingerdarms, 4–5 cm lang, liegt zwischen dem Pylorus des Magens und der oberen Biegung des Zwölffingerdarms und verläuft nach rechts und hinten entlang der rechten Oberfläche der Wirbelsäule und geht in den absteigenden Teil über. Dies ist der beweglichste Teil des Darms, der auf allen Seiten vom Peritoneum bedeckt ist. Alle anderen Teile des Darms sind nur vorne mit Peritoneum bedeckt. Im ersten Teil des Zwölffingerdarms befindet sich eine Erweiterung, die Bulbus duodeni genannt wird. Oberer Teil des Zwölffingerdarms von oben; Es kommt mit dem quadratischen Leberlappen in Kontakt, vorne mit der Gallenblase, hinten mit der Pfortader, der Gastroduodenalarterie und dem Hauptgallengang. Der Kopf der Bauchspeicheldrüse grenzt von unten und von innen an den Darm an.
Der absteigende Teil des Zwölffingerdarms ist 10–2 cm lang und liegt zwischen der Flexura duodeni superior und der Flexura duodeni inferior. Dieser Teil des Zwölffingerdarms ist inaktiv und nur vorne mit Peritoneum bedeckt. Der absteigende Teil des Zwölffingerdarms grenzt vorne an den rechten Leberlappen, das Mesenterium des Colon transversum, hinten an das Tor der rechten Niere, den Nierenstiel und die Vena cava inferior. Auf der Außenseite befindet sich der aufsteigende Teil und die Leberflexur des Dickdarms, auf der Innenseite der Pankreaskopf. Der Hauptgallengang und der Pankreasgang münden in den absteigenden Teil des Zwölffingerdarms. Sie durchstoßen die hintere Mesenterialwand des absteigenden Teils des Zwölffingerdarms in dessen mittlerem Abschnitt und münden an der großen (Vaterianischen) Zwölffingerdarmpapille. Darüber kann sich eine nicht permanente kleine Zwölffingerdarmpapille befinden, an der der Nebengang der Bauchspeicheldrüse mündet.
Von der unteren Biegung des Zwölffingerdarms beginnt 1 Zoll und sein horizontaler Teil ist 2 bis 6 cm lang und wird vorne vom Peritoneum bedeckt. Der horizontale (untere) Teil liegt auf der Höhe der III. und IV. Lendenwirbel, unterhalb des Mesenteriums das Colon transversum, teilweise hinter der Wurzel des Mesenteriums des Dünndarms Der erste orientalische Teil des Zwölffingerdarms geht in den aufsteigenden Teil über, 6–10 cm lang. Der aufsteigende Teil endet mit einer Flexur duodenojejunalis, die vorne und hinten mit Peritoneum bedeckt ist die Seiten. An diese Teile des Zwölffingerdarms schließen sich folgende Organe an: oben - Kopf und Körper der Unterschenkeldrüse, vorne - das Querkolon, die Schlingen des Rachendarms, die Wurzel des Mesenteriums des Dünndarms und des Oberen Mesenterialgefäße. Im Rücken - der rechte Lendenmuskel, die Vena cava inferior, die Aorta, die linke Nierenvene.
Binden Sie den Zwölffingerdarm fest. Das Ligamentum hepatoduodenale befindet sich zwischen der Porta hepatis und dem anfänglichen Hi (Fraktur des oberen Teils des Zwölffingerdarms). Es fixiert den anfänglichen Teil des Darms und begrenzt das Foramen omentale< переди. В связке располагаются: общий желчный проток справа, | обственная печеночная артерия слева, а между ними и сзади - поротная вена. Двенадцатиперстно-почечная связка в виде склад- Mi брюшины натянута между наружным краем нисходящей части шенадцатиперстной кишки и правой почкой, где она переходит в париетальную брюшину, расположенную кпереди от почки. Она 01 раничивает сальниковое отверстие снизу. Большую роль в фик- i.iiшп двенадцатиперстно-тощекишечного изгиба играет связка I рейтца (lig. duodenojejunalis).
Im oberen Teil ist der Zwölffingerdarm auf beiden Seiten vom Peritoneum bedeckt. Der absteigende und der horizontale Teil des Radius liegen retroperitoneal, der aufsteigende Teil nimmt eine intraperitoneale Position ein.
Die Blutversorgung des Zwölffingerdarms (siehe Abb. 126) erfolgt über das Truncus coeliacus und das obere Mesenterium. Die oberen und unteren Pankreas-Duodenal-Arterien haben vordere und hintere Äste. Aufgrund der Anastomose zwischen ihnen sind vordere und hintere Äste vorhanden Es bilden sich hintere Arterienbögen, die zwischen dem konkaven Halbkreis des Zwölffingerdarms und dem Kopf der Bauchspeicheldrüse verlaufen, was es unmöglich macht, sie während der Operation zu trennen und sie als einen einzigen Block zu entfernen – eine Pankreatoduodenalresektion, die beispielsweise durchgeführt wird. bei Krebs der Vaterischen Papille oder einem Tumor des Bauchspeicheldrüsenkopfes.
Große Drüsen des Verdauungstraktes
Topographische Anatomie der Leber. Die Leber ist eine der großen Drüsen des Verdauungstraktes. Die Leber zeichnet sich durch vier morphofunktionale Merkmale aus: 1) sie ist das größte Organ; 2) hat drei Kreislaufsysteme: arteriell, venös und portal; 3) alle Substanzen, die in den Magen-Darm-Trakt gelangen, passieren diesen; 4) dient als riesiges Blutdepot; 5) beteiligt sich an allen Arten des Stoffwechsels, synthetisiert Albumine, Globuline, Faktoren des Blutgerinnungssystems, spielt eine wichtige Rolle im Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel und bei der Entgiftung des Körpers, spielt eine wichtige Rolle bei der Lymphproduktion und Lymphzirkulation.
Hayutopia. Die Leber eines Erwachsenen befindet sich im rechten Hypochondrium, in der Magengegend selbst und teilweise im linken Hypochondrium. Die Projektion der Leber auf die vordere Bauchdecke hat die Form eines Dreiecks und kann aus drei Punkten konstruiert werden: Der obere Punkt liegt rechts auf Höhe des 5. Rippenknorpels entlang der Mittelklavikularlinie, der untere Punkt ist der 10 Interkostalraum entlang der Mittellinie, links - auf der Höhe des 6. Rippenknorpels entlang der Parasternallinie. Der untere Rand der Leber fällt mit dem Rippenbogen zusammen. Von hinten wird die Leber auf die Brustwand projiziert, rechts vom 10.-11. Brustwirbel.
Lage der Leber. Die Leber in Bezug auf die Frontalebene kann sein: 1) bei einer dorsopetalen Position ist die Zwerchfelloberfläche der Leber zurückgeworfen und ihre Vorderkante kann sich über dem Rippenbogen befinden; 2) In der ventropetalen Position zeigt die Zwerchfelloberfläche nach vorne und die viszerale Oberfläche nach hinten. In der ventropetalen Position ist der chirurgische Zugang zur unteren Oberfläche der Leber schwierig, und in der dorsopetalen Position ist der Zugang zur oberen Oberfläche schwierig.
Die Leber kann eine rechtsseitige Position einnehmen, dann ist ihr rechter Leberlappen stark entwickelt und die Größe des linken Leberlappens verringert. () Das Organ nimmt eine fast vertikale Position ein und befindet sich manchmal nur in der rechten Hälfte der Bauchhöhle. Die linksseitige Lage der Leber zeichnet sich durch die Lage des Organs in der horizontalen Ebene und einen gut entwickelten linken Leberlappen aus, der in manchen Fällen über die Milz hinausragen kann.
Lebersyntopie. Die Zwerchfelloberfläche des rechten Leberlappens grenzt an die Pleurahöhle, der linke Leberlappen an das Perikard, von dem es durch das Zwerchfell getrennt ist. Die viszerale Oberfläche der Leber kommt mit verschiedenen Organen in Kontakt, wodurch sich Vertiefungen auf der Leberoberfläche bilden. Der linke Leberlappen begrenzt das untere Ende der Speiseröhre und des Magens. Der Pylorusteil des Magens grenzt an den Lappen quadratus. Der rechte Leberlappen im Bereich neben dem Gallenblasenhals grenzt an den oberen horizontalen Teil des Zwölffingerdarms. 11direkter Kontakt mit dem Querkolon und der hepatischen Krümmung des Dickdarms. Hinter dieser Vertiefung grenzt die Oberfläche des rechten Leberlappens an die rechte Niere und Nebenniere. Bei der Beurteilung möglicher Varianten kombinierter Verletzungen der Bauch- und Brusthöhle muss die Lebersyntopie berücksichtigt werden.
Der Leberhilus ist eine anatomische Formation, die die Quer- und linken Längsfurchen der viszeralen Oberfläche der Leber bildet. Hier gelangen Blutgefäße und Nerven in die Leber und Gallengänge und Lymphgefäße verlassen die Leber. An der Porta hepatis sind Gefäße und Gänge einer chirurgischen Behandlung zugänglich, da sie oberflächlich, außerhalb des Parenchyms des Organs, liegen. Die Form des Tores ist von praktischer Bedeutung: offen, geschlossen und mittel. Wenn die Porta hepatis geöffnet ist, kommuniziert die Querfurche mit der linken Sagittal- und Nebenfurche und schafft so günstige Bedingungen für den Zugang zu den Lappen- und Segmentgängen. Bei einer geschlossenen Form der Porta hepatis besteht keine Verbindung mit der linken Sagittalfurche, es gibt keine zusätzlichen Furchen, die Größe der Porta ist reduziert, daher ist es unmöglich, segmentale Gefäße und Gänge in der Porta hepatis zu isolieren, ohne sie zu präparieren Parenchym.
Die Porta hepatis kann in der Mitte zwischen den Rändern der Leber liegen oder an ihren hinteren oder vorderen Rand verschoben sein. Bei einer Verschiebung des Tores nach hinten werden die Bedingungen für einen schnellen Zugang zu den Gefäßen und Gängen des Pfortadersystems bei Leberresektionen und Operationen an den Gallenwegen erschwert.
Die Beziehung zum Peritoneum ist mesoperitoneal, d. h. die Leber ist auf drei Seiten vom Peritoneum bedeckt. Die hintere Oberfläche der Leber ist nicht vom Peritoneum bedeckt; sie wird als extraperitoneales Feld der Leber oder Pars m.ida bezeichnet.
Der Bandapparat der Leber wird üblicherweise in echte Bänder und Peritonealbänder unterteilt. Echte Bänder: 1) Koronarbänder, die die hintere obere Oberfläche der Leber fest am Zwerchfell fixieren und an den Rändern in dreieckige Bänder übergehen; 2) halbmondförmig, in der Sagittalebene am Rand des rechten und linken Lappens gelegen und in ein steiles Band übergehend, das zum Nabel führt und eine teilweise obliterierte Nabelvene enthält. Von der viszeralen Oberfläche der Leber verlaufen die Peritonealbänder nach unten zu den Organen: hepatogastrisch und hepatoduodenal. Das Ligamentum hepatoduodenale (Band des Lebens) gilt als das wichtigste, da es den Ductus choledochus (rechts), die Arteria hepatica communis (links) und die Pfortader enthält und zwischen diesen und hinten liegt. Um die Blutung aus der Leber vorübergehend zu stoppen, wird das Ligamentum hepatoduodenale mit den Fingern oder einem speziellen Instrument abgeklemmt.
Gerät zur Leberfixierung. Die Leber wird in der korrekten anatomischen Position gehalten durch: 1) extraperitoneales Feld (Teil der hinteren Oberfläche der Leber, der nicht vom Peritoneum bedeckt ist); 2) die Vena cava inferior, die auf der Rückseite der Leber liegt und die Lebervenen aufnimmt. Oberhalb der Leber ist die Vene in der Öffnung des Zwerchfells fixiert, unterhalb ist sie fest mit der Wirbelsäule verbunden; 3) intraabdominaler Druck, Muskeltonus der vorderen Bauchdecke und Saugwirkung des Zwerchfells; 4) Leberbänder.
Blutversorgung der Leber. Zwei Gefäße transportieren Blut zur Leber: die Leberarterie und die Pfortader, jeweils 25 und 75 %. Die arterielle Versorgung der Leber erfolgt über die Arteria hepatica communis, die nach dem Austritt aus der Arteria gastroduodenalis die eigentliche Leberarterie genannt wird und in die rechte und linke Leberarterie unterteilt wird.
Pfortader, v. porta, bildet sich hinter dem Pankreaskopf. Dies ist der erste Abschnitt der Vene, der Pars pancreatica genannt wird. Der zweite Abschnitt der Pfortader liegt hinter dem oberen horizontalen Teil des Zwölffingerdarms und windet sich um die Pars retroduodenalis. Der dritte Abschnitt der Vene liegt in der Dicke des Ligamentum hepatoduodenale oberhalb des oberen horizontalen Teils des Zwölffingerdarms und wird Pars supraduodenaiis genannt. Die Pfortader sammelt Blut aus ungepaarten Organen der Bauchhöhle: Darm, Milz, Magen, und besteht aus drei großen Stämmen: der Milzvene, der oberen Mesenterialvene und der unteren Mesenterialvene.
An der Pfortader der Leber bilden die Leberarterie, die Pfortader und der Gallengang die Pfortader-Trias – die Glisson-Trias.
Leber-Yen, vv. Leber i, sammeln sich von den zentralen Lappenvenen und bilden schließlich drei große Stämme, die rechte, linke und mittlere Lebervene, die auf der hinteren Oberfläche am oberen Rand aus dem Lebergewebe austreten (caval porta hepatis) und in die Vena cava inferior münden auf der Höhe seines Durchgangs durch das Zwerchfell.
Aufbau der Leber, segmentale Aufteilung. Die in der klassischen Anatomie akzeptierte Einteilung der Leber in rechten, linken, Schwanz- und Quadratlappen ist für die Operation ungeeignet, da die äußeren Grenzen der Leberlappen nicht der inneren Architektur des Gefäß- und Gallensystems entsprechen. Die moderne Einteilung der Leber in Segmente basiert auf dem Prinzip des Zusammentreffens des Verlaufs der Äste erster Ordnung der drei Lebersysteme: Portal, Arterie und Galle sowie der Lage der wichtigsten Venenstämme der Leber. Die Pfortader, die Leberarterie und die Gallenwege werden als Pfortadersystem (Portaltrias, Gleason-Trias) bezeichnet. Der Verlauf aller Elemente des Pfortadersystems innerhalb der Leber ist relativ gleich. Die Lebervenen werden als Kavalsystem bezeichnet. Der Verlauf der Gefäße und Gallenwege des Leberportalsystems stimmt nicht mit der Richtung der Gefäße des Kavalsystems überein. Daher kommt es heute häufiger zu einer Pfortaderteilung der Leber. Die Durchtrennung der Leber entlang des Pfortadersystems ist für den Chirurgen von größerer Bedeutung, da mit der Isolierung und Ligation der vaskulär-sekretorischen Elemente im Pfortadersystem die Resektion dieses Organs beginnt. Allerdings muss bei der Durchführung einer Resektion, die auf einer Teilung der Leber entlang des Pfortadersystems beruht, der Verlauf der Lebervenen (Kavalsystem) berücksichtigt werden, um den venösen Abfluss nicht zu stören. In der klinischen Praxis hat sich das Schema der segmentalen Leberteilung nach Quino, 1957, durchgesetzt (Abb. 127). Nach diesem Schema ist die Leber in zwei Lappen, fünf Sektoren und acht Segmente unterteilt. Die Segmente sind in Radien um das Tor herum angeordnet. Ein Lappen, Sektor und Segment ist ein Abschnitt der Leber, der über eine separate Blutversorgung, Gallenabfluss, Innervation und Lymphzirkulation verfügt. Die Lappen, Sektoren und Segmente der Leber sind durch vier Hauptspalten voneinander getrennt.
 |
Dachgeschoss Die Bauchhöhle wird oben vom Zwerchfell, seitlich von den Seitenwänden der Bauchhöhle und unten vom Colon transversum und seinem Mesenterium begrenzt. Das Mesenterium des Querkolons verläuft auf Höhe der hinteren Enden der X-Rippen bis zur hinteren Wand der Bauchhöhle. In der oberen Etage der Bauchhöhle befinden sich Magen, Leber und Milz. Auf der Höhe des Obergeschosses befinden sich die retroperitoneale Bauchspeicheldrüse und die oberen Teile des Zwölffingerdarms (sein erster Teil, der Bulbus, liegt intraperitoneal). Im Obergeschoss der Bauchhöhle werden drei relativ begrenzte Behälter unterschieden – Schleimbeutel: Leber-, Bauchspeicheldrüsen- und Omentalschleimbeutel.
Leberschleimbeutel(Bursa hepatica) liegt im Bereich des rechten Hypochondriums, es enthält den rechten Leberlappen. Dieser Beutel ist in eine suprahepatische Spalte (subphrenischer Raum) und eine subhepatische Spalte (subhepatischer Raum) unterteilt. Die Bursa hepatica wird oben vom Zwerchfell, unten vom Colon transversum und seinem Mesenterium, links vom Ligamentum falciforme der Leber und hinten (in den oberen Abschnitten) vom Koronarband begrenzt. Der Leberschleimbeutel kommuniziert mit dem prägastrischen Schleimbeutel und dem rechten Seitenkanal.
Schleimbeutel prägastrisch(Bursa pregastrica) liegt in der Frontalebene, vor dem Magen und dem Omentum minus. Der rechte Rand dieses Schleimbeutels ist das Ligamentum falciforme der Leber, der linke Rand ist das Ligamentum phrenicolicus. Die obere Wand des Schleimbeutels prägastricus wird vom Zwerchfell gebildet, die untere vom Colon transversum und die vordere Wand von der vorderen Bauchwand. Rechts kommuniziert der Schleimbeutel prägastrisch mit der subhepatischen Fissur und dem Schleimbeutel omentalis, links mit dem linken Seitenkanal.
Omentalbeutel(Bursa omentalis) liegt hinter dem Magen, dem Omentum minus und dem Ligamentum gastrocolicus. Die Bursa omentalis wird oben vom Schwanzlappen der Leber und unten von der hinteren Platte des Omentum majus begrenzt, die mit dem Mesenterium des Colon transversum verschmolzen ist. Auf der Rückseite wird die Bursa omentalis durch das Peritoneum parietalis begrenzt, das die Aorta, die Vena cava inferior, den oberen Pol der linken Niere, die linke Nebenniere und die Bauchspeicheldrüse bedeckt. Der Hohlraum der Bursa omentalis ist ein frontal gelegener Schlitz mit drei Aussparungen (Taschen). Obere Stopfbuchse(Recessus superior omentalis) liegt zwischen dem lumbalen Teil des Zwerchfells hinten und der hinteren Fläche des Schwanzlappens der Leber vorne. Milzaussparung(Recessus splenius lienalis) wird vorne durch das Ligamentum gastrosplenicalis, hinten durch das Ligamentum Zwerchfell-Milz und links durch den Milzhilus begrenzt. Untere Stopfbuchsenaussparung(Recessus inferior omentalis) liegt zwischen dem Lig. gastrocolicus oben und vorne und der hinteren Platte des Omentum majus, die mit dem Mesenterium des Colon transversum verschmolzen ist, dahinter. Die Bursa omentalis kommuniziert mit der Bursa hepatica (subhepatischer Spalt). Drüsenloch(Foramen epiploicum, s.omentale), oder Win-Layer-Loch. Diese 3–4 cm große Öffnung wird nach vorne durch das Ligamentum hepatoduodenale begrenzt, das die Pfortader, die Leberarterie und den Ductus hepaticus communis enthält. Die hintere Wand der Öffnung wird vom parietalen Peritoneum gebildet, das die Vena cava inferior bedeckt. Oben wird die Omentumöffnung durch den Schwanzlappen der Leber begrenzt, unten durch den oberen Teil des Zwölffingerdarms.
Erdgeschoss Die Bauchhöhle befindet sich unter dem Querkolon und seinem Mesenterium. Von unten wird es durch das parietale Peritoneum begrenzt, das den Beckenboden auskleidet. In der unteren Etage der Bauchhöhle befinden sich zwei parakolische Furchen (zwei Seitenkanäle) und zwei Mesenterialhöhlen. Rechter parakolischer Sulcus(Sulcus paracolicus dexter) oder rechter Seitenkanal liegt zwischen der rechten Bauchwand und dem aufsteigenden Dickdarm. Linker parakolischer Sulcus(Sulcus paracolicus sinister) oder linker Seitenkanal, wird durch die linke Bauchdecke und den absteigenden Dickdarm begrenzt. An der hinteren Wand der Bauchhöhle, zwischen dem aufsteigenden Dickdarm rechts und dem absteigenden Dickdarm links, befinden sich zwei Mesenterialnebenhöhlen, deren Grenze durch die Wurzel des Dünndarmgekröses gebildet wird. Die Wurzel des Mesenteriums erstreckt sich von der Höhe des Duodenum-Jejunal-Übergangs links an der Hinterwand der Bauchhöhle bis zur Höhe des Iliosakralgelenks rechts. Rechter Mesenterialsinus(Sinus mesentericus dexter) wird rechts durch den aufsteigenden Dickdarm, oben durch die Wurzel des Mesenteriums des Querkolons, links durch die Wurzel des Mesenteriums des Jejunums und Ileums begrenzt. Innerhalb des rechten Mesenterialsinus der letzte Abschnitt des absteigenden Teils des Zwölffingerdarms und seines horizontalen Teils, der untere Teil des Kopfes der Bauchspeicheldrüse, ein Teil der unteren Hohlvene von der Wurzel des Mesenteriums des Dünndarms unten bis zum Zwölffingerdarm oben, sowie der rechte Harnleiter, Gefäße, Nerven, Lymphknoten liegen retroperitoneal . Der rechte Mesenterialsinus enthält einen Teil der Ileumschlingen. Linker Mesenterialsinus(Sinus mesentericus sinister) wird links durch den absteigenden Dickdarm und das Mesenterium des Sigmas begrenzt, rechts durch die Wurzel des Mesenteriums des Dünndarms. Unterhalb dieses Sinus besteht eine weitreichende Verbindung zur Beckenhöhle. Im linken Sinus mesenterica liegen der aufsteigende Teil des Zwölffingerdarms, die untere Hälfte der linken Niere, der letzte Abschnitt der Bauchaorta, der linke Harnleiter, Gefäße, Nerven und Lymphknoten retroperitoneal; Der Sinus enthält überwiegend Schleifen des Jejunums.
Das parietale Peritoneum, das die hintere Wand der Bauchhöhle auskleidet, weist Vertiefungen (Gruben) auf – mögliche Stellen für die Bildung retroperitonealer Hernien. Oberer und unterer Zwölffingerdarm-Recessus(Recessus duodenales superior et inferior) liegen oberhalb und unterhalb der Flexur duodeni-jejunalis.
Obere und untere Ileozökalrezessionen(Recessus ileocaecalis superior et inferior) liegen oberhalb und unterhalb des Ileocaecal-Übergangs. Unter der Kuppel befindet sich der Blinddarm retrokolische Aussparung(recessus retrocaecalis). Auf der linken Seite der Wurzel des Mesenteriums befindet sich das Sigma intersigmoidaler Recessus(Recessus intersygmoideus).
IN Beckenhöhle Auch das Peritoneum, das auf seine Organe übergeht, bildet Vertiefungen. Bei Männern bedeckt das Peritoneum die vordere Oberfläche des oberen Teils des Rektums, wandert dann nach hinten und dann zur oberen Wand der Blase und setzt sich in das parietale Peritoneum der vorderen Bauchwand fort. Zwischen der Blase und dem Mastdarm befindet sich eine Bauchfelllinie rektovesikaler Recessus(exavacio rectovesicalis). Es ist an den Seiten begrenzt rektovesikale Falten(plicae rectovesicales), die in anteroposteriorer Richtung von den Seitenflächen des Rektums zur Blase verläuft. Bei Frauen verläuft das Peritoneum von der Vorderfläche des Rektums zur Hinterwand des oberen Teils der Vagina, steigt weiter nach oben, bedeckt die Rückseite und dann die Vorderseite der Gebärmutter und der Eileiter und gelangt zur Blase. Zwischen Gebärmutter und Blase gibt es vesikouteriner Recessus(exavacio vesicouterma). Tiefer Rektuterinhöhle(Exavacio rectouterma), oder Douglas-Beutel, befindet sich zwischen der Gebärmutter und dem Rektum. Es ist ebenfalls mit Bauchfell ausgekleidet und an den Seiten begrenzt rektale Gebärmutterfalten(plicae rectoutermae).
1. Embryogenese des Peritoneums.
2. Funktionelle Bedeutung des Peritoneums.
3. Merkmale der Struktur des Peritoneums.
4. Topographie des Peritoneums:
4.1 Obergeschoss.
4.2 Mittlere Etage.
4.3 Erdgeschoss.
Embryogenese des Peritoneums
Durch die Embryonalentwicklung wird die sekundäre Körperhöhle im Allgemeinen in mehrere separate geschlossene seröse Hohlräume unterteilt: So entstehen in der Brusthöhle 2 Pleurahöhlen und 1 Perikardhöhle; in der Bauchhöhle - der Bauchhöhle.
Bei Männern befindet sich zwischen den Hodenhäuten ein weiterer seröser Hohlraum.
Alle diese Hohlräume sind hermetisch verschlossen, mit Ausnahme der Frauen – mit Hilfe der Eileiter während des Eisprungs und der Menstruation kommuniziert die Bauchhöhle mit der Umgebung.
In dieser Vorlesung werden wir auf die Struktur einer solchen serösen Membran wie des Peritoneums eingehen.
PERITONEUM (Peritoneum) ist eine seröse Membran, die in parietale und viszerale Schichten unterteilt ist und die Wände und inneren Organe der Bauchhöhle bedeckt.
Die viszerale Schicht des Peritoneums bedeckt die inneren Organe in der Bauchhöhle. Es gibt verschiedene Arten der Beziehung eines Organs zum Peritoneum bzw. der Abdeckung eines Organs durch das Peritoneum.
Wenn das Organ allseitig mit Bauchfell bedeckt ist, spricht man von einer intraperitonealen Lage (z. B. Dünndarm, Magen, Milz etc.). Wenn das Organ auf drei Seiten vom Peritoneum bedeckt ist, ist die mesoperitoneale Lage gemeint (z. B. Leber, aufsteigender und absteigender Dickdarm). Wenn das Organ auf einer Seite vom Peritoneum bedeckt ist, handelt es sich um eine extraperitoneale oder retroperitoneale Lage (z. B. Nieren, unteres Drittel des Mastdarms usw.).
Das parietale Peritoneum kleidet die Wände der Bauchhöhle aus. In diesem Fall ist es notwendig, die Bauchhöhle abzugrenzen.
Die Bauchhöhle ist der Raum des Körpers, der sich unterhalb des Zwerchfells befindet und mit inneren Organen gefüllt ist, hauptsächlich dem Verdauungs- und Urogenitalsystem.
Die Bauchhöhle hat Wände:
das oberste ist das Zwerchfell
unten - Beckenmembran
hinten - Wirbelsäule und hintere Bauchdecke.
anterolateral – das sind die Bauchmuskeln: Rektus, äußere und innere schräge und quere.
Die Parietalschicht kleidet diese Wände der Bauchhöhle aus, und die Viszeralschicht bedeckt die darin befindlichen inneren Organe, und zwischen der Viszeral- und Parietalschicht des Peritoneums bildet sich ein schmaler Spalt – die PERITONEALHÖHLE.
Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass eine Person über mehrere separate seröse Hohlräume verfügt, einschließlich der Bauchhöhle, die mit serösen Membranen ausgekleidet sind.
Wenn man über seröse Membranen spricht, kommt man nicht umhin, auf ihre funktionelle Bedeutung einzugehen.
Funktionelle Bedeutung des Peritoneums
1. Seröse Membranen verringern die Reibung innerer Organe aneinander, da sie Flüssigkeit absondern, die die Kontaktflächen schmiert.
2. Die seröse Membran hat eine transsudierende und exsudierende Funktion. Das Bauchfell sondert bis zu 70 Liter Flüssigkeit pro Tag ab und die gesamte Flüssigkeit wird im Laufe des Tages vom Bauchfell selbst aufgenommen. Verschiedene Teile des Peritoneums können eine der oben genannten Funktionen erfüllen. So hat das Zwerchfellperitoneum eine überwiegend absorbierende Funktion, die seröse Hülle des Dünndarms hat eine transsudative Fähigkeit, zu den neutralen Bereichen gehören die seröse Hülle der anterolateralen Wand der Bauchhöhle und die seröse Hülle des Magens.
3. Seröse Membranen zeichnen sich durch eine Schutzfunktion aus, weil Sie sind einzigartige Barrieren im Körper: serös-hämolymphatische Barriere (z. B. Peritoneum, Pleura, Perikard), serös-hämolymphatische Barriere (z. B. Omentum majus). In den serösen Membranen ist eine große Anzahl von Fresszellen lokalisiert.
4 Das Peritoneum verfügt über große Regenerationsfähigkeiten: Der beschädigte Bereich der serösen Membran wird zunächst mit einer dünnen Fibrinschicht und dann gleichzeitig im gesamten beschädigten Bereich mit Mesothel bedeckt.
5. Unter dem Einfluss äußerer Reize verändern sich nicht nur die Funktionen, sondern auch die Morphologie der serösen Hülle: Es treten Verwachsungen auf – d.h. seröse Membranen zeichnen sich durch abgrenzende Fähigkeiten aus; aber gleichzeitig können Verwachsungen zu einer Reihe pathologischer Zustände führen, die wiederholte chirurgische Eingriffe erfordern. Und trotz des hohen Entwicklungsstandes der chirurgischen Technologie sind intraperitoneale Adhäsionen häufige Komplikationen, die uns dazu zwangen, diese Krankheit als separate nosologische Einheit – Adhäsionskrankheit – zu unterscheiden.
6. Seröse Membranen sind die Grundlage, in der das Gefäßbett, die Lymphgefäße und eine Vielzahl von Nervenelementen liegen.
Somit ist die seröse Membran ein leistungsstarkes Rezeptorfeld: Die maximale Konzentration von Nervenelementen und insbesondere Rezeptoren pro Flächeneinheit der serösen Membran wird als REFLEXOGENE ZONE bezeichnet. Zu diesen Zonen gehören die Nabelregion, der Ileozökalwinkel mit dem Wurmfortsatz.
7. Die Gesamtfläche des Peritoneums beträgt etwa 2 Quadratmeter. Meter und entspricht der Fläche der Haut.
8. Das Peritoneum erfüllt eine Fixierungsfunktion (befestigt Organe und fixiert sie, bringt sie nach der Verschiebung in ihre ursprüngliche Position zurück).
Das. Seröse Membranen erfüllen mehrere Funktionen:
schützend,
trophisch,
Fixierung
abgrenzen usw.
In der unteren Etage der Bauchhöhle. Es gibt zwei seitliche Peritonealkanäle (rechts und links) und zwei Mesenterial-Mesenterialhöhlen (rechts und links).
Rechter subphrenischer Raum oder rechte Leberschleimbeutel, Bursa hepatica dextra,
Oben und vorne begrenzt durch das Zwerchfell, unten durch die superoposteriore Fläche des rechten Lappens
Leber, hinten - das rechte Koronar- und das rechte Dreiecksband der Leber, links - das Falciforme
Leberband. Innerhalb seiner Grenzen bilden sich häufig sogenannte subphrenische Abszesse, die sich als Komplikationen einer eitrigen Blinddarmentzündung, Cholezystitis, perforierten Magengeschwüren, Zwölffingerdarmgeschwüren usw. entwickeln. Entzündliches Exsudat steigt hier am häufigsten entlang des rechten Seitenkanals aus der rechten Beckengrube oder aus der rechten Fossa iliaca auf subhepatischer Raum am äußeren Rand der Leber.
Der linke subdiaphragmatische Raum besteht aus zwei Abschnitten, die weitläufig miteinander kommunizieren: dem Schleimbeutel prägastrisch, dem linken Schleimbeutel hepatisch,
Der Raum zwischen dem linken Leberlappen unten und dem Zwerchfell oben und vorne, der Bursa hepatica sinistra, wird rechts durch das Ligamentum falciforme, hinten durch den linken Teil des Koronarbandes und das linke Dreiecksband der Leber begrenzt.
Schleimbeutel prägastrisch, Bursa pregastrica,
Hinten begrenzt durch das Omentum minus und den Magen, vorne und oben durch das Zwerchfell, den linken Leberlappen und die vordere Bauchwand und rechts durch die falciformen und runden Bänder der Leber.
Besonderes Augenmerk sollte auf den lateralen Abschnitt der Bursa pregastrica gelegt werden, der sich lateral der großen Magenkrümmung befindet und die Milz enthält. Dieser Abschnitt ist auf das linke und hintere Lig. beschränkt. phrenicolienale, oben - lig. Gastrolien a l und Zwerchfell, unten - lig. phrenicocolicum.
Dieser Raum befindet sich rund um die Milz, wird Blindsack der Milz, Saccus caecus lienis, genannt und kann bei entzündlichen Prozessen vom medialen Abschnitt der Bursa pregastrica abgegrenzt werden.
Der linke Subphrenicusraum ist vom linken Seitenkanal durch ein gut definiertes linkes Zwerchfell-Kolik-Band, Lig., getrennt. phrenicocolicum sinistrum und hat keine freie Kommunikation mit ihm. Abszesse, die im linken Subdiaphragmaraum als Folge von Komplikationen perforierter Magengeschwüre, eitriger Lebererkrankungen usw. entstehen, können sich von links in den blinden Milzsack ausbreiten und von vorne zwischen der Vorderwand des Magens und der oberen absinken Oberfläche des linken Leberlappens bis zum Colon transversum und darunter.
Der subhepatische Raum, Bursa subhepatica, liegt zwischen der Unterseite des rechten Leberlappens und dem Mesokolon mit dem Querkolon, rechts von der Porta hepatis und dem Foramen omentale. Obwohl dieser Raum aus morphologischer Sicht einheitlich ist, kann er pathomorphologisch unterteilt werden
vordere und hintere Abschnitte. Fast die gesamte peritoneale Oberfläche der Gallenblase und die obere Außenfläche des Zwölffingerdarms sind dem vorderen Abschnitt dieses Raums zugewandt. Der hintere Abschnitt, der sich am hinteren Rand der Leber rechts von der Wirbelsäule befindet, ist der am wenigsten zugängliche Bereich unter dem Leberraum – eine Aussparung, die als hepato-renaler Recessus bezeichnet wird. Abszess-
Symptome, die als Folge einer Perforation eines Zwölffingerdarmgeschwürs oder einer eitrigen Cholezystitis auftreten, sind am häufigsten im vorderen Abschnitt lokalisiert; Der periappendizeale Abszess breitet sich hauptsächlich auf den hinteren Teil des subhepatischen Raums aus.
Der Schleimbeutel des Omentalis, Bursa omentalis, liegt hinter dem Magen, sieht aus wie ein Schlitz und ist der isolierteste Raum in der oberen Etage der Bauchhöhle. Der freie Eintritt in die Bursa omentalis ist nur durch die Öffnung des Omentums, das Foramen epiploicum, in der Nähe der Porta hepatis möglich. Es wird vorne durch das Ligamentum hepatoduodenale, lig., begrenzt. hepatoduodenale, hinten - das parietale Peritoneum, das v bedeckt. cava inferior und Ligamentum hepatorenale, lig. hepatorenal; oben - der Schwanzlappen der Leber und unten - das Nieren-Zwölffingerdarm-Band, lig. duodenorenale und Pars superior duodeni. Das Stopfbuchsloch ist unterschiedlich groß. Bei entzündlichen Prozessen kann es geschlossen sein
Es kommt zu Verwachsungen, die zu einer völligen Isolierung des Schleimbeutels omentalis führen.
Die Form des Schleimbeutels omentalis ist sehr komplex und individuell unterschiedlich. Darin kann man die vordere, hintere, obere, untere und linke Wand und rechts das Vestibül der Bursa omentalis unterscheiden.
Das Vestibulum der Bursa omentalis, Vestibulum bursae omentalis, sein ganz rechts gelegener Teil, befindet sich hinter dem Ligamentum hepatoduodenale und wird oben vom Schwanzlappen der Leber und dem ihn bedeckenden Peritoneum, unten vom Zwölffingerdarm und hinten vom parietalen Peritoneum begrenzt die Vena cava inferior.
Die vordere Wand des Schleimbeutels ist das Omentum minus (lig. hepatogastricum und lig. hepatoduodenale), die hintere Wand des Magens und das Lig. hepatoduodenale. Gastrocolicum; hinten - die parietale Schicht des Peritoneums, die hier die Bauchspeicheldrüse, die Aorta, die untere Hohlvene und die Nervengeflechte des oberen Stockwerks der Bauchhöhle bedeckt;
oben - der Schwanzlappen der Leber und teilweise das Zwerchfell; unteres - transversales Mesenterium
Doppelpunkt; links - die Milz und ihre Bänder - lig. gastrolienal et phrenicolienale.
Die Bursa omentalis kann auch der Ort der Bildung eitriger Prozesse aufgrund von perforierten Magengeschwüren, eitrigen Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse usw. sein. In solchen Fällen beschränkt sich der Entzündungsprozess auf die Grenzen der Bursa omentalis und beim Foramen omentalis Wird es von Verwachsungen überwuchert, bleibt es vom Rest der Bauchhöhle isoliert.
Der chirurgische Zugang zur Bursa omentalis erfolgt meist durch Präparation des Lig. gastrocolicum liegt durch das Mesocolon transversum näher an der linken Flexur des Dickdarms.
Der rechte Mesenterialsinus (Sinus mesentericus dexter) liegt rechts von der Wurzel des Mesenteriums; medial und unten wird es durch das Mesenterium des Dünndarms, oben durch das Mesenterium des Colon transversum, rechts durch das Colon aufsteigend begrenzt. Das parietale Peritoneum, das diesen Sinus auskleidet, haftet an der hinteren Bauchwand; Dahinter liegen die rechte Niere, der Harnleiter, Blutgefäße für den Blinddarm und der aufsteigende Teil des Dickdarms.
Der linke Sinus mesenterica (Sinus mesentericus sinister) ist etwas länger als der rechte. Seine Grenzen: oben - das Mesenterium des Colon transversum (Höhe des II. Lendenwirbels), seitlich - der absteigende Teil des Dickdarms und das Mesenterium des Sigmas, medial - das Mesenterium des Dünndarms. Der linke Sinus hat keinen unteren Rand und setzt sich in die Beckenhöhle fort. Unter dem parietalen Peritoneum verlaufen die Aorta, Venen und Arterien zum Rektum, Sigma und zum absteigenden Teil des Dickdarms. Dort befinden sich auch der linke Harnleiter und der untere Nierenpol.
Im mittleren Boden der Bauchhöhle werden der rechte und der linke Seitenkanal unterschieden.
Der rechte Seitenkanal (Canalis lateralis dexter) ist ein schmaler Spalt, der durch die Seitenwand des Bauches und den aufsteigenden Teil des Dickdarms begrenzt wird. Von oben führt der Kanal weiter in die Leberschleimbeutel (Bursa hepatica) und von unten durch die Beckengrube kommuniziert er mit dem unteren Boden der Bauchhöhle (Beckenhöhle).
Der linke Seitenkanal (Canalis lateralis sinister) liegt zwischen der Seitenwand und dem absteigenden Dickdarm. Nach oben wird er durch das Lig. phrenicocolicum dextrum begrenzt, nach unten mündet der Kanal in die Fossa iliaca.
Im mittleren Boden der Bauchhöhle befinden sich zahlreiche Vertiefungen, die durch Falten des Bauchfells und der Organe gebildet werden. Die tiefsten von ihnen befinden sich in der Nähe des Anfangs des Jejunums, des Endteils des Ileums, des Blinddarms und im Mesenterium des Sigmas. Wir beschreiben hier nur die Taschen, die ständig auftreten und klar definiert sind.
Der Zwölffingerdarm-Jejunal-Recessus (Recessus duodenojejunalis) wird durch die Peritonealfalte der Wurzel des Mesenteriums des Dickdarms und die Flexura duodenojejunalis begrenzt. Die Tiefe der Vertiefung beträgt 1 bis 4 cm. Charakteristisch ist, dass die Falte des Peritoneums, die diese Vertiefung begrenzt, glatte Muskelbündel enthält.
Der obere Ileozökal-Recessus (Recessus ileocecalis superior) befindet sich in der oberen Ecke, die vom Blinddarm und dem Endabschnitt des Jejunums gebildet wird. Diese Depression äußert sich in 75 % der Fälle deutlich.
Der untere Ileozökal-Recessus (Recessus ileocecalis inferior) befindet sich in der unteren Ecke zwischen Jejunum und Blinddarm. Auf der lateralen Seite wird er zusätzlich durch den Wurmfortsatz samt Mesenterium begrenzt. Die Tiefe der Aussparung beträgt 3-8 cm.
Der postkolische Recessus (Recessus retrocecalis) ist instabil, entsteht durch Falten beim Übergang des parietalen Peritoneums zum viszeralen und befindet sich hinter dem Blinddarm. Die Tiefe der Aussparung liegt zwischen 1 und 11 cm, abhängig von der Länge des Blinddarms.
Der Recessus intersigmoideus (Recessus intersigmoideus) befindet sich im Mesenterium des Sigmas links.
Um komplexe Zusammenhänge leichter erfassen zu können, kann die gesamte Bauchhöhle in drei Bereiche bzw. Etagen unterteilt werden:
1. Das Obergeschoss wird oben durch das Zwerchfell, unten durch das Mesenterium des Colon transversum, Mesocolon transversum, begrenzt;
2. die mittlere Etage erstreckt sich vom Mesocolon transversum bis zum Eingang des kleinen Beckens;
3. Die untere Etage beginnt an der Eintrittslinie in das kleine Becken und entspricht der Beckenhöhle, die nach unten in die Bauchhöhle endet.
Der obere Boden der Bauchhöhle ist in drei Beutel unterteilt: Bursa hepatica, Bursa pregastrica und Bursa omentalis. Bursa hepatica bedeckt den rechten Leberlappen und ist durch Lig. von der Bursa pregastrica getrennt. Falciforme Hepatis; hinten wird es durch lig begrenzt. Coronarium hepatis. In der Tiefe der Bursa hepatica, unter der Leber, ist das obere Ende der rechten Niere mit der Nebenniere zu ertasten. Bursa pregastrica bedeckt den linken Leberlappen, die Vorderfläche des Magens und die Milz; der linke Teil des Koronarbandes verläuft entlang der Hinterkante des linken Leberlappens; Die Milz ist allseitig vom Peritoneum bedeckt, und nur im Bereich des Hilus gelangt ihr Peritoneum von der Milz zum Magen und bildet Lig. gastrolienale und auf dem Zwerchfell - lig. phrenicolenale.
Bursa omentalis, Bursa omentalis, ist ein Teil der allgemeinen Höhle des Peritoneums, der hinter dem Magen und dem Omentum minus liegt. Das Omentum minus, Omentum minus, umfasst, wie bereits erwähnt, zwei Peritonealbänder: lig. hepatogastricum, das von der viszeralen Oberfläche und dem Tor der Leber bis zur kleinen Kurvatur des Magens reicht, und lig. hepatoduodenale, der die Porta hepatis mit der Pars superior duodeni verbindet. Zwischen den Blättern lig. hepatoduodenale verlaufen durch den Ductus choledochus (rechts), die Arteria hepatica communis (links) und die Pfortader (hinter und zwischen diesen Formationen) sowie durch Lymphgefäße, Knoten und Nerven.
Die Höhle der Bursa omentalis kommuniziert mit der allgemeinen Höhle des Peritoneums nur durch das relativ schmale Foramen epipldicum. Das Foramen epiploicum wird nach oben durch den Schwanzlappen der Leber, nach vorne durch den freien Rand des Lig. begrenzt. hepatoduodenale, von unten - durch den oberen Teil des Zwölffingerdarms, von hinten - durch ein Peritoneumblatt, das die hier verlaufende untere Hohlvene bedeckt, und weiter nach außen - durch ein Band, das vom hinteren Rand der Leber zur rechten Niere verläuft, lig . hepatorenal. Der Teil der Bursa omentalis, der direkt an die Öffnung des Omentums angrenzt und sich hinter dem Lig. lig. hepatoduodenale, wird Vestibül genannt - Vestibulum bursae omentalis; Von oben wird es durch den Schwanzlappen der Leber und von unten durch den Zwölffingerdarm und den Pankreaskopf begrenzt. Die obere Wand der Bursa omentalis ist die untere Oberfläche des Schwanzlappens der Leber, und der Processus papillaris hängt in der Bursa selbst. Die parietale Schicht des Peritoneums, die die hintere Wand der Bursa omentalis bildet, bedeckt die hier befindliche Aorta, die Vena cava inferior, die Bauchspeicheldrüse, die linke Niere und die Nebenniere. Entlang der Vorderkante der Bauchspeicheldrüse erstreckt sich die parietale Schicht des Peritoneums von der Bauchspeicheldrüse und setzt sich nach vorne und unten fort, während sich die vordere Schicht des Mesocolon transversum oder, genauer gesagt, die hintere Platte des Omentum majus, die mit dem Mesocolon transversum verschmolzen ist, bildet die untere Wand der Bursa omentalis.
Die linke Wand der Bursa omentalis besteht aus Bändern der Milz: gastrosplenal, lig. gastrolienale und phrenic-milz, lig. phrenicosplenicum.
18. Topographie des Peritoneums der mittleren und unteren Etage der Bauchhöhle. Großes Siegel.
Der mittlere Boden der Bauchhöhle wird sichtbar, wenn das Omentum majus und das Colon transversum nach oben gehoben werden. Mit dem aufsteigenden und absteigenden Dickdarm an den Seiten und dem Mesenterium des Dünndarms in der Mitte als Grenzen kann er in vier Abschnitte unterteilt werden: Zwischen den Seitenwänden des Bauches und dem Dickdarm aufsteigend und absteigend befinden sich der rechte und der linke Seitenkanäle, Kerzen laterales dexter et sinister; Der vom Dickdarm bedeckte Raum wird durch das Mesenterium des Dünndarms, das schräg von oben nach unten und von links nach rechts verläuft, in zwei Mesenterialsinus unterteilt, Sinus mesentericus dexter und Sinus mesentericus sinister.
Das große Omentum, Omentum majus, hängt in Form einer Schürze vom Colon transversum herab und bedeckt die Schlingen des Dünndarms mehr oder weniger; Seinen Namen verdankt es dem darin enthaltenen Fett. Es besteht aus 4 Schichten Peritoneum, die in Form von Platten verschmolzen sind. Die vordere Platte des Omentum majus besteht aus zwei Schichten des Peritoneums, die sich von der großen Kurvatur des Magens nach unten erstrecken und vor dem Colon transversum verlaufen, mit dem sie zusammenwachsen, und dem Übergang des Peritoneums vom Magen zum Colon transversum heißt lig. Gastrocolicum. Diese beiden Blätter des Omentums können vor den Dünndarmschlingen fast bis zur Höhe der Schambeinknochen herabsinken, dann biegen sie sich in die hintere Platte des Omentums, so dass die gesamte Dicke des Omentum majus aus vier Blättern besteht ; Die Omentumblätter verschmelzen normalerweise nicht mit den Dünndarmschlingen. Zwischen den Blättern der vorderen Platte des Omentums und den hinteren Blättern befindet sich eine schlitzartige Höhle, die oben mit der Höhle der Bursa omentalis in Verbindung steht. Bei einem Erwachsenen wachsen die Blätter jedoch normalerweise miteinander zusammen, so dass die Die Höhle des Omentum majus ist großflächig verödet. Entlang der großen Krümmung des Magens setzt sich die Höhle bei Erwachsenen manchmal mehr oder weniger weit zwischen den Blättern des Omentum majus fort.
In der Dicke des Omentum majus befinden sich Lymphknoten, Nodi lymphatici omentales, die die Lymphe aus dem Omentum majus und dem Colon transversum ableiten.
Das Mesenterium, Mesenterium, ist eine aus zwei Schichten Peritoneum bestehende Falte, durch die der Dünndarm an der hinteren Bauchwand befestigt ist. Der hintere Rand des Mesenteriums, der an der Bauchdecke befestigt ist, bildet die Wurzel des Mesenteriums, Radix mesenterii. Es ist relativ kurz (15–17 cm), während der gegenüberliegende freie Rand, der den mesenterischen Teil des Dünndarms (Jejunum und Ileum) bedeckt, gleich der Länge dieser beiden Abschnitte ist. Die Befestigungslinie der Mesenterialwurzel verläuft schräg: von der linken Seite des II. Lendenwirbels zur rechten Fossa iliaca und überquert dabei den letzten Abschnitt des Zwölffingerdarms, die Aorta, die Vena cava inferior, den rechten Harnleiter und m . Psoas Major. Die Wurzel des Mesenteriums ändert aufgrund von Veränderungen im Verlauf des Darmrohrs und dem Wachstum der umgebenden Organe ihre Richtung von vertikal in der Embryonalperiode zu schräg zum Zeitpunkt der Geburt. In der Dicke des Mesenteriums verlaufen zwischen den Fasern, die mehr oder weniger Fettgewebe enthalten, Blutgefäße, Nerven und Lymphgefäße mit Lymphknoten zwischen den beiden serösen Schichten.
Auf der hinteren Parietalschicht des Peritoneums befinden sich eine Reihe von Peritonealgruben, die von praktischer Bedeutung sind, da sie als Ort für die Bildung retroperitonealer Hernien dienen können. An der Verbindung von Zwölffingerdarm und Jejunum bilden sich kleine Vertiefungen – Vertiefungen, Recessus duodenalis superior und inferior. Diese Gruben werden rechts durch die Biegung des Darmrohrs, Flexura duodenojejunalis, begrenzt, links durch die Falte des Peritoneums, Plica duodenojejunalis, die von der Spitze der Biegung bis zur hinteren Bauchwand des Abdomens unmittelbar darunter verläuft Körper der Bauchspeicheldrüse und enthält v. Mesenterica inferior.
Im Bereich des Übergangs vom Dünndarm zum Dickdarm befinden sich zwei Tüpfel: Recessus ileocaecalis inferior et superior, unterhalb und oberhalb von Plica ileocaecalis, die vom Ileum zur medialen Oberfläche des Blinddarms verlaufen.
Die Vertiefung in der Scheitelschicht des Peritoneums, in der der Blinddarm liegt, wird als Fossa des Blinddarms bezeichnet und macht sich bemerkbar, wenn der Blinddarm und der nächstgelegene Abschnitt des Ileums nach oben gezogen werden. Die resultierende Falte des Peritoneums zwischen der Oberfläche von m. Iliacus und die Seitenfläche des Caecums werden Plica caecalis genannt. Hinter dem Blinddarm, in der Fossa des Blinddarms, gibt es manchmal eine kleine Öffnung, die zum Recessus retrocaecalis führt und sich zwischen der hinteren Bauchwand und dem Colon Ascendens nach oben erstreckt. Auf der linken Seite befindet sich ein Recessus intersigmoideus; Diese Fossa ist auf der unteren (linken) Oberfläche des Mesenteriums des Sigmas sichtbar, wenn sie nach oben gezogen wird. Seitlich des absteigenden Dickdarms befinden sich manchmal Peritonealtaschen – Sulci paracolici. Oben, zwischen dem Zwerchfell und der Flexiira coli sinistra, erstreckt sich eine Falte des Peritoneums, lig. Phrenicocolicum; Er befindet sich knapp unter dem unteren Ende der Milz und wird auch Milzsack genannt.
Erdgeschoss. Beim Abstieg in die Beckenhöhle bedeckt das Peritoneum seine Wände und die darin liegenden Organe, einschließlich der Urogenitalorgane, sodass die Beziehungen des Peritoneums hier vom Geschlecht abhängen. Der Beckenabschnitt des Sigmas und der Anfang des Rektums sind allseitig mit Peritoneum bedeckt und verfügen über ein Mesenterium (intraperitoneal gelegen).
Der mittlere Abschnitt des Rektums ist nur von der Vorder- und Seitenfläche her vom Peritoneum bedeckt (mesoperitoneal), der untere Abschnitt ist nicht davon bedeckt (extraperitoneal). Das Peritoneum verläuft bei Männern von der Vorderfläche des Rektums zur Hinterfläche der Blase und bildet eine Vertiefung hinter der Blase, die Excavatio rectovesicalis. Bei ungefüllter Blase bildet das Peritoneum auf seiner superoposterioren Oberfläche eine Querfalte, Plica vesicalis transversa, die sich bei gefüllter Blase glättet. Bei Frauen ist der Verlauf des Bauchfells im Becken unterschiedlich, da sich zwischen Blase und Mastdarm die Gebärmutter befindet, die ebenfalls mit Bauchfell bedeckt ist. Infolgedessen gibt es in der Beckenhöhle bei Frauen zwei Peritonealtaschen: Excavatio rectouterina – zwischen Rektum und Gebärmutter und Excavatio vesicouterina – zwischen Gebärmutter und Blase.
Bei beiden Geschlechtern gibt es einen prävesikalen Raum, Spatium prevesicale, der vorne von der Fascia transversalis gebildet wird, die die quer verlaufenden Bauchmuskeln hinten bedeckt, und hinten von der Blase und dem Peritoneum. Wenn die Blase gefüllt ist, bewegt sich das Peritoneum nach oben und die Blase grenzt an die vordere Bauchwand an, sodass die Blase während der Operation durch ihre vordere Wand durchdrungen werden kann, ohne das Peritoneum zu beschädigen. Das parietale Peritoneum wird von den parietalen Gefäßen und Nerven vaskularisiert und innerviert, und das viszerale Peritoneum wird von den Gefäßen und Nerven versorgt, die sich in den vom Peritoneum bedeckten Organen verzweigen.
19. Retroperitonealer Raum: darin befindliche Organe, Lymphknoten.
Der Retroperitonealraum (Retroperitonealraum, lat. spatium retroperitoneale) ist ein Zellraum, der durch den hinteren Teil des parietalen Peritoneums und der intraabdominalen Faszie begrenzt wird; erstreckt sich vom Zwerchfell bis zum Becken.
Der retroperitoneale Raum enthält die Nieren, Nebennieren und Harnleiter, die Bauchspeicheldrüse, die absteigenden und horizontalen Teile des Zwölffingerdarms, den aufsteigenden und absteigenden Dickdarm, die Bauchaorta, die untere Hohlvene und ihre Äste, die Wurzeln der Azygos- und Semi-Gypsy-Venen, die sympathischen Stämme, autonome Nervengeflechte und Äste, Plexus lumbalis, Lymphknoten, Beginn des Ductus thoracicus. Die Organe des Retroperitonealraums sind von Fettgewebe umgeben.
20. Nasenhöhle (Riech- und Atmungsbereich), Blutversorgung und Innervation ihrer Schleimhaut.
Um mit dem empfindlichen Gewebe der Lunge in Kontakt zu kommen, muss die eingeatmete Luft entstaubt, erwärmt und befeuchtet werden. Dies geschieht in der Nasenhöhle, der Cavitas nasi; Darüber hinaus gibt es eine äußere Nase, Nasus externus, die teilweise aus einem Knochenskelett und teilweise aus Knorpel besteht. Wie im Abschnitt zur Osteologie erwähnt, wird die Nasenhöhle durch die Nasenscheidewand, Septum nasi (Knochen hinten und Knorpel vorne), in zwei symmetrische Hälften geteilt, die durch die äußere Nase über die Nasenlöcher mit der Atmosphäre vorne kommunizieren und hinten mit dem Rachen durch die Choanen. Die Wände der Höhle sind zusammen mit Septum und Muscheln mit einer Schleimhaut ausgekleidet, die im Bereich der Nasenlöcher mit der Haut verschmilzt und hinten in die Schleimhaut des Rachens übergeht.
Die Nasenschleimhaut (griech. Rhinos – Nase; daher Rhinitis – Entzündung der Schleimhaut der Nasenhöhle) enthält eine Reihe von Vorrichtungen zur Aufbereitung der eingeatmeten Luft. Erstens ist es mit Flimmerepithel bedeckt, dessen Flimmerhärchen einen durchgehenden Teppich bilden, auf dem sich Staub ablagert. Durch das Flimmern der Flimmerhärchen wird festgesetzter Staub aus der Nasenhöhle ausgestoßen. Zweitens enthält die Schleimhaut Schleimdrüsen, Glandulae nasi, deren Sekret den Staub umhüllt und dessen Ausstoß fördert sowie die Luft befeuchtet. Drittens ist die Schleimhaut reich an venösen Gefäßen, die an der unteren Concha und am unteren Rand der mittleren Concha dichte Plexus ähnlich den Schwellkörpern bilden, die unter verschiedenen Bedingungen anschwellen können; Schäden an ihnen verursachen Nasenbluten. Die Bedeutung dieser Formationen besteht darin, den durch die Nase strömenden Luftstrom zu erwärmen.
Die beschriebenen Schleimhautgeräte, die der mechanischen Luftaufbereitung dienen, befinden sich auf Höhe der mittleren und unteren Nasenmuscheln und Nasengänge. Dieser Teil der Nasenhöhle wird daher Atemhöhle, Regio Respiratoria, genannt. Im oberen Teil der Nasenhöhle, auf Höhe der oberen Muschel, befindet sich eine Vorrichtung zur Steuerung der eingeatmeten Luft in Form eines Geruchsorgans, daher wird der obere Teil der Nasenhöhle als Riechregion, Regio, bezeichnet Olfaktorien. Hier befinden sich die peripheren Nervenenden des Riechnervs – Riechzellen, die den Rezeptor des Riechanalysators bilden.
Ein zusätzliches Gerät zur Luftbeatmung sind die ebenfalls mit Schleimhaut ausgekleideten Nasennebenhöhlen, Sinus paranasales, die eine direkte Fortsetzung der Nasenschleimhaut darstellen. Diese werden in „Osteologie“ beschrieben:
1. Kieferhöhle (Oberkieferhöhle), Sinus maxillaris; die weite Öffnung der Kieferhöhle am skelettierten Schädel ist bis auf einen kleinen Spalt durch die Schleimhaut verschlossen;
2. Stirnhöhle, Sinus frontalis;
3. Zellen des Siebbeinknochens, Cellulae ethmoidales, die den Sinus ethmoidalis als Ganzes bilden;
4. Keilbeinhöhle, Sinus sphenoidalis.
Bei der Untersuchung der Nasenhöhle eines lebenden Menschen (Rhinoskopie) ist die Schleimhaut rosa gefärbt. Sichtbar sind die Nasenmuscheln, Nasengänge, Siebbeinzellen und Öffnungen der Stirn- und Kieferhöhlen. Das Vorhandensein von Nasenmuscheln und Nasennebenhöhlen vergrößert die Oberfläche der Schleimhaut, deren Kontakt zu einer besseren Verarbeitung der eingeatmeten Luft beiträgt. Die für die Atmung notwendige freie Luftzirkulation wird durch die Starrheit der Wände der Nasenhöhle gewährleistet, die aus Knochen (siehe „Osteologie“) bestehen und durch hyaliner Knorpel ergänzt werden.
Die Nasenknorpel sind Reste der Nasenkapsel und bilden paarweise die Seitenwände (Seitenknorpel, Cartilagines nasi laterales), die Nasenflügel, die Nasenlöcher und den beweglichen Teil des Nasennebenhöhlen, Öffnungen (Cartilagines alares majores). et Minores) sowie die Nasenscheidewand – der ungepaarte Knorpel der Nasenscheidewand (Cartilago septi nasi). Die mit Haut bedeckten Knochen und Knorpel der Nase bilden die äußere Nase, den Nasus externus. Man unterscheidet zwischen der Nasenwurzel, dem Radix nasi, die sich oben befindet, der Nasenspitze, dem Apex nasi, die nach unten gerichtet ist, und zwei seitlichen Seiten, die entlang der Mittellinie zusammenlaufen und den nach vorne gerichteten Dorsum nasi bilden. Die durch Rillen getrennten unteren Teile der Nasenseiten bilden die Nasenflügel, Alae nasi, die mit ihren Unterkanten die Nasenlöcher begrenzen, die dazu dienen, Luft in die Nasenhöhle zu leiten. Die Nasenlöcher des Menschen sind im Gegensatz zu allen Tieren, einschließlich Primaten, nicht nach vorne gerichtet, wie bei ihnen, sondern nach unten. Dadurch wird der Strom der eingeatmeten Luft nicht wie bei Affen direkt zurück, sondern nach oben in die Riechregion geleitet und bildet einen langen, bogenförmigen Weg zum Nasopharynx, was die Luftverarbeitung erleichtert. Die ausgeatmete Luft strömt geradlinig durch den unteren Nasengang.
Eine hervorstehende äußere Nase ist ein spezifisches Merkmal des Menschen, da die Nase auch bei Affen fehlt, was offenbar auf die vertikale Position des menschlichen Körpers und auf Veränderungen des Gesichtsskeletts zurückzuführen ist, die zum einen durch die Schwächung des Gesichtsschädels verursacht werden die Kaufunktion und zum anderen durch die Sprachentwicklung.
Die Hauptarterie, die die Wände der Nasenhöhle versorgt, ist a. Sphenopalatin (aus A. maxillaris). Im vorderen Teil der Höhle ein Ast. ethmoidales anterior et posterior (von a. ophthalmica). Die Venen der äußeren Nase verbinden sich v. facialis und v. Ophthalmika. Der Abfluss von venösem Blut aus der Schleimhaut der Nasenhöhle erfolgt in v. Sphenopalatin, fließt durch die gleichnamige Öffnung in den Plexus pterygoideus. Lymphgefäße von der äußeren Nase und den Nasenlöchern transportieren ihre Lymphe zu den submandibulären, maxillären und mentalen Lymphknoten.
Die Nerven sowohl der äußeren Nase als auch der Nasenhöhle gehören zum Verzweigungsgebiet des ersten und zweiten Astes des Trigeminusnervs. Die Schleimhaut des vorderen Teils der Nasenhöhle wird von n innerviert. ethmoidalis anterior (vom N. nasociliaris des ersten Astes des N. trigeminus), der Rest davon – die Conchae und das Nasenseptum – werden vom Ganglion pterygopalatmum, dem zweiten Ast des Trigeminusnervs (nn. nasales posteriores) und n. ethmoidalis anterior innerviert. Nasopalatin.
Aus der Nasenhöhle gelangt die eingeatmete Luft durch die Choanen in den Nasopharynx, dann in den Mundraum des Rachens und dann in den Kehlkopf. Das Atmen ist auch über ein Horn möglich, allerdings führt das Fehlen von Vorrichtungen in der Mundhöhle zur Steuerung und Aufbereitung der Luft zu häufigen Erkrankungen bei Mundatmern. Daher ist darauf zu achten, dass die Atmung durch die Nase erfolgt.
21. Kehlkopf: Struktur, Topographie, Funktionen. Seine Blutversorgung und Innervation.
Der Kehlkopf, Kehlkopf, befindet sich auf Höhe der Halswirbel IV, V und VI, unmittelbar unterhalb des Zungenbeins, an der Vorderseite des Halses und bildet hier eine durch die äußere Haut deutlich sichtbare Erhebung. Dahinter liegt der Pharynx, mit dem der Kehlkopf über eine Öffnung, den sogenannten Kehlkopfeingang, Aditus laryngis, in direkter Verbindung steht. An den Seiten des Kehlkopfes befinden sich große Blutgefäße des Halses, und vorn ist der Kehlkopf mit den Muskeln bedeckt, die sich unterhalb des Zungenbeins befinden (mm. sternohyoidei, sternothyroidei, omohyoidei), der Halsfaszie und den oberen Teilen der lateralen Lappen der Schilddrüse. Unten geht der Kehlkopf in die Luftröhre über.
Der menschliche Kehlkopf ist ein erstaunliches Musikinstrument, das einer Kombination aus Blas- und Saiteninstrumenten gleicht. Die durch den Kehlkopf ausgeatmete Luft versetzt die wie Saiten gespannten Stimmbänder in Schwingung, wodurch ein Ton entsteht. Anders als bei Musikinstrumenten werden im Kehlkopf der Grad der Spannung der Saiten sowie die Größe und Form des Hohlraums, in dem die Luft zirkuliert, gesteuert, was durch Kontraktion der Muskeln der Mundhöhle, der Zunge, des Rachens und des Kehlkopfs selbst erreicht wird durch das Nervensystem. Darin unterscheidet sich der Mensch vom Menschenaffen, der völlig unfähig ist, den zum Singen und Sprechen notwendigen Ausatemluftstrom zu regulieren. Nur der Gibbon ist bis zu einem gewissen Grad in der Lage, mit seiner Stimme („Gibbon-Skala“) musikalische Laute zu erzeugen. Darüber hinaus verfügen Affen über stark ausgeprägte „Stimmbeutel“, die unter die Haut reichen und als Resonanzkörper dienen. Beim Menschen handelt es sich um rudimentäre Gebilde (Kehlkopfventrikel). Es dauerte Jahrtausende, bis sich der unentwickelte Kehlkopf eines Affen durch allmählich verstärkte Modulationen in den menschlichen Kehlkopf verwandelte und „die Organe des Mundes nach und nach lernten, einen artikulierten Laut nach dem anderen auszusprechen“ (Marx K. und Engels F. Soch., 2. Aufl., Bd. 20, S. 489).
Als eine Art Musikinstrument ist der Kehlkopf gleichzeitig nach dem Prinzip eines Bewegungsapparates aufgebaut, daher kann man ein Skelett in Form von Knorpel, seine Verbindungen in Form von Bändern und Gelenken sowie Muskeln unterscheiden bewegen die Knorpel, wodurch sich die Größe der Stimmritze und der Grad der Spannung der Stimmbänder verändern.
Kehlkopfknorpel.
Der Ringknorpel, Cartilago cricoidea, hyaline, hat die Form eines Rings, bestehend aus einer breiten Platte, Lamina, hinten und einem Bogen, Arcus, vorne und an den Seiten. Am Rand der Platte und an ihrer Seitenfläche befinden sich Gelenkplattformen zur Artikulation mit dem Aryknorpel und dem Schildknorpel.
Schildknorpel, Cartilago thyroidea, der größte der Kehlkopfknorpel, hyaline, besteht aus zwei Platten, Laminae, die nach vorne in einem Winkel verschmolzen sind. Bei Kindern und Frauen sind diese Platten abgerundet, sodass sie keinen so kantigen Vorsprung haben wie bei erwachsenen Männern (Adamsapfel). Am oberen Rand entlang der Mittellinie befindet sich eine Kerbe – Incisura thyroidea superior. Der hintere verdickte Rand jeder Platte setzt sich in das obere Horn, Cornu superius, größer, und das untere Horn, Cornu inferius, kürzer, fort; Letzterer hat an der Spitze von innen eine Plattform zur Artikulation mit dem Ringknorpel. Auf der Außenfläche jeder Platte des Schildknorpels ist eine schräge Linie, Linea obliqua (Befestigungsort von M. sternothyroideus und M. thyrohyoideus), erkennbar.
Die Aryknorpel, Cartilagines arytenofdeae, stehen in direktem Zusammenhang mit den Stimmbändern und Muskeln. Sie ähneln Pyramiden, deren Basis sich am oberen Rand der Lamina cricoidea befindet und deren Spitze nach oben gerichtet ist. Die anterolaterale Fläche ist am ausgedehntesten.
Es liegen zwei Prozesse zugrunde:
1. anterior (aus elastischem Knorpel) dient als Befestigungspunkt für die Stimmlippe und wird daher Processus Vocalis (Stimme) genannt
2. seitlich (aus hyalinem Knorpel) zur Befestigung von Muskeln, Processus muscularis.
In der Dicke der Plica aryepiglottica befinden sich Hornknorpel, Cartilagines corniculatae (an den Spitzen der Aryknorpel) und davor keilförmige Knorpel - Cartilagines cuneiformes.
Epiglottis-Knorpel, Epiglottis s. Cartilago epiglottica ist eine blattförmige Platte aus elastischem Knorpelgewebe, die vor dem Aditus laryngis und direkt hinter der Zungenbasis platziert ist. Nach unten hin verengt es sich und bildet den Stiel der Epiglottis, Petiolus epiglottitis. Das gegenüberliegende breite Ende ist nach oben gerichtet. Die dem Kehlkopf zugewandte konvex-konkave Rückenfläche ist über ihre gesamte Länge mit einer Schleimhaut bedeckt; Der untere konvexe Teil ragt in die Kehlkopfhöhle zurück und wird Lubcrcul/um epiglbtticum genannt. Die der Zunge zugewandte vordere oder ventrale Oberfläche ist nur im oberen Teil frei von Bändern.
Bänder und Gelenke des Kehlkopfes
Der Kehlkopf ist mit Hilfe der Membrana thyrohyoidea sozusagen am Zungenbein aufgehängt, zwischen ihm und der Oberkante des Schildknorpels gespannt, bestehend aus einem ungepaarten Band, Tig. Thyrohyoldeum medianum und paarige Bänder, ligg. Thyrohyoidea lateralia, gespannt zwischen den Enden der großen Hörner des Zungenbeins und den oberen Hörnern des Schildknorpels, in deren Dicke ein kleiner körniger Knorpel, Cartilago triticea, zu spüren ist. Die Epiglottis ist auch mit dem Zungenbein verbunden, das über das Band mit ihr verbunden ist. hyoepig!6tticum und mit Schildknorpel lig. Thyroepiglotticum.
Zwischen dem Bogen des Ringknorpels und dem Rand des Schildknorpels erstreckt sich entlang der Mittellinie ein starkes Band – Lig. Cricothyrofdeum, bestehend aus elastischen Fasern. Die seitlichen Fasern dieses Bandes verlaufen ausgehend vom oberen Rand des Ringknorpels nach medial und verbinden sich nach hinten mit dem Cartilago arythenoidea; diese Bündel zusammen mit lig. cricothyroideum bilden einen sich nach oben verjüngenden Conus elasticus, dessen oberer freier Rand die Stimmlippe darstellt. Lig. Vocale, Stimmband, ist vorne am Winkel des Schildknorpels in unmittelbarer Nähe zum gleichen Band auf der gegenüberliegenden Seite befestigt, hinten am Processus Vocalis des Aryknorpels. Das Band besteht aus gelblichen elastischen Fasern, die parallel zueinander verlaufen. Auch bei Kindern und Jugendlichen gibt es sich kreuzende elastische Fasern, die bei Erwachsenen verschwinden. Der mediale Rand des Stimmbandes ist spitz und frei, seitlich und nach unten geht das Band direkt in den Conus elasticus über (siehe Abb. 154).
Zusätzlich zu den Bändern gibt es auch Gelenke zwischen den Kehlkopfknorpeln am Übergang von Schilddrüse und Aryknorpel zum Ringknorpel.
1. Zwischen den unteren Hörnern des Schildknorpels und dem Ringknorpel wird ein paariges kombiniertes Gelenk gebildet, Art.-Nr. cricothyroidea, mit quer verlaufender Rotationsachse. Der Schildknorpel in diesem Gelenk bewegt sich hin und her, entfernt sich von den Aryknorpeln oder nähert sich ihnen, wodurch sich das dazwischen liegende Stimmband, das Ligamentum Vocale, entweder streckt (wenn der Schildknorpel nach vorne kippt) oder sich entspannt.
2. Zwischen der Basis jedes Aryknorpels und dem Ringknorpel befinden sich paarige Gelenke. cricoaryfenoideae mit einer vertikalen Achse, um die sich der hervorstehende Knorpel der Schaufel seitlich dreht.
Auch hier sind Gleitbewegungen möglich – Annäherung und Entfernung der Aryknorpel zueinander.
Die Muskeln des Kehlkopfes (Abb. 155), die die Knorpel des Kehlkopfes bewegen, verändern die Breite seiner Höhle und der durch die Stimmbänder begrenzten Stimmritze sowie die Spannung der Stimmbänder.
Entsprechend ihrer Funktion lassen sie sich daher in folgende Gruppen einteilen:
1. Würgeschlangen
2. Dilatatoren
Einige Muskeln können aufgrund ihrer gemischten Natur in beide Gruppen eingeteilt werden. Sie alle bestehen aus quergestreiftem, willkürlichem Muskelgewebe.
Zu den Muskeln der ersten Gruppe gehören:
1. m. cricoarytenoideus lateralis; beginnt am Bogen des Ringknorpels, verläuft nach oben und hinten und setzt am Processus muscularis des Aryknorpels an. Zieht den Processus muscularis nach vorne und unten, wodurch sich der Processus Vocalis nach medial dreht, die Stimmbänder näher zusammenrücken und der Abstand zwischen ihnen kleiner wird (die Stimmbänder werden etwas angespannt);
2. m. Thyroarytenoideus ist ein quadratischer Muskel. Es beginnt an der Innenfläche der Schildknorpelplatten und setzt am Processus muscularis des Aryle an. Wenn sich die Muskeln beider Seiten zusammenziehen, verengt sich der Teil der Kehlkopfhöhle unmittelbar über den Stimmbändern, die Regio supraglottica, gleichzeitig wird der Processus Vocalis nach ventral gezogen, wodurch sich die Stimmbänder etwas entspannen;
3. M. arytenoideus transversus - ungepaarter Muskel, liegt auf den dorsalen konkaven Flächen der Aryknorpel und überträgt sich von einem zum anderen. Bei seiner Kontraktion bringt es die Aryknorpel näher zusammen und verengt so die Rückseite der Stimmritze;
4,mm. arytenoidei obliqui stellen ein Paar Muskelbündel dar, die direkt hinter dem M. liegen. transversus und schneiden sich in einem spitzen Winkel. Als Fortsetzung des schrägen Muskels beginnen an der Spitze des Aryknorpels neue Muskelbündel, die am Rand der Epiglottis ansetzen und m bilden. aryepiglotticus. Mm. arytenoidei obliqui und aryepiglottici verengen bei gleichzeitiger Kontraktion den Eingang zum Kehlkopf und zum Vestibül des Kehlkopfes. M. aryepiglotticus zieht auch die Epiglottis nach unten.
Zur Gruppe der Expander gehören:
1. m. cricoarytenoideus posterior liegt auf der dorsalen Oberfläche der Ringknorpelplatte und ist am Processus muscularis befestigt. Bei der Kontraktion zieht sich der Processus muscularis zurück und zur medialen Seite, wodurch sich der Processusvocalis zur lateralen Seite dreht und die Stimmritze sich ausdehnt;
2. m. thyroepiglotticus, liegt auf der Seite von lig. Thyroepiglotticum. Es beginnt an der Innenfläche der Schildknorpelplatte, setzt sich am Rand der Epiglottis fest und geht teilweise in die Plica aryepiglottica über. Wirkt als Erweiterung des Kehlkopfeingangs und -vorhofs.
1. m. cricothyroideus, beginnt am Bogen des Ringknorpels und setzt an der Platte des Schildknorpels und an seinem Unterhorn an. M. cricothyroideus belastet die Stimmbänder, da er den Schildknorpel nach vorne zieht, wodurch sich der Abstand zwischen Schildknorpel und Processus Vocalis des Aryknorpels vergrößert;
2. m. Vocalis liegt in der Dicke der Plica Vocalis, dicht angrenzend an Lig. Gesang. Seine Fasern verschmelzen seitlich mit den Fasern von m. thyroarythenoideus. Es beginnt am unteren Teil des Winkels des Schildknorpels und setzt nach hinten an der Seitenfläche des Processus Vocalis an. Bei der Kontraktion zieht der Processus Vocalis nach vorne, wodurch sich die Stimmbänder entspannen.
Von den Muskeln, die die Stimmbänder steuern, ist m. Vocalis und m. thyroarytenoideus entspannen sie, und m. Cricothyroideus ist angespannt, und sie werden alle auf die gleiche Weise innerviert, jedoch von unterschiedlichen Kehlkopfnerven: entspannend – von den unteren, angespannt – von den oberen Kehlkopfnerven.
Die Kehlkopfhöhle, Cavitas laryngis, öffnet sich mit einer Öffnung – dem Eingang zum Kehlkopf, Aditus laryngis. Es wird vorne durch den freien Rand der Epiglottis, hinten durch die Spitzen der Aryknorpel samt der dazwischen liegenden Schleimhautfalte, Plica interarytenoidea, an den Seiten durch die dazwischen gespannten Schleimhautfalten begrenzt Epiglottis und die Aryknorpel, Plicae aryepiglotticae. An den Seiten des letzteren befinden sich birnenförmige Vertiefungen in der Rachenwand, Recessus piriformes.
Die Kehlkopfhöhle selbst hat die Form einer Sanduhr: Im mittleren Abschnitt ist sie verengt, nach oben und unten erweitert. Der obere erweiterte Abschnitt der Kehlkopfhöhle wird als Vestibül des Kehlkopfes, Vestibulum laryngis, bezeichnet. Das Vestibül erstreckt sich vom Eingang zum Kehlkopf bis zu einer paarigen Schleimhautfalte, die sich an der Seitenwand der Höhle befindet und Plica vestibularis genannt wird; die Dicke des letzteren enthält lig. Vestibular. Die Wände des Vestibüls sind: vorne - die Rückenfläche der Epiglottis, hinten - die oberen Teile des Aryknorpels und der Plica interarytenoidea, an den Seiten - eine paarweise elastische Membran, die sich von der Plica vestibularis bis zur Plica aryepiglottica erstreckt Membrana fibroelastica laryngis genannt.
Die komplexeste Struktur ist der mittlere, verengte Abschnitt der Kehlkopfhöhle – der Stimmapparat selbst, die Stimmritze. Es wird vom oberen und unteren Abschnitt durch zwei Schleimhautfaltenpaare abgegrenzt, die sich an den Seitenwänden des Kehlkopfes befinden. Die obere Falte ist die bereits erwähnte paarige Plica vestibularis. Die freien Ränder der Falten begrenzen den unpaarigen, ziemlich breiten Spalt des Vestibüls, Rima Vestibuli. Die untere Falte, die Godos-Falte, Plica Vocalis, ragt in den Hohlraum hinein, der größer ist als die obere, und enthält das Stimmband, Lig.vocale, und den Stimmmuskel, M. Vocalis. Die Vertiefung zwischen der Plica Vestibularis und der Plica Vocalis wird als Ventrikel des Kehlkopfes, Ventriculus laryngis, bezeichnet.
Zwischen den beiden Plicae Vocales bildet sich eine sagittal gelegene Stimmritze, die Rima glottidis. Dieser Spalt ist der engste Teil der Kehlkopfhöhle. Man unterscheidet zwischen dem großen vorderen Abschnitt, der sich zwischen den Bändern selbst befindet und als intermembranöser Teil, Pars intermembranacea, bezeichnet wird, und dem kleineren hinteren Abschnitt, der sich zwischen den Stimmfortsätzen, Processus Vocalis, des Aryknorpels befindet – dem interkartilaginären Teil, Pars intercartilaginea.
Der untere erweiterte Abschnitt des Kehlkopfes, Cavitas infragldttica, verengt sich allmählich nach unten und geht in die Luftröhre über.
Bei einer lebenden Person kann man bei der Laryngoskopie (Untersuchung des Kehlkopfes mit einem Kehlkopfspiegel) die Form der Stimmritze und ihre Veränderungen erkennen. Bei der Phonation (Lautbildung) erscheint die Pars intermembranacea als schmaler Schlitz, die Pars intercartilaginea hat den Umriss eines kleinen Dreiecks; Bei ruhiger Atmung dehnt sich die Pars intermembranacea aus und die gesamte Stimmritze nimmt die Form eines Dreiecks an, dessen Basis sich zwischen den Aryknorpeln befindet (Abb. 156). Die Schleimhaut des Kehlkopfes sieht glatt aus und hat eine gleichmäßige rosa Farbe, ohne lokale Veränderungen des Reliefs und der Beweglichkeit. Im Bereich der Stimmbänder hat es eine rosa Farbe, im Bereich des Lig. Vestibularis – rötlich.
Beim Ausatmen kommt es zur Schallbildung. Der Grund für die Stimmbildung ist die Vibration der Stimmbänder, die nicht passiv unter dem Einfluss des Luftstroms schwingen, sondern aufgrund einer engen Beziehung zu mm. Vokale, die sich aktiv unter dem Einfluss rhythmischer Impulse zusammenziehen, die von den Zentren des Gehirns mit einer Schallfrequenz über die Nerven kommen. Der von den Stimmbändern erzeugte Ton enthält neben dem Hauptton eine Reihe von Obertönen. Dennoch unterscheidet sich dieser „konnektive“ Klang völlig von den Klängen einer lebenden Stimme: Erst durch ein System von Resonatoren erhält die Stimme ihre natürliche menschliche Klangfarbe. Da die Natur ein sehr wirtschaftlicher Baumeister ist, übernehmen die verschiedenen Lufthohlräume der Atemwege, die die Stimmbänder umgeben, die Rolle der Resonatoren. Die wichtigsten Resonatoren sind der Rachen und die Mundhöhle.
Gefäße und Nerven.
Arterien des Kehlkopfes - aa. Kehlkopf sup. et inf. (aus aa. thyroldeae sup. et inf.). Venöser Abfluss durch die Plexus in die gleichnamigen Venen. Lymphdrainage in die Nodi lymphatici cervicales profundi und in die präglottischen Knoten.
Nerven – nn. Laryngeus sup. et. inf. (von n. vagi) und Trancus sympathicus.
22. Luftröhre und Bronchien. Ihre Struktur, Topographie, Blutversorgung und Innervation.
Die Luftröhre, Trachea (von griech. trachus – rau), ist eine Fortsetzung des Kehlkopfes, beginnt auf Höhe der Unterkante des Halswirbels VI und endet auf Höhe der Oberkante des Brustwirbels V, wo sie liegt ist in zwei Bronchien unterteilt – rechts und links. Die Stelle, an der sich die Luftröhre teilt, wird Bifurcatio tracheae genannt. Die Länge der Luftröhre beträgt 9 bis 11 cm, der Querdurchmesser beträgt durchschnittlich 15 – 18 mm.
Topographie der Luftröhre.
Die Halsregion wird oben von der Schilddrüse bedeckt, hinten grenzt die Luftröhre an die Speiseröhre und an den Seiten davon liegen die Arteria carotis communis. Neben dem Isthmus der Schilddrüse ist auch die Luftröhre im vorderen Bereich bedeckt. Sternohyoideus und Sternothyroideus, außer in der Mittellinie, wo die Innenkanten dieser Muskeln auseinanderlaufen. Der Raum zwischen der hinteren Oberfläche dieser Muskeln mit der sie bedeckenden Faszie und der vorderen Oberfläche der Luftröhre, dem Spatium pretracheale, ist mit losen Fasern und Blutgefäßen der Schilddrüse (A. thyroidea ima und Venenplexus) gefüllt. Der thorakale Teil der Luftröhre ist vorne vom Manubrium des Brustbeins, der Thymusdrüse und Blutgefäßen bedeckt. Die Lage der Luftröhre vor der Speiseröhre hängt mit ihrer Entwicklung aus der ventralen Wand des Vorderdarms zusammen.
Aufbau der Luftröhre.
Die Trachealwand besteht aus 16 - 20 unvollständigen Knorpelringen, cartilagines tracheales, verbunden durch faserige Bänder - ligg. Anularia; Jeder Ring erstreckt sich nur über zwei Drittel des Umfangs. Die hintere Membranwand der Luftröhre, Paries membranaceus, ist abgeflacht und enthält Bündel aus glattem Muskelgewebe, die quer und längs verlaufen und für aktive Bewegungen der Luftröhre beim Atmen, Husten und M. sorgen. N. Die Schleimhaut des Kehlkopfes und der Luftröhre ist mit Flimmerepithel bedeckt (mit Ausnahme der Stimmbänder und eines Teils der Epiglottis) und reich an Lymphgewebe und Schleimdrüsen.
Gefäße und Nerven.
Die Luftröhre erhält Arterien von der AA. thyroidea inferior, thoracica interna, sowie aus Rami bronchiales aortae thoracicae. Die venöse Drainage erfolgt in die die Luftröhre umgebenden Venengeflechte sowie (und insbesondere) in die Venen der Schilddrüse. Die Lymphgefäße der Luftröhre verlaufen über ihre gesamte Länge zu zwei an ihren Seiten befindlichen Knotenketten (Peritrachealknoten). Darüber hinaus gehen sie vom oberen Segment zum präglottischen und oberen tiefen Halsknoten, vom mittleren zum letzten und supraklavikulären Knoten und vom unteren zum vorderen mediastinalen Knoten.
Die Trachealnerven entspringen dem Truncus sympathicus und dem N. vagus, sowie von dessen vegwi – n. Kehlkopf unterlegen.
Die Hauptbronchien, rechts und links, Bronchi Principales (Bronchus, griechisch – Atemschlauch) dexter et sinister, gehen an der Stelle der Bifurcatio tracheae fast im rechten Winkel ab und sind zum Tor der entsprechenden Lunge gerichtet. Der rechte Bronchus ist etwas breiter als der linke, da das Volumen der rechten Lunge größer ist als das der linken. Gleichzeitig ist der linke Bronchus fast doppelt so lang wie der rechte; im rechten befinden sich 6–8 Knorpelringe, im linken 9–12. Der rechte Bronchus liegt vertikaler als der linke und ist somit wie eine Fortsetzung der Luftröhre. V. wird bogenförmig von hinten nach vorne durch den rechten Bronchus geschleudert. azygos, auf dem Weg zu v. cava superior, der Aortenbogen liegt oberhalb des linken Bronchus. Die Schleimhaut der Bronchien ist im Aufbau identisch mit der Schleimhaut der Luftröhre.
Bei einer lebenden Person hat die Schleimhaut während der Bronchoskopie (d. h. bei der Untersuchung der Luftröhre und der Bronchien durch Einführung eines Bronchoskops durch Kehlkopf und Luftröhre) eine gräuliche Farbe; Knorpelringe sind deutlich sichtbar. Der Winkel an der Stelle der Teilung der Luftröhre in die Bronchien, der wie ein zwischen ihnen hervorstehender Grat aussieht, Crista, sollte normalerweise in der Mittellinie liegen und sich beim Atmen frei bewegen können.
Bauch ( lat. cavitas abdominis) – ein Raum im Körper unterhalb des Zwerchfells, der vollständig mit Bauchorganen gefüllt ist. Sie gliedert sich in die Bauchhöhle selbst und die Beckenhöhle (lat. cavitas pelvis). Die Höhle ist mit einer serösen Membran ausgekleidet – dem Peritoneum, das die Bauchhöhle (die Bauchhöhle im engeren Sinne) vom retroperitonealen Raum trennt. Die Bauchhöhle umfasst die Bauchhöhle, die Cavitas peritonealis, die inneren Organe und den retroperitonealen Raum sowie das Spatium extraperitoneale. Die Bauchhöhle ist ein schlitzartiger Raum, der zwischen dem parietalen Peritoneum eingeschlossen ist, Bild. Die Wände des Peritonealsacks und das viszerale Peritoneum, das die Organe dieses Sacks bedeckt. Das Colon transversum und sein Mesenterium bilden ein Septum, das die Bauchhöhle in zwei Stockwerke unterteilt – das obere und das untere. Diese Teilung erfolgt nicht in einer horizontalen Ebene, da das Colon transversum auf seinem Mesenterium nach unten abfällt. Der obere und untere Boden der Bauchhöhle sind nur von vorne – durch die präepiploische Fissur und von den Seiten – durch den linken und rechten Seitenkanal miteinander verbunden. Im obersten Stock In der Bauchhöhle können drei miteinander verbundene Säcke oder Schleimbeutel unterschieden werden: hepatisch (Bursa hepatica), prägastrisch (Bursa pregastrica) und omental (Bursa omentalis). Die ersten beiden liegen näher an der Bauchoberfläche, die dritte tiefer. Die Schleimbeutel hepatischer und pankreatischer Schleimbeutel sind durch das Suspensorium und das Koronarband der Leber voneinander getrennt. Die Bursa hepatica umschließt den rechten Leberlappen, die Bursa praegastrica befindet sich vor dem Magen und umschließt den linken Leberlappen und die Milz. Die Wände der Leberschleimbeutel sind das Zwerchfell (seine Rippen- und Lendenteile) und die vordere Bauchwand; Die Wände der Bauchspeicheldrüse werden vom Zwerchfell, der vorderen Bauchdecke und dem Magen mit seinen Bändern gebildet. Unten verläuft jeder dieser Schleimbeutel vor dem Colon transversum in den präepiploischen Raum. Darüber hinaus kommuniziert der rechte Schleimbeutel (hepatisch) mit dem rechten Seitenkanal der Bauchhöhle und der linke Schleimbeutel (prägastrisch) mit dem linken Seitenkanal. Die Kommunikation zwischen beiden Beuteln erfolgt durch einen schmalen Spalt zwischen der Leber und dem Pylorusteil des Magens vor dem Omentum minus. Die Bursa omentalis, auch kleiner Bauchbeutel genannt, begrenzt einen schlitzartigen Raum, der sich hauptsächlich hinter dem Magen und dem Ligamentum hepatogastricum befindet. Der Beutel kommuniziert mit dem großen Peritonealsack durch die Omentalöffnung – Foramen epiploicum (Winslowi). Diese Öffnung befindet sich in der Nähe des Leberportals und wird vorne durch das Ligamentum hepatoduodenale, hinten durch die Vena cava inferior mit dem sie bedeckenden Peritoneum, oben durch den Schwanzlappen der Leber und unten durch den Anfangsteil des Duodenums begrenzt. Bei fehlenden Verwachsungen lässt die Omentumöffnung oft einen, seltener auch zwei Finger durch; bei Verwachsungen kann die Öffnung verschlossen werden. Die Bursa omentalis wird direkt vorne und hinten von zwei Schichten des Peritoneums begrenzt – anterior und posterior –, die an der Bildung der vorderen und hinteren Wände der Bursa omentalis beteiligt sind. Die vordere Schicht der Bursa omentalis bedeckt den Schwanzlappen der Leber vom hinteren Rand des Organs bis zum Lebertor. Von hier aus verläuft die vordere Schicht zur kleinen Krümmung des Magens und bildet dabei die hintere Platte des kleinen Omentums, bedeckt dann die hintere Wand des Magens bis zu ihrer großen Krümmung und senkt sich nach unten, wobei sie die hintere Platte lig bildet. Gastrocolicum. Als nächstes wickelt sich dieses vordere Blatt nach oben und bildet die dritte (innere) Platte des Omentum majus, die dann in das hintere Blatt der Bursa omentalis übergeht. Diese Schicht bedeckt die Vorderseite der Bauchspeicheldrüse und erreicht den hinteren Rand der Leber, wo sie mit der vorderen Schicht der Bursa omentalis verschmilzt. Die Wände der Bursa omentalis sind; vorne - der Magen und das Omentum minus; dahinter - eine Schicht parietalen Peritoneums, die die Bauchspeicheldrüse, die linke Niere, die linke Nebenniere, die Aorta und die untere Hohlvene bedeckt; unten - der linke Teil des Mesenteriums des Querkolons; links die Milz mit ihren Bändern; Die oberen und rechten Wände sind nicht unabhängig voneinander dargestellt. Oben erreicht der Hohlraum das Zwerchfell, rechts den Zwölffingerdarm. Bei Trennung entlang der größeren Krümmung des Magenlig. Gastrocolicum und ziehen Sie den Magen nach oben. Sie können zwei Falten des Peritoneums sehen, die sich zwischen der kleinen Krümmung des Magens und der Vorderfläche der Bauchspeicheldrüse erstrecken – Plicae gas-tropancreaticae. Einer von ihnen, der linke, geht von der kleineren Krümmung des Mageneingangs zur Bauchspeicheldrüse; in der freien Kante passiert es a. gastrica sinistra und v. Coronaria ventriculi und in der Dicke des Bandes befinden sich Nodi lymphatici gastropancreatici. Ein weiteres Band geht vom Pylorusteil des Magens zur Bauchspeicheldrüse und auch der erste Teil des Zwölffingerdarms kann durch dieses Band verlaufen. hepatica communis. Zwischen beiden Falten befindet sich eine Öffnung – Foramen gastropancrcticum. Der Hohlraum der Bursa omentalis ist durch die angegebenen Falten in zwei Abschnitte unterteilt – den oberen (rechts) und den unteren (links), deren Kommunikation über das Foramen gastropancreaticum erfolgt. Der obere Abschnitt gehört zum Vestibulum des Schleimbeutels (Vestibulum bursae omentalis) – dem ersten Abschnitt der Höhle, der sich hinter dem Omentum minus befindet. Darüber befindet sich eine obere Inversion der Bursa omentalis, die sich hinter dem Schwanzlappen der Leber befindet und bis zur Speiseröhre und zum Zwerchfell reicht. Der untere Teil der Höhle der Bursa omentalis (die Höhle selbst), die sich hinter dem Magen und dem Lig. gastrocolicus befindet, weist einen unteren Volvulus auf, der sich nach links in den Milzvolvulus fortsetzt. Der Hohlraum der Bursa omentalis umfasst auch einen schlitzartigen Raum, der zwischen den Blättern des Omentum majus eingeschlossen ist (der Hohlraum des Omentum majus). Es kommt bei Neugeborenen vor, aber bei Erwachsenen verschwindet der schlitzartige Raum, meist aufgrund der Verklebung der Blätter des Omentum majus, über den größten Teil seiner Länge und bleibt nur im linken Teil bestehen. Der subdiaphragmatische Raum ist ein extraperitonealer subdiaphragmatischer Raum, der sich hinter der Leber befindet. Beide subdiaphragmatischen Räume spielen in der chirurgischen Pathologie eine wichtige Rolle: Hier können Abszesse, sogenannte subdiaphragmatische Abszesse, entstehen. extraperitoneale Komplikationen sind am häufigsten Komplikationen von Parakolitis und Paranephritis. Omentum minus und majus, ihr Inhalt Das Omentum minus besteht aus drei Bändern, die direkt ineinander übergehen; links - lig. phrenicogastricum (vom Zwerchfell bis zum Mageneingang)1, mittel - lig. hepatogastricum (von der Leberpforte bis zur kleinen Magenkrümmung) und rechts - Lig hepatoduodenale. In der Dicke des Lig hepatogastricum gibt es a. gastrica dextra, a. gastrica sinistra, v. Coronaria ventriculi und Lymphknoten. Zwischen den Blättern lig. hepatoduo-denale befinden sich: links - a. hepatica, rechts - Ductus chole-dochus, zwischen ihnen und dahinter - v. Portae. Darüber hinaus befinden sich in der Dicke des nephroduodenalen Bandes der Ductus hepatica und der Ductus cysticus, die den Ductus choledochus bilden, Äste der Leberarterie, Lymphgefäße und mehrere Lymphknoten, von denen einer fast immer am Zusammenfluss des Ductus cysticus liegt und Lebergänge und der andere am freien Rand des Bandes. Die Leberarterie ist von einem Nervengeflecht umgeben – dem Plexus hepaticus anterior, und hinter der Pfortader und in der Rinne zwischen ihr und dem Hauptgallengang befindet sich der Plexus hepaticus posterior. In der Dicke von lig. gastrolienale sind Vasa gastrica brevia und Vasa gastroepiploica sinistra. Oberer Abschnitt des Omentum majus, lig. gastrocolieum, enthält zwischen seinen Blättern Vasa gastroepiploica dextra und sinistra, Lymphknoten.
97. Topographische Anatomie der oberen Etage der Bauchhöhle. Organe: Holotopie, Syntopie, Skelettie. Zugang zu den Organen der oberen Bauchhöhle. Der obere Boden der Bauchhöhle liegt zwischen dem Zwerchfell und dem Mesenterium des Colon transversum. Es enthält intraperitoneal den Magen, die Milz und mesoperitoneal die Leber, die Gallenblase und den oberen Teil des Zwölffingerdarms. Die Bauchspeicheldrüse gehört ebenfalls zur oberen Etage der Bauchhöhle, obwohl ein Teil ihres Kopfes unterhalb der Wurzel des Mesenteriums des Querkolons liegt. Die aufgeführten Organe, ihre Bänder und das Mesokolon begrenzen mehr oder weniger isolierte Räume, Spalten und Beutel im Obergeschoss der Bauchhöhle. Magen.(nach Guyvor) 1) Holotopie: Das Organ befindet sich in der Bauchhöhle im linken Hypochondrium und im Oberbauch. 2) Skelett: - Herzöffnung auf der Höhe von 11-12 Wirbelsäulen; - Pylorusöffnung auf Höhe von 12 Brüsten - 1 Lendenwirbelsäule; 3) Syntopie: Die Peripherie grenzt an Leber, Zwerchfell und periorbitale Wand; Rückseite mit Milz, Drüse, Löwenniere, Nebenniere, Aorta und Vena cava inferior; zur größeren Krümmung - Pop um den Darm. Milz: 1) Holotopie: befindet sich im linken Hypochondrium, in seinem hinteren (tiefen) Abschnitt. 2) Skeletotopie: auf der Höhe der IX. bis XI. Rippe auf der linken Seite, wobei sein unterer (vorderer) Pol die vordere Achsellinie erreicht, und der obere (hinter) reicht fast bis zur Wirbelsäule und erreicht die hintere Mittellinie in einem Abstand von 4–5 cm nicht. 3) Syntopie: Die Außenfläche der Milz grenzt an den Rippenteil des Zwerchfells. Vorne, vom oberen Rand bis zum Tor, steht die Milz in Kontakt mit der hinteren und seitlichen Oberfläche des Fundus und des Magenkörpers, hinten und unten, vom Tor bis zum unteren Rand, mit dem lumbalen Teil des Zwerchfells und der obere Pol der linken Niere und Nebenniere, vorne und unten mit Flexura coli sinistra und mit dem Schwanz der Bauchspeicheldrüse. Leber: 1) Holotopie: rechte Hypochondriumregion, Teil der epigastrischen Region und Teil der linken Hypochondriumregion 2) Skeletotopie: oberer Rand – Lin medioclavicul dextra – Knorpel der 5. Rippe; lin mediana Ameise – das Hauptxiphoid des Körpers; lin paraster sin - Knorpel der 6. Rippe; unterer Rand - rechts - der untere Rand des Rippenbogens, kommt unter den Rippen an der Stelle der Verbindungsknorpel der 8-9 Rippen rechts hervor und geht nach links und oben durch die Spitze des Schwertes des Prozesses mit der Verbindung der Knorpel der 7-8 Rippen auf der linken Seite 3) Syntopie: Löwe und Quadrat Der Leberlappen ist der Magen, am hinteren Rand befindet sich die Speiseröhre, am rechten Leberlappen befindet sich der Dickdarm , rechte Niere, Nebenniere, Zwölffingerdarm. Gallenblase: 1) Holotopie6 rechte Unterregion 2) Skelettotopie: unten rechts am Übergang der Knorpel der 8. und 9. Rippe 3) Syntopie: zur viszeralen Oberfläche der Leber, im gefüllten Inhalt bis zur ersten Brust. DPK: 1) Holotopie: rechtes Hypochondrium, rechte seitliche und periumbilikale Regionen 2) Skeletopie: oberer Teil 1 Gürtelhaltung; absteigender Teil – 1-3 Gürtel, Bergteil – 3 Gürtel pos-k; aufsteigend von der 3. zur 2. Gürtelhaltung. 3) Syntopie: oberer Teil - quadratischer Leberlappen, Hals der Gallenblase und Popus über dem Darm (unten), unterer Teil zur rechten Niere und Kreuzung vorn mit dem Mesenteriumpopus über dem Darm, M / Y-Köpfe und der absteigende Teil des Zwölffingerdarms ist der gemeinsame Gallengang, im Hufeisen befindet sich die Gallenblase, hinter den Bergen des Teils befinden sich die Aorta und die Vena cava inferior, vorne befindet sich die obere Mesenterialarterie und -vene . Podzel wünschte: 1) Holotopie: Epigastrium und Löwen-Subregion; 2) Skeletttopie: 1-3 Gürtel; 3) Syntopie: Der Kopf ist das Hufeisen des Zwölffingerdarms, der vordere Teil ist der Pylorusteil und der Gallenkörper, der hintere Teil der Galle ist der Taillenteil des Zwerchfells. Diebvene, Ductus communis und br. Teil der Aorta, Schwanz zur linken Niere, Nebenniere und Milz. Zugang:(Lopukhins Schule) Laparotomie. Median: oben in der Mitte (zu den Organen der obersten Etage), zentral in der Mitte (oben und unten in der Etage), paramediane Laparotomie nach Lenander (zum Magen und Subdiaphragma), transrecte Laparotomie (zum Magen oder zur Bevölkerung). des Darms), oben quer entlang des Sprengel (Gallengang, Pylorus, Gallenblase, Sel-ki, Pop um den Darm), schräg nach Courvoisier-Kocher, Fedorova, aufgeräumt, kombinierter Schnitt nach Quinn (für die Leber) , kombiniert nach Petrovsky-Pochechuev (Eröffnung der Pleura und Bronchialhöhle) . Zugänge für Endovideochirurgen.
98. Topographische Anatomie von Leber und Milz. Methoden zur Blutstillung aus Parenchymorganen. Splenektomie. Methoden zur Blutstillung aus Parenchymorganen. Man kann zwischen mechanisch, physikalisch, biologisch und chemisch unterscheiden. Eine der ältesten Methoden zur mechanischen Blutstillung ist die Unterbindung oder das Nähen blutender Gefäße in einer Wunde. Im Jahr 1896 entwickelten Kuznetsov MM und Pensky Yu R. eine U-förmige hämostatische Naht der Leber. Die Methode basiert auf der Blutstillung durch Kompression der Gefäße zusammen mit dem Parenchym im resezierten Bereich. Diese Methoden haben eine Reihe von Nachteilen. Am häufigsten werden eine Nekrose des Parenchyms distal der Nahtlinie, Blutungen in der intra- und postoperativen Phase sowie die Bildung von Gallenfisteln beobachtet. Eine Nekrose des Parenchyms führt zu einer Entspannung der Nähte. was auch durch postoperative Blutungen und die Bildung von Gallenfisteln erschwert werden kann. Daher wird das Nähen von Leber- und Milzwunden häufig mit Einzelknopfnähten durchgeführt, wobei eine Auskleidung in Form eines Omentums verwendet wird, um ein Durchtrennen des Parenchyms und der dünnen Kapsel zu vermeiden. Das Anbringen von Nähten an einer Niere, die über eine dichte Bindegewebskapsel verfügt, führt aufgrund der starken Durchblutung des Gewebes häufig zur Entstehung von Blutungen entlang der Nahtlinie. In der chirurgischen Praxis wird zum Zwecke der Blutstillung häufig die direkte Einwirkung physikalischer Wirkstoffe auf die Wundoberfläche und blutende Gefäße eingesetzt. Derzeit werden bei Traumata parenchymaler Organe folgende Methoden eingesetzt: Elektrokoagulation, Argonkoagulation, Mikrowellen- und Hochfrequenzkoagulation, Kontaktinfrarotstrahlung, Ultraschall, harmonische und Jet-Skalpelle, Laserkoagulation, Plasmaflüsse, Hochfrequenzablation. Mit der Elektrokoagulation ist es nicht immer möglich, Blutungen aus Gefäßen mit mittlerem und großem Durchmesser zu stoppen. In diesem Fall koagulieren Gefäße mit einem Durchmesser von mehr als 0,5–1,0 mm nicht und um eine anhaltende Blutung zu stoppen, ist eine Erhöhung der Expositions- und Gerinnungsleistung erforderlich, wodurch die Nekrosefläche vergrößert wird. Die in der Chirurgie verwendeten Laser lassen sich in zwei große Gruppen einteilen: hochenergetische und niederenergetische Laser. Auch die Laserbestrahlung führt unweigerlich zu einer Parenchymnekrose, deren Prävalenz zwischen 4 mm und 8 mm liegt. In diesem Fall werden Gefäße mit einem Durchmesser von mehr als 1 mm nicht ausreichend koaguliert, wodurch eine unblutige Organresektion ausgeschlossen ist. Einige Erfolge bei der Erzielung einer wirksamen Blutstillung wurden mit einem Argon-Elektrokoagulator erzielt, der gleichzeitig hochfrequenten elektrischen Strom und einen Argonstrahl verwendet. Der hochfrequente elektrische Strom koaguliert und schneidet Gewebe, und der Argonstrom entfernt Blut und Gewebepartikel. Aufgrund seiner Trägheit verursacht Argon zerstörerische Veränderungen im Gewebe, die sich in einem kleineren Volumen äußern. Physikalische Methoden der Blutstillung bei Operationen an parenchymalen Organen erfüllen nicht die Anforderungen der „idealen Methode“, die mit minimalem oder keinem Blutverlust, minimaler Nekrose des Parenchyms und einer Verkürzung der chirurgischen Eingriffszeit einhergehen sollte.
Von den chemischen Methoden der Blutstillung im Ausland und in unserem Land ist die Verwendung von Klebstoffzusammensetzungen und insbesondere Cyanacrylatklebstoffen am weitesten verbreitet. Bei der Verwendung von hydrophoben Cyanacrylat-Klebstoffen wird eine Blutstillung durch die Bildung eines Klebefilms auf der Wundoberfläche erreicht. Gleichzeitig zeichnen sich Cyanacrylatklebstoffe durch allgemeine und lokale Toxizität aus und verursachen nekrotische Veränderungen im Anwendungsbereich. Aufgrund der schnellen Verglasung solcher Klebstoffe auf der Wundoberfläche und der schwachen Verbindung mit dem Gewebe sind Beobachtungen einer frühen Abstoßung des Klebefilms mit erneutem Auftreten lebensbedrohlicher Blutungen bekannt. Biologische Methoden der Blutstillung lassen sich je nach Art der verwendeten Materialien in Gruppen einteilen: körpereigene biologische Gewebe, Blutprodukte und deren Fraktionen, Produkte aus der Verarbeitung tierischer Gewebe, Arzneimittel auf Basis pflanzlicher Stoffe und kombinierte Arzneimittel. In der chirurgischen Praxis Dabei werden Blutprodukte verwendet, die blutstillende Eigenschaften haben. Von diesen wird Fibrinkleber (FC) am häufigsten verwendet. Der Wirkungsmechanismus von Blutprodukten besteht darin, unter dem Einfluss von Thrombin die enzymatische Umwandlung des löslichen Plasmaproteins Fibrinogen in Fibrinmonomer zu beschleunigen, dessen Moleküle dann a bilden Fibrin-Netzwerk. Die Verwendung von mehrkomponentigen und teuren FC ist mit der Notwendigkeit einer speziellen Ausrüstung im Operationssaal verbunden, und operierende Chirurgen und Personal müssen die Technik des Mischens ihrer Komponenten beherrschen. Eine der Richtungen bei der Suche nach Mitteln zur lokalen Blutstillung war die Verwendung von Biopolymeren – Kollagen und Gelatine. Die offenbarte hämostatische Wirkung eines hämostatischen Schwamms aus Gelatine hängt mit seiner Zellstruktur, der Aufnahme von Blutmengen, die um ein Vielfaches größer sind als sein Eigengewicht auf der Oberfläche des Arzneimittels, und der Zerstörung von Blutzellen unter Freisetzung von Thrombollastin zusammen . Bei der Chirurgie parenchymaler Organe werden viele verschiedene Methoden zur endgültigen Blutstillung eingesetzt. Es wurden jedoch noch keine wirksamen Mittel zur Bekämpfung starker Blutungen gefunden. Es ist zu beachten, dass bei starken Blutungen aus großen Gefäßen (mit einem Durchmesser von mehr als 1,0 - 1,5 mm) keine adhäsiven Zusammensetzungen oder Kombinationspräparate erforderlich sind ist in der Lage, eine zuverlässige Blutstillung zu gewährleisten. Splenektomie. Offen und laparoskopisch. Offen. Pok-ya. Splenomegalie, essentielle Thrombopenie, Milzruptur, bösartige Tumoren, Tuberkulose, Echinokokkose, Abszesse usw. Zugang – obere mittlere Laparotomie für pov. Thorakoabdominaler Schnitt – Splenomegalie. Technik: Wenn bei der Erstuntersuchung keine zusätzlichen Blutungsquellen festgestellt werden, ist der Zustand des Patienten nicht kritisch – Mobilisierung der Milz. Wir beugen den Bogen nach oben, bewegen uns um den Darm und die Drüse herum - nach rechts und nach unten - und schätzen die Größe der Region ein. Mit einer langen Schere zwischen den Klammern wird das Sel-Nierenband durchtrennt. Präparation des Drüsenbandes und des Peritoneums hinter den Drüsen. Die Öffnung zwischen dem Drüsenrand und den Drüsenbändern, die Bursa omentalis, wird eröffnet, die Mobilisierung der Drüsenbänder, die Ligatur und die Kreuzung des Drüsenbandes erfolgen. Unterbindung von Blutgefäßen und Dissektion des Stiels – Entfernung der Milz. ! Kontrolle der Blutstillung! Wiederherstellung der Kontinuität des Peritoneums. Esel-ya. Blutungen, außerdem ist eine Zwischentotalresektion der Gallenblase aufgrund der Kreuzung der Gallengangsart nicht möglich. Laparoskop. Mögliche Fälle: Blutgerinnsel (TCpenische Purpura, primäre Panzytopenie der Milz), Lymphome, Trauma – Milzruptur, ohne starke Blutung, Zysten und Tumoren. Gegen mich. AMI, Schlaganfall, abnorme Koagulopathie, Speläomegalie, hämorrhagischer Schock. Technik. Intub-Anästhesie. Kissen im Lendenbereich, linkshemilaterale Position. Es wird ein Pneumoperitoneum angelegt und ein Trokar paraumbilikal eingeführt. Trokare im Bogen – in der Mitte ein Ausschnitt des Dorftores. Es sitzt auf dem Band an der Unterseite der Drüse – einem weichen Fruchtfleisch. Sie dehnen das Gelb-Sel-Band. Schneiden und kreuzen Sie den Kern der Kunst. Ras-e zhel-sel-Bänder. Mit Hilfe eines Retraktors ziehen sie die Vene und die Art heraus. Und sie nähen und kreuzen. Das Rennen setzte sich – fast Bänderrisse. Darin wird der Behälter eingesetzt. Anschließend wird das Zwerchfellband gekreuzt. Esel-ya. Die Kapseln sind verklemmt und bluten, Pankreatitis (Schwanztrauma, Abszess unter dem Zwerchfell mit unvollständiger Blutstillung).
99. Gastrostomie. Einstufung. Arten von Fisteln. Bereit für die Operation. Laut Witzel, Stammkader, Topver. Gastro-I - Anwendung einer Fistel. Pok-I: Die Dauer der Ernährungskunst ist schmerzhaft bei inoperablen Tumoren des Rachens, des Rachens, der Galle und einer narbigen Verengung des Rachens. Schwere Schädel-Hirn-Verletzungen, Verbrennungen, Lebensmittelschäden. Einteilung: nach Art der Fistel – tubulär (vorübergehend, Witzel, Stammkader) oder labiform (permanent Topver). Laut Witzel. Technik. Obere transrect Laparotomie links. Ein Gummischlauch wird in der Wunde in der Mitte des Gallensteins und im mittleren Abstand zwischen der größeren und kleineren Krümmung des Gallensteins platziert. Auf beiden Seiten des Schlauchs befinden sich 6-8 Nahtknoten; beim Knüpfen taucht der Schlauch 4-5 cm in den Nahtkanal ein, das Ende ragt aus dem Kanal in den Pylorusbereich. Am Ende gibt es noch eine halbe Schnurmasche, bis wir sie verknoten. In der Mitte des halben Beutels wird der Gallenstein eingeschnitten. Die Flüssigkeit wird abgesaugt und das Ende des Röhrchens in die Galle eingetaucht. Binden Sie einen halben Beutel zu und fügen Sie oben 2-3 weitere Serr-Maus-Maschen hinzu. Der Schlauch geht durch einen zusätzlichen Einschnitt am St. heraus. Der Gallensteinfaden wird von den Haltern hochgezogen, eng anliegend an der Pariet bru-ne. Die Fäden der Halter werden nach dem Nähen der Haut oberhalb oder unterhalb des Tubus zusammengebunden, um den Tubus gezogen und festgezogen. St-ku zhel-ka wird mit Nähten an die Pariet bru-not grey-mouse gesäumt. Die Wunde ist eng. Eine Klemme am Schlauch, damit das Soda nicht ausläuft. Minuspunkte. Am Schneidrohr befindet sich eine Klemme, die abfällt. Laut Stamm-Kader. Anders als beim Witzel wird der Tubus in anterior-posteriorer Richtung eingeführt. Bei kleinen Gallengrößen, bei Gallenwandkrebs. Technik. Obere transrektale Laparotomie links. Nachdem Sie den halblangen Gallenstein geöffnet haben, ziehen Sie ihn in Form eines Kegels zur Wunde und führen Sie 2-3 Beutel Graumaus im Abstand von 1,5 cm voneinander ein. In der Mitte des ersten Beutels werden die Schleimschicht und die Schleimhaut präpariert. Ein Schlauch wird in den Gallenstein eingeführt, der erste Beutel wird festgezogen (der Rand sollte sich in den Gallenstein einstülpen), und das Gleiche gilt für den zweiten und dritten. Die Gallenblase wird mit dem Bauchfell vernäht (Gastropexie). Das freie Ende des Schlauchs wird auf der Haut fixiert. Der Nachteil besteht darin, dass der Schlauch herausfallen und Flüssigkeit austreten kann. Laut dem Top-Checker. Für die große Drüse der obere transrektale Einschnitt. Der Stift wird in die Wunde eingeführt und ein Kegel mit 3 Zysten geformt. Die Enden der Fäden werden auf Klammern gelegt. Ein Schlauch wird eingeführt und die Beutel werden festgezogen. Der Zylinder ist zusammengebaut, er wird an die erste Brust gesäumt – der untere Beutel wird an die Peritonealhöhe des zweiten Beutels gesäumt, er wird an den geraden Bauch gesäumt. Der dritte Beutel geht auf die Haut. Zum Füttern wird die Sonde entfernt und eingeführt.
100. Gallenresektion nach Billroth1 und Billroth2. Pok-ya, Phasen der Operation. Arten von Gastroenterostomosen. Vergleichende Bewertung. Indikationen: - komplizierte Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre (Blutungen, penetrierende, schwielige, Pylorusstenose); - gutartige Tumoren (Polypen, Adenome); - Magenkrebs. Magenresektion nach Billroth 1. Es wird eine obere mittlere Laparotomie durchgeführt. Mobilisierung des Magens entlang der großen Kurvatur. Der Magen und das Colon transversum werden in die Wunde entfernt. Auf Höhe des mittleren Drittels des Magens wird das Lig. gastrocolicus eröffnet. Zwischen den Klammern werden das Band und die Arterien entlang der linken Hälfte der großen Krümmung bis zur vorgesehenen Höhe gekreuzt. Die Äste von A. gastroepiploica dextra werden ebenfalls abgebunden und vom Beginn der Mobilisierung bis zur Höhe des Pylorus nach rechts durchtrennt. Auf Höhe des Pylorus ist der Hauptstamm von A. gastroepiploica dextra separat abgebunden. Die Äste, die vom zentralen Abschnitt der A. gastroepiploica dextra zum Pylorus und Zwölffingerdarm führen, werden zwischen Klammern durchtrennt und bandagiert. 2-3 Äste der Arterie, die zur hinteren Oberfläche des Zwölffingerdarms führen, werden abgebunden und gekreuzt. Das Omentum minus wird zunächst in der avaskulären Zone präpariert, dann werden Klammern angebracht, die die linke Magenarterie dazwischen quetschen, die gekreuzt und abgebunden wird. Die rechte Magenarterie wird zwischen den Klammern abgebunden. Die Resektion beginnt auf der Seite der größeren Krümmung; eine Klammer wird senkrecht zur Magenachse bis zur Breite der Anastomose angelegt. Die zweite Klemme erfasst den Rest des Durchmessers von der Seite mit der geringeren Krümmung. Distal dieser Klammern wird eine Payra-Quetschpresse auf den entfernten Teil des Magens angewendet, entlang derer der Magen abgeschnitten wird. Auf den zu nähenden Teil des Magenstumpfes wird eine Randnaht gelegt. Der obere Rand der kleinen Magenkrümmung wird mit einer halbgebeutelten Fadennaht eingetaucht. Der verbleibende Teil wird mit separaten seromuskulären Nähten versehen. Zwischen dem Magenstumpf und dem Zwölffingerdarm wird eine Anastomose angelegt (die Breite der Anastomose am Magenstumpf ist größer als die des Zwölffingerdarms). Magenresektion nach Billroth 2 Magenresektion nach der von Hoffmeister-Finsterer modifizierten Billroth-II-Methode. Es wird eine Laparotomie der oberen Mittellinie durchgeführt. Mobilisierung von Magen und Zwölffingerdarm. Der Zwölffingerdarmstumpf wird mit einer fortlaufenden Wickelnaht vernäht. Der Stumpf wird entweder mit einer Z-förmigen und kreisförmigen Tabaksbeutelnaht aus Seide oder mit zwei Halbbeutelnähten mit zusätzlichen serös-serösen Nähten eingetaucht. Der Magen wird entfernt und sein Stumpf bearbeitet. Eine Magen-Darm-Anastomose wird so angelegt, dass das adduzierende Ende an der geringeren Krümmung liegt (nicht um 2-3 cm erreicht) und das efferente Ende an der größeren Krümmung liegt. Der afferente Darm wird oberhalb der Anastomose an die kleinere Magenkrümmung angenäht. Die Gastroenteroanastomose wird mit einer zweireihigen Naht angelegt (durchgehende Catgut-Naht an den hinteren Rändern der Anastomose durch alle Schichten mit Übergang zu den vorderen Rändern wie bei einer Schraub-Schmiede-Naht und unterbrochene seromuskuläre Seidennähte am vorderen Halbkreis der Anastomose). .
Arten der Gastroenterostomie. 1. Vordere vordere Kolik. 2. Hinterer vorderer Dickdarm. 3. Vordere Retrokolik. 3. Hintere Retrokolik. Am häufigsten werden die vordere vordere Kolik und die hintere Retrokolik verwendet, mit Ausnahme der vorderen Retrokolik. Gleichzeitig wird der hintere vordere Dickdarm praktisch nicht genutzt. Vordere vordere Kolik – technisch einfach. Hintere Retrokollaterale – die Anastomose kann sowohl in Quer- als auch in Längsrichtung angelegt werden.
101. Topograph Anatomie des extrahepatischen Gallenausscheidungstrakts. Varianten der Verteilung der Zystenarterie. Das Konzept des Callot-Dreiecks. Ante- und retrograde Methoden der Cholezystektomie. Ok, Technologie. Extraorganische Gallengänge. 1. Ductus hepaticus communis (Verschmelzung des Ductus hepaticus dexter et sinister) 2. Fusion des Ductus hepaticus communis mit dem Ductus cysticus = Ductus choledochus. 3. Der Hauptgallengang verschmilzt mit dem Gallengang und die Leber-Pogee-Ampulle des Randes mündet in den Zwölffingerdarm. . Zystenarterie und Callot-Dreieck. 89 % Zystenarterie hinter dem Ductus cysticus. In 8 % befand sie sich vor dem Ductus cysticus und in 3 % verlief die Arterie entlang des Ductus cysticus direkt neben dessen Vorder- oder Hinterfläche. Die Bedeutung dieses Bereichs für Chirurgen wurde erstmals beschrieben Kahlo(Calot) im Jahr 1891. Die drei Grenzen des vesiko-hepatischen Dreiecks sind; unterhalb des Ductus cysticus und der Wand der Gallenblase; oben der untere Rand des rechten Leberlappens (Bläschenarterie); medial der Ductus hepaticus communis. In dieser Gegend Durchgang: rechte Leberarterie, Zystenarterie. Cholezystektomie – Entfernung der Gallenblase. Pok-ya. Bei Steinen oder Entzündungen der Gallenblase. ZHKB.hr. Cholezystitis. Gute und bösartige Tumoren. Methoden: vom Gebärmutterhals, vom Fundus, subseröse Cholezystektomie, Koagulation der Blasenschleimhaut, laparoskopische Cholezystektomie. 1. Vom Gebärmutterhals aus - profitabler, von Anfang an beginnen wir mit der Isolierung des Gallengangs und der Blasenkunst. Sowie Untersuchung des Hauptgallengangs. Technik. Unter dem Rücken der Patientin befindet sich auf Höhe von 12 Brüsten ein Kissen. = Alle Organe nähern sich der ersten Etage und liegen im Obergeschoss der Höhle. Zugang – Fedorov, Courvoisier-Kocher, Sprengel, Pribram, obere mittlere Laparotomie, rechter pararektaler Zugang. Inspektion und Palpation der Gallenblase. Freilegung und Unterbindung der extrahepatischen Gallenwege. Eine Ligatur wird 0,5 cm distal von der Verbindung von Gallengang und Gallengang angelegt. Nachdem wir uns von der ersten Ligatur 0,5 cm zurückgezogen haben, verbinden wir den Bauch erneut. Und wir schneiden zwischen 2 Ligaturen. im Callot-Dreieck werden sie erneut aufgerufen und die Art.-Blase wird überschritten. Diskretion der Gallenblase und ihres Bettes. Oberhalb der Gallenblase ist das Peritoneum entlang seines Umfangs ausgebreitet und tritt 0,5 cm von der Linie entfernt, entlang derer das Peritoneum von der Leber zur Drüse verläuft. Die Blasenwand löst sich vom Bett. Inspektion des Bettes auf Blutstillung. Das Peritoneum wird kontinuierlich oder mit Knotenkatgut vernäht. Der Blasenstumpf bleibt frei. 2. Von unten. Bei Verwachsungen im Halsbereich. + Wir haben die Fähigkeit, Elemente genau zu identifizieren. – Es ist unmöglich, eine Diagnose von Iss-I des Magen-Darm-Trakts, was eine Blutung bedeutet, durchzuführen. Technik. Die Zugriffe sind gleich. Herausziehen der Drüsen, Ablösen der Drüsen der Blase vom Bett. Entlang der Achse der Bauchhöhle wird links und rechts das Peritoneum im Fundusteil eingeschnitten, beide Schnittlinien werden durchtrennt. Sie schieben den Gelbbauch aus dem Bett und bewegen sich in Richtung Bauchgang. Der Bauch wird in der Nähe der Leberblase abgebunden und gekreuzt, und der Bauchgang ist 0,5 cm vom Hauptgallengang entfernt. Die Schilddrüse wird abgeschnitten und entfernt. Dann ist es das Gleiche wie im Gebärmutterhals. 3. Subseröse Cholezystektomie. Die gesamte Blase wird aus der Peritonealhülle herausgezogen und hinterlässt eine Schicht auf dem Leberbett. Nur im Frühstadium des primären Cholezystitis-Anfalls! - Dies bedeutet eine Blutung, da die Blasenarterie erst verbunden werden kann, nachdem die Blase entleert wurde. 4. Koagulation der Schleimhaut. Der aktuelle Rückfall ist komplizierter und weist erhebliche Veränderungen sowohl des umliegenden Gewebes als auch der Bauchhöhle auf. Technik. Der leere Magen wird über die gesamte Länge geöffnet und von Steinen befreit. Nach der Unterbindung des Bauchgangs und des Bauchgangs wird die an die Leber angrenzende Schleimhaut der Blase mit einem Thermokoagulator mit dem Peritoneum koaguliert. Die Ränder der Blase werden durch Wenden der Nähte zusammengenäht. 5. Laparoskopisch. Pok-I-Kalkül, Cholezystitis, Gallencholesterose, Polyposis der Gallenblase, akute Cholezystitis. Gegenteil. Absolut – AMI, Schlaganfall, unkorrigierte Koagulopathie, Gallenblasenkrebs, dichtes Infiltrat im Bereich der Gallenblase, Spätschwangerschaft, umfasst – Unverträglichkeit gegenüber Vollnarkose, Peritonitis, Blutungsneigung, Pelzgelbsucht, Choledocholithiasis, Cholangitis, akute und Pseudotumor-Pankreatitis ...Zugriffe. 4 Zugänge. Nach der Anwendung des Pneumoperitoneums - paraumbilikal unterhalb des Nabels entlang der weißen Linie - 1 Trokar. Dann wird alles unter der Kontrolle eines Videomonitors eingeführt! 2 Trokar (instrumentell) – im Epigastrium in der Nähe des Schwertfortsatzes. Der Trokarstilett befindet sich rechts vom Ligamentum rund der Leber. 3 und 4 Trokare – entlang der Mittellinie 4–5 cm über dem Rippenbogen und entlang der Pro-Achsel-Linie auf Höhe des Nabels. Stufen. 1. Traktion – Heben Sie die Gallenblase an und legen Sie die Leberpforte und den Bereich des Callot-Dreiecks zur Vorbereitung frei. 2. Resektion des Peritoneums. Über dem Bauchgang oder Elementen der hepatoduodenalen Falten. 3. Vorbereitung des Callot-Dreiecks. 4. Die Erweiterung der Elemente des Gebärmutterhalses der Gallenblase ist der wichtigste Moment der Operation. 2 Regeln! Wir überprüfen kein Schlauchmaterial. Wir wissen noch nicht, was es ist. Stellen Sie sicher, dass sich nach der Mobilisierung nur 2 Einheiten der Gallenblase nähern – Art und Gang. 5. Überqueren der Arterie. Lasst uns schneiden. 6. Überquerung des Bauchkanals. 6. Mobilisierung des Magen-Darm-Trakts. 7. Aspiration von Flüssigkeit und Drainage der Bauchhöhle. 8. Entfernen des Arzneimittels. 9. Abschluss der Operation – Kontrolluntersuchung der Bauchhöhle, Entfernen der Instrumente, Entfernen des Gases.
102. Operationen zur Verstopfung des Hauptgallengangs. Choledochostomie, Choledochostomie. Varianten biliodigestiver Anastomosen. Choledochotomie. Pok-i – intraoperativ. Cholangiographie, Vorliegen einer anhaltenden Gelbsucht, Erweiterung des gemeinsamen Magengangs. Cholangitis, mehrere Steine in der Gallenblase. Supraduoden-Choledochotomie. Die häufigste Möglichkeit für Eingriffe an den Drüsengängen. Technik. Freilegung des hepatischen Zwölffingerdarmbandes. Freilegen und Unterbinden des Gallengangs, um zu verhindern, dass Steine in den Hauptgallengang gelangen. Die Gallenblase wird entfernt, nachdem der Gallengang durch eine Punktion des Gallengangs mit einer Nadel untersucht wurde, um das Vorhandensein von Galle zu bestätigen. Die Wand des Hauptgallengangs wird zwischen den beiden Haltern ausgebreitet. Die Steine werden mit einer Pinzette entfernt und ein Katheter wird in den gemeinsamen Gang eingeführt, sodass das Ende in die Zwölffingerdarmpapille gelangt. Einführung der Keru-Drainage-Technik. Wir vernähen den Einschnitt in der Wand um den Schlauch herum. Cholangiographie.Retroduodenale Choledochotomie. Schwieriger ist es, weil der retroduodale Teil des Ganges nur über eine kurze Strecke Kontakt mit dem hinteren Teil des Zwölffingerdarms hat. Pok-I – große Steine, die mit supraduodenalen Steinen nicht entfernt werden können. Technik. Mobilisierung der PDK. Sobald der Magen-Darm-Kanal eröffnet ist, führen wir einen Katheter ein und schieben ihn bis zum Darm vor. Wir entfernen das Ende des Katheters und den Stein. Sie versuchen, den Stein in den supraduodalen Bereich in Richtung der Inzisionsstelle zu bewegen, von wo aus wir versuchen, ihn zu entfernen. Wenn dies fehlschlägt, wird ein kleiner Einschnitt einen Teil des Milchgangs verschließen. Choledochostomie.
Pok-ya. Wenn eine Verstopfung des Ductus cholesterin und der großen Zwölffingerdarmpapille nicht mit einer anderen Methode beseitigt werden kann. Voraussetzung – ausreichende Breite des gemeinsamen Magen-Darm-Kanals (2-3 cm). Sie verwenden die supraduode Choledochoduodenostomie. + Der retroperitoneale Bereich ist gut abgegrenzt und wurde zur Umgehung der Zone des häufigsten Gallenabflusses (Ende des Ductus choledochus) geschaffen. Seite an Seite wahr werden. Typen – Finsterer-, Flerken-, Yurash- und Sasse-Methode. Laut Finsterer. – Anlegen einer Anastomose entlang der in Längsrichtung geöffneten Lumen des Ganges und des Zwölffingerdarms. Um eine Verformung der Anastomose zu verhindern, ist eine ausreichende Mobilisierung des Zwölffingerdarms erforderlich. Die Anastomose am Übergang von Gang und Darm wird mit Nähten vernäht. Dann werden der Länge nach 2-2,5 cm geöffnet. Die Kanten werden mit einer durchgehenden Katgutnaht durch alle Schichten des Sthenikums zusammengenäht. Anwendung von Graumaus-Nähten durch die Peripherie der Anastomose = Verengung des Lumens! Laut Flerken. Um das Lumen der Anastomose nicht zu verengen, öffnen wir das Lumen des Zwölffingerdarms, sodass der Längsabschnitt des Ganges in die Mitte des Abstands zwischen Wandabschnitt und Darm fällt. Technisch schwierig! Laut Yurash. Weit geöffnet (2-3 cm) in Längsrichtung in den supraduodeum Teil der gemeinsamen Gallenblase hinein, bis zum Übergang der Falten zwischen dieser und dem späteren Darmrand. Querschnitt des Zwölffingerdarms. Die Anastomose wird mit dünnen synthetischen Fäden durch alle Schichten der Wand und des Ganges gebildet. Die Nähte haben einen Abstand von 2–3 mm, wobei die Wand nach innen genäht und die Nadel nach außen geführt wird. Die Nähte werden nicht gebunden; nachdem alle Nähte platziert wurden, werden sie gleichzeitig vom Chirurgen und dem Assistenten gebunden. Laut Sass. An der Grenze zwischen den supraretroduoden und retroduoden Abschnitten des gemeinsamen Gastrointestinalgangs, was die Mobilisierung des Zwölffingerdarms erfordert. Die Anastomose sollte möglichst tief liegen, da es notwendig ist, den blinden Abschnitt des Ductus choledochus zu verkleinern. Ligation von gastroduoden arti top pancreato-duoden art. Die Verlängerung beträgt 2 cm des retroduoden Teils des Ductus gastrointestinal communis. Eine Inzision des Ductus choledochus dauert 1,5 cm und eine Dissektion des Zwölffingerdarms quer zur Inzision des Ductus choledochus. Eine Reihe unterbrochener Catgut-Nähte verbindet die Kanten der Einschnitte. Vvora ausruhen. Knoten draußen. Graue Seidennähte oben.
So entsteht zwischen dem Leberportal oben, der kleinen Magenkrümmung und dem oberen Teil des Zwölffingerdarms unten eine Duplikation des Peritoneums, genannt Omentum minus,Netz Minus. Die linke Seite des Omentum minus stellt das Ligamentum hepatogastricum dar, lig. Hepatogastricum, und das rechte - das hepatoduodenale Band, lig. hepatoduodenal. Am rechten Rand des Omentum minus (im Lig. transversum duodeni) zwischen den Schichten des Peritoneums befinden sich von rechts nach links der Ductus choledochus, die Pfortader und die A. hepatica communis.
Wenn man sich der kleinen Magenkrümmung nähert, divergieren die beiden Schichten des Peritoneums des Ligamentum hepatogastricus und bedecken die hintere und vordere Oberfläche des Magens. Bei der größeren Krümmung des Magens laufen diese beiden Schichten des Peritoneums zusammen und fallen vor dem Querkolon und vor dem Dünndarm ab. Dann biegen sich diese Schichten des Peritoneums zusammen stark nach hinten, ziehen sich zusammen und steigen hinter den absteigenden Schichten und vor dem Querkolon nach oben. Oberhalb des Mesenteriums des Querkolons gehen die Schichten in das parietale Peritoneum über und bedecken die hintere Bauchwand. Die obere Schicht steigt nach oben, bedeckt die Oberseite der Bauchspeicheldrüse und gelangt dann zur hinteren Wand der Bauchhöhle und zum Zwerchfell.
Im Obergeschoss befinden sich Magen, Leber mit Gallenblase, Milz, oberer Teil des Zwölffingerdarms und Bauchspeicheldrüse. Der obere Boden der Bauchhöhle ist in drei relativ abgegrenzte Säcke oder Schleimbeutel unterteilt: Leber, Prägastrium und Omentum. Leber Der Schleimbeutel liegt rechts vom Ligamentum falciforme der Leber und bedeckt den rechten Leberlappen. Der retroperitoneale obere Pol der rechten Niere und die Nebenniere ragen in die Bursa hepatica hinein. Schleimbeutel prägastrisch befindet sich in der Frontalebene, links vom Ligamentum falciforme der Leber und vor dem Magen. Vorne wird der Schleimbeutel prägastrisch durch die vordere Bauchdecke begrenzt. Die obere Wand dieses Beutels wird vom Diaphragma gebildet. Die Schleimbeutel prägastrisch enthalten den linken Leberlappen und die Milz.
Omentalbeutel, Schleimbeutel omentdlis, befindet sich hinter dem Magen und dem Omentum minus. Es wird oben durch den Schwanzlappen der Leber, unten durch die hintere Platte des Omentum majus, die mit dem Mesenterium des Colon transversum verwachsen ist, vorne durch die hintere Oberfläche des Magens, das Omentum minus und das Ligamentum gastrocolicus und hinten durch begrenzt die Bauchfellschicht, die die Aorta, die untere Hohlvene, den oberen Pol der linken Niere, die linke Nebenniere und die Bauchspeicheldrüse bedeckt. Der Hohlraum der Bursa omentalis ist ein Schlitz in der Frontalebene. Die Umrisse der Höhle des Schleimbeutels sind ungleichmäßig. Oben hat es eine obere Stopfbuchsenaussparung, recessus Vorgesetzter omentdlis, die sich zwischen dem lumbalen Teil des Zwerchfells hinten und der hinteren Oberfläche des Schwanzlappens der Leber vorne befindet. Links erstreckt sich die Bursa omentalis bis zum Milzhilus und bildet den Recessus splenica. recessus liendlis [ Milz- cusj. Die Wände dieser Vertiefung sind Bänder: vorne - lig. gastroliennale / gastrosplenicum/, hinter - lig. phrenicolenale [ phrenicosplenicum/, Dabei handelt es sich um ein Duplikat des Peritoneums, das sich vom Zwerchfell bis zum hinteren Ende der Milz erstreckt. Der Omentumbeutel hat auch eine untere Omentalmulde, recessus minderwertig omentdlis, Es befindet sich zwischen dem Ligamentum gastrocolicus vorne und oben und der hinteren Platte des Omentum majus und ist hinten und unten mit dem Colon transversum und seinem Mesenterium verschmolzen. Stopfbuchse durch das Stopfbuchsloch stecken, Foramen epiploicum [ omentdle] (Foramen des Peitschenschwerts), kommuniziert mit der Leberschleimbeutel. Das Loch ist klein, hat einen Durchmesser von 2-3 cm (1-2 Finger passen hinein) und befindet sich hinter dem Ligamentum hepatoduodenale an seinem freien rechten Rand. Das Foramen omentalis wird oben vom Schwanzlappen der Leber, unten vom oberen Teil des Zwölffingerdarms und hinten vom parietalen Peritoneum begrenzt, das die Vena cava inferior bedeckt.
Mittlere Etage Die Bauchhöhle befindet sich unterhalb des Querkolons und ihr Mesenterium geht in die untere Etage über, die sich in der Beckenhöhle befindet. Zwischen der rechten Seitenwand der Bauchhöhle einerseits und dem Blinddarm und dem aufsteigenden Dickdarm andererseits befindet sich ein schmaler vertikaler Spalt, der rechte parakolische Sulcus genannt wird. Sulkus Paracolicus Geschicklichkeit, der auch rechter Seitenkanal genannt wird. Linker parakolischer Sulcus, Sulkus Paracolicus unheimlich (linker Seitenkanal), gelegen zwischen der linken Wand der Bauchhöhle auf der linken Seite, dem absteigenden Dickdarm und dem Sigma auf der rechten Seite.
Der Teil des mittleren Bodens der Bauchhöhle, begrenzt durch Crtp,)ija, oberhalb und links durch den Dickdarm, wird durch das Mesenterium des Dünndarms in zwei ziemlich große Fossae geteilt – den rechten und linken Mesenterialsinus (Sinus). ). Rechter Mesenterialsinus, Sinus mesentericus Geschicklichkeit, hat den Umriss eines Dreiecks, dessen Spitze nach unten und nach rechts zeigt, in Richtung des Endabschnitts des Ileums. Die Wände des rechten Sinus mesenterica werden rechts vom aufsteigenden Dickdarm, oben von der Wurzel des Mesenteriums des Querkolons und links von der Wurzel des Mesenteriums des Dünndarms gebildet. In der Tiefe dieses Sinus, retroperitoneal, befinden sich der letzte Abschnitt des absteigenden Teils des Zwölffingerdarms und sein horizontaler (unterer) Teil, der untere Teil des Pankreaskopfes, ein Segment der unteren Hohlvene von der Wurzel aus das Mesenterium des Dünndarms unten bis zum Zwölffingerdarm oben, der rechte Harnleiter, Gefäße, Nerven und die Lymphknoten. Linker Mesenterialsinus, Sinus mesentericus unheimlich, hat ebenfalls die Form eines Dreiecks, aber seine Spitze zeigt nach oben und nach links, in Richtung der linken Biegung des Dickdarms. Die Grenzen des linken Mesenterialsinus sind links der absteigende Dickdarm und das Mesenterium des Sigmas, rechts die Wurzel des Dünndarmgekrönchens. Unten hat dieser Sinus keine klar definierte Grenze und kommuniziert frei mit der Beckenhöhle (mit dem unteren Boden der Bauchhöhle). Im linken Sinus mesenterica liegen retroperitoneal der aufsteigende Teil des Zwölffingerdarms, die untere Hälfte der linken Niere, der Endteil der Bauchaorta, der linke Harnleiter, Gefäße, Nerven und Lymphknoten.
Die parietale Schicht des Peritoneums, die die hintere Wand der Bauchhöhle bedeckt, bildet an den Übergangsstellen von einem Organ zum anderen oder zwischen dem Rand des Organs und der Bauchdecke Falten und Vertiefungen – Grübchen. Diese Vertiefungen sind der Ort der möglichen Bildung retroperitonealer Hernien.
So befinden sich zwischen der Zwölffingerdarm-Jejunal-Flexur rechts und der oberen Zwölffingerdarmfalte links kleine Beträge oberer und unterer Zwölffingerdarm-Recessus,recessus Zwölffingerdarm Vorgesetzter et minderwertig. An der Stelle, an der das Ileum in den Blinddarm eintritt, bildet das Peritoneum Falten, die es begrenzen Spitze Und untere Ileozökalaussparungen,recessus Ileocaecdles Vorgesetzter et minderwertig, befindet sich oberhalb bzw. unterhalb des terminalen Ileums. Der allseitig vom Peritoneum bedeckte Blinddarm befindet sich in der rechten Beckengrube. Die mit Peritoneum bedeckte hintere Oberfläche des Darms ist sichtbar, wenn man ihn nach vorne und oben zieht. Gleichzeitig sind sie deutlich sichtbar Blinddarmfalten des Peritoneums,Plicae caecdles, Er erstreckt sich von der Oberfläche des Iliacusmuskels bis zur Seitenfläche des Blinddarms. Hier verfügbar retrokolische Rezession,recessus retrocaecdlis, befindet sich unter dem unteren Teil des Blinddarms.
Das Sigma verfügt über ein Mesenterium, dessen Größe je nach Größe des Dickdarms variiert. Auf der linken Seite des Mesenteriums dieses Darms, an der Stelle, an der das linke Blatt des Mesenteriums an der Beckenwand befestigt ist, befindet sich ein kleines intersigmoidaler Recessus,recessus intersigmoideus.
GESUNDHEITSMINISTERIUM DER REPUBLIK WEISSRUSSLAND
BILDUNGSEINRICHTUNG
„STAATLICHE MEDIZINISCHE UNIVERSITÄT GOMEL“
Abteilung für menschliche Anatomie
Mit einem Kurs über operative Chirurgie und topografische Anatomie
E. Y. DOROSHKEVICH, S. V. DOROSHKEVICH,
I. I. LEMESHEVA
AUSGEWÄHLTE FRAGEN
TOPOGRAPHISCHE ANATOMIE
UND OPERATIVE CHIRURGIE
Pädagogisches und methodisches Handbuch
Zu praktischen Kursen zur topografischen Anatomie
Und operative Chirurgie für Medizinstudenten im 4. Jahr,
Medizinische Diagnostikfakultäten und Ausbildungsfakultäten
Spezialisten für das Ausland, die in ihrem Fachgebiet studieren
„Allgemeinmedizin“ und „Medizinische Diagnostik“
Gomel
GomSMU
KAPITEL 1
CHIRURGISCHE ANATOMIE DER BAUCHHÖHLE
TOPOGRAPHIE DER OBERGESCHOSSKÖRPER
ABDOMINAL
1.1 Bauch (cavitas abdominis) und seine Böden (Grenzen, Inhalte)
Grenzen der Bauchhöhle.
Die obere Wand der Bauchhöhle wird vom Zwerchfell gebildet, die hintere Wand wird von den Lendenwirbeln und Muskeln der Lendengegend gebildet, die anterolaterale Wand wird von den Bauchmuskeln gebildet, der untere Rand ist die Endlinie. Alle diese Muskeln sind von der kreisförmigen Faszie bedeckt – der Faszie des Bauches, die als intraabdominale Faszie bezeichnet wird (Fascia endoabdominalis); Es begrenzt direkt den Raum, der Bauchhöhle (oder Bauchhöhle) genannt wird.
Die Bauchhöhle ist in 2 Abschnitte unterteilt:
Bauchhöhle (cavitas peritonei)- ein schlitzartiger Raum, der sich zwischen den Schichten des parietalen und viszeralen Peritoneums befindet und intraperitoneale und mesoperitoneale Organe enthält;
retroperitonealer Raum (Spatium retroperitoneale)- liegt zwischen der parietalen Schicht des Peritoneums, die die hintere Bauchwand bedeckt, und der intraabdominalen Faszie; es enthält extraperitoneale Organe.
Das Colon transversum und sein Mesenterium bilden ein Septum, das die Bauchhöhle in zwei Stockwerke unterteilt – das obere und das untere.
Im Obergeschoss der Bauchhöhle befinden sich: Leber, Magen, Milz, Bauchspeicheldrüse, obere Hälfte des Zwölffingerdarms. Die subgastrische Drüse liegt hinter dem Peritoneum; Es wird jedoch als Organ der Bauchhöhle betrachtet, da der chirurgische Zugang zu ihm in der Regel durch Durchtrennung erfolgt. In der unteren Etage befinden sich die Schlingen des Dünndarms (mit der unteren Hälfte des Zwölffingerdarms) und des Dickdarms.
Topographie des Peritoneums: Verlauf, Kanäle, Nebenhöhlen, Beutel, Bänder, Falten, Taschen
Peritoneum (Peritoneum)– eine dünne seröse Membran mit einer glatten, glänzenden und gleichmäßigen Oberfläche. Besteht aus parietalem Peritoneum (Peritoneum parietale) Auskleidung der Bauchdecke und des viszeralen Peritoneums (Peritoneum viscerale) Bedeckung der Bauchorgane. Zwischen den Blättern befindet sich ein schlitzartiger Raum, der Peritonealhöhle genannt wird und eine kleine Menge seröser Flüssigkeit enthält, die die Oberfläche der Organe befeuchtet und die Peristaltik erleichtert. Das parietale Peritoneum kleidet die Innenseite der vorderen und seitlichen Bauchwände aus, oben reicht es bis zum Zwerchfell, unten bis zum großen und kleinen Becken, hinten reicht es nicht bis zur Wirbelsäule und begrenzt so den retroperitonealen Raum.
Die Beziehung des viszeralen Peritoneums zu den Organen ist nicht in allen Fällen gleich. Einige Organe sind allseitig damit bedeckt und liegen intraperitoneal: Magen, Milz, Dickdarm, Blinddarm, Quer- und Sigma und manchmal auch die Gallenblase. Sie sind vollständig mit Peritoneum bedeckt. Einige Organe sind auf drei Seiten mit viszeralem Peritoneum bedeckt, d. h. sie liegen mesoperitoneal: Leber, Gallenblase, aufsteigender und absteigender Dickdarm, Anfangs- und Endabschnitt des Zwölffingerdarms.
Einige Organe sind nur auf einer Seite – extraperitoneal – vom Peritoneum bedeckt: Zwölffingerdarm, Bauchspeicheldrüse, Nieren, Nebennieren, Blase.
Verlauf des Peritoneums
Das viszerale Peritoneum, das die Zwerchfelloberfläche der Leber bedeckt, geht zu ihrer unteren Oberfläche über. Die Blätter des Peritoneums, eines vom vorderen Teil der unteren Oberfläche der Leber, das andere vom hinteren, treffen sich am Tor und steigen nach unten in Richtung der kleinen Kurvatur des Magens und des ersten Teils des Zwölffingerdarms ab, wobei sie daran beteiligt sind Bildung der Bänder des Omentum minus. Die Blätter des Omentum minus gehen an der kleinen Krümmung des Magens auseinander, bedecken den Magen vorne und hinten und vereinigen sich an der großen Krümmung des Magens wieder nach unten, um die vordere Platte des Omentum majus zu bilden (Omentum majus). Nachdem die Blätter, manchmal bis zur Schambeinfuge, abgesunken sind, werden sie eingewickelt und nach oben gerichtet und bilden die hintere Platte des Omentum majus. Beim Erreichen des Colon transversum biegen sich die Schichten des Peritoneums um dessen anterosuperior Oberfläche und reichen bis zur hinteren Wand der Bauchhöhle. An diesem Punkt divergieren sie, und einer von ihnen erhebt sich nach oben, bedeckt die Bauchspeicheldrüse, die hintere Wand der Bauchhöhle, teilweise das Zwerchfell und gelangt, nachdem er den hinteren unteren Rand der Leber erreicht hat, zu deren unterer Oberfläche. Die andere Schicht des Peritoneums wickelt sich ein und verläuft in die entgegengesetzte Richtung, d. h. von der hinteren Bauchwand zum Querkolon, das sie bedeckt, und kehrt dann wieder zur hinteren Bauchwand zurück. So entsteht das Mesenterium des Colon transversum (Mesokolon transversum), bestehend aus 4 Schichten Peritoneum. Von der Wurzel des Mesenteriums des Colon transversum steigt die Peritoneumschicht ab und kleidet als parietales Peritoneum die hintere Bauchwand aus. Anschließend bedeckt sie den aufsteigenden (rechts) und absteigenden (linken) Dickdarm auf drei Seiten. Nach innen vom aufsteigenden und absteigenden Dickdarm bedeckt die parietale Schicht des Peritoneums die Organe des retroperitonealen Raums und bildet, wenn sie sich dem Dünndarm nähert, dessen Mesenterium, das den Darm von allen Seiten umhüllt.
Von der hinteren Bauchwand steigt die Parietalschicht des Peritoneums in die Beckenhöhle ab, wo sie die ersten Abschnitte des Rektums bedeckt, dann die Wände des kleinen Beckens auskleidet und zur Blase gelangt (bei Frauen bedeckt sie zunächst). die Gebärmutter) und bedeckt sie von hinten, von den Seiten und von oben. Von der Oberseite der Blase verläuft das Peritoneum zur Vorderwand des Bauches und verschließt die Bauchhöhle. Für einen detaillierteren Verlauf des Peritoneums in der Beckenhöhle siehe das Thema „Topografische Anatomie des Beckens und Perineums“.
Kanäle
An den Seiten des aufsteigenden und absteigenden Dickdarms befinden sich der rechte und der linke Bauchkanal (canalis lateralis dexter et sinister), entsteht durch den Übergang des Peritoneums von der Seitenwand des Bauches zum Dickdarm. Der rechte Kanal stellt eine Verbindung zwischen der oberen und der unteren Etage her. Im linken Kanal besteht aufgrund des Vorhandenseins des Zwerchfell-Kolik-Bandes keine Verbindung zwischen der oberen Etage und der unteren Etage (lig. phrenicocolicum).
Bauchnebenhöhlen(Sinus Mesentericus Dexter und Sinus Mesentericus Sinister)
Der rechte Sinus ist begrenzt: rechts - durch den aufsteigenden Dickdarm; oben - das Querkolon, links - das Mesenterium des Dünndarms. Linker Sinus: links - der absteigende Dickdarm, unten - der Eingang zur Beckenhöhle, rechts - das Mesenterium des Dünndarms.
Taschen
Omentalbeutel(Bursa omentalis) begrenzt: anterior durch das Omentum minus, die hintere Magenwand und das Ligamentum gastrocolicus; dahinter - das parietale Peritoneum, das die Bauchspeicheldrüse, einen Teil der Bauchaorta und die Vena cava inferior bedeckt; oben - die Leber und das Zwerchfell; unten - das Colon transversum und sein Mesenterium; links - die Magen- und Zwerchfell-Milz-Bänder, der Milzhilus. Kommuniziert über die Bauchhöhle Stopfbuchsloch(Foramen epiploicum, Foramen von Winslow), Vorne begrenzt durch das Ligamentum hepato-duodenale, unten durch das Ligamentum duodeni-renale und den oberen horizontalen Teil des Zwölffingerdarms, hinten durch das Ligamentum hepatorenale und das parietale Peritoneum, das die Vena cava inferior bedeckt, oben durch den Schwanzlappen der Leber.
Rechter Leberschleimbeutel(Bursa hepatica dextra) Es wird oben durch das Sehnenzentrum des Zwerchfells begrenzt, unten durch die Zwerchfellfläche des rechten Leberlappens, hinten durch das rechte Koronarband, links durch das Ligamentum falciforme. Es ist der Ort subphrenischer Abszesse.
Linker Leberschleimbeutel(Bursa hepatica sinistra) Oben begrenzt durch das Zwerchfell, hinten durch das linke Herzkranzband der Leber, rechts durch das Ligamentum falciforme, links durch das linke Dreiecksband der Leber, unten durch die Zwerchfellfläche des linken Leberlappens.
Schleimbeutel prägastrisch(Bursa pregastrica) Es wird von oben durch den linken Leberlappen begrenzt, vorne durch das parietale Peritoneum der vorderen Bauchwand, hinten durch das Omentum minus und die vordere Oberfläche des Magens, rechts durch das Ligamentum falciforme.
Präomentaler Raum(Spatium preepiploicum)- ein langer Spalt zwischen der Vorderfläche des Omentum majus und der Innenfläche der vorderen Bauchwand. Durch diese Lücke kommunizieren Ober- und Untergeschoss miteinander.
Peritoneale Bänder
An den Stellen, an denen das Bauchfell von der Bauchdecke zu einem Organ oder von Organ zu Organ übergeht, bilden sich Bänder (ligg. peritonei).
Hepatoduodenales Band(lig. hepatoduodenale) erstreckt sich zwischen der Porta hepatis und dem oberen Teil des Zwölffingerdarms. Links geht es in das Ligamentum hepatogastricum über und rechts endet es mit einer freien Kante. Zwischen den Blättern des Bandes verlaufen: rechts der gemeinsame Gallengang und die ihn bildenden gemeinsamen Leber- und Zystengänge, links die eigentliche Leberarterie und ihre Äste, dazwischen und dahinter die Pfortader ("ZWEI"- Ductus, Vene, Arterie von rechts nach links) sowie Lymphgefäße und -knoten, Nervengeflechte.
Hepatogastralisches Band(lig. hepatogastricum) Es handelt sich um eine Verdoppelung des Bauchfells, die sich zwischen den Pforten der Leber und der kleinen Krümmung des Magens erstreckt; links gelangt es in die abdominale Speiseröhre, rechts setzt es sich im Ligamentum hepatoduodenale fort.
Die Leberäste des vorderen Vagusstamms verlaufen durch den oberen Teil des Bandes. An der Basis dieses Bandes befindet sich in manchen Fällen die linke Magenarterie, begleitet von einer gleichnamigen Vene, häufiger liegen diese Gefäße jedoch an der Magenwand entlang der kleinen Krümmung. Darüber hinaus befindet sich häufig (in 16,5 %) eine akzessorische Leberarterie im gespannten Teil des Bandes, die von der linken Magenarterie kommt. In seltenen Fällen verläuft hier der Hauptstamm der linken Magenvene oder ihrer Nebenflüsse.
Bei der Mobilisierung des Magens entlang der kleinen Krümmung, insbesondere wenn das Band in der Nähe des Leberportals präpariert wird (bei Magenkrebs), muss die Möglichkeit in Betracht gezogen werden, dass die linke akzessorische Leberarterie hier verläuft, da deren Kreuzung dazu führen kann zur Nekrose des linken Leberlappens oder eines Teils davon.
Rechts, an der Basis des Ligamentum hepatogastricum, verläuft die rechte Magenarterie, begleitet von der gleichnamigen Vene.
Hepatorenales Band(lig. hepatorenal) entsteht an der Übergangsstelle des Peritoneums von der Unterseite des rechten Leberlappens zur rechten Niere. Die Vena cava inferior verläuft durch den medialen Teil dieses Bandes.
Magen-Darm-Band(lig. gastrophrenicum) befindet sich links von der Speiseröhre, zwischen der Unterseite des Magens und dem Zwerchfell. Das Band hat die Form einer dreieckigen Platte und besteht aus einer Schicht Peritoneum, an deren Basis sich lockeres Bindegewebe befindet. Links geht das Band in die oberflächliche Schicht des Magen- und Milzbandes über und rechts in den vorderen Halbkreis der Speiseröhre.
Als Übergang des Peritoneums vom Ligamentum gastrophenica zur Vorderwand der Speiseröhre und zum Lig. hepatogastricum wird bezeichnet Zwerchfell-Ösophagusband(lig. phrenicooesophageum).
Zwerchfell-Ösophagusband (lig. phrenicoesophageum) stellt den Übergang des parietalen Peritoneums vom Zwerchfell zur Speiseröhre und zum Herzteil des Magens dar. An seiner Basis befinden sich lose Gewebe entlang der Vorderfläche der Speiseröhre R. Speiseröhre aus A. gastrica sinistra und der Stamm des linken Vagusnervs.
Magen- und Milzband (lig. gastrolienale), gespannt zwischen dem Magenfundus und dem oberen Teil der großen Kurvatur und dem Milzhilus, liegt unterhalb des Magen-Darm-Bandes. Es besteht aus 2 Schichten des Peritoneums, zwischen denen kurze Magenarterien verlaufen, begleitet von gleichnamigen Venen. Weiter nach unten gelangt es in das Lig. gastrocolicus.
Magen-Darm-Band (lig. gastrocolicum) besteht aus 2 Schichten Peritoneum. Es ist der Anfangsabschnitt des Omentum majus und liegt zwischen der großen Kurvatur des Magens und dem Querkolon. Dabei handelt es sich um das breiteste Band, das streifenförmig vom unteren Pol der Milz bis zum Pylorus verläuft. Das Band ist lose mit dem vorderen Halbkreis des Colon transversum sowie mit diesem verbunden tenia omentalis. Es enthält die rechte und linke gastroepiploische Arterie.
Gastropankreasband (lig. gastropancreaticum) liegt zwischen der Oberkante der Bauchspeicheldrüse und dem Herzteil sowie dem Magenfundus. Es ist ganz klar definiert, ob das Magen-Darm-Band durchtrennt und der Magen nach vorne und oben gezogen wird.
Im freien Rand des Magen-Pankreas-Bandes befinden sich der Anfangsabschnitt der linken Magenarterie und der gleichnamigen Vene sowie Lymphgefäße und Magen-Pankreas-Lymphknoten. Darüber hinaus befinden sich an der Basis des Bandes am oberen Rand der Bauchspeicheldrüse pankreasplenische Lymphknoten.
Pyloropankreasband (lig. pyloropancreaticum) In Form einer Duplikation des Bauchfells wird es zwischen dem Pylorus und dem rechten Teil des Bauchspeicheldrüsenkörpers gespannt. Es hat die Form eines Dreiecks, dessen eine Seite an der hinteren Oberfläche des Pylorus und die andere an der vorderen unteren Oberfläche des Drüsenkörpers befestigt ist; der freie Rand des Bandes ist nach links gerichtet. Manchmal wird das Band nicht ausgedrückt.
Im Pyloropankreasband sind kleine Lymphknoten konzentriert, die von Krebs im Pylorusteil des Magens betroffen sein können. Daher ist es bei einer Magenresektion notwendig, dieses Band zusammen mit den Lymphknoten vollständig zu entfernen.
Zwischen dem gastropankreatischen und dem pylorisch-pankreatischen Band befindet sich eine schlitzartige gastropankreatische Öffnung. Form und Größe dieses Lochs hängen vom Entwicklungsgrad der genannten Bänder ab. Manchmal sind die Bänder so entwickelt, dass sie einander überlappen oder zusammenwachsen und so die Magen-Pankreas-Öffnung verschließen.
Dies führt dazu, dass der Hohlraum der Bursa omentalis durch Bänder in zwei separate Räume unterteilt wird. Wenn sich in solchen Fällen pathologischer Inhalt in der Höhle des Schleimbeutels befindet (Erguss, Blut, Mageninhalt usw.), befindet er sich in dem einen oder anderen Raum.
Phrenicolienale-Band (lig. phrenicolienale) liegt tief im hinteren Teil des linken Hypochondriums, zwischen dem Rippenteil des Zwerchfells und dem Milzhilus.
Zwischen dem Rippenteil des Zwerchfells und der linken Flexur des Dickdarms besteht Spannung Zwerchfell-Kolik-Band (Lig. phrenicocolicum). Dieses Band bildet zusammen mit dem Querkolon eine tiefe Tasche, in der sich der vordere Milzpol befindet.
Zwölffingerdarm-Nierenband (lig. duodenorenale) Befindet sich zwischen dem hinteren oberen Rand des Zwölffingerdarms und der rechten Niere und begrenzt das Foramen omentalis von unten.
Halteband des Zwölffingerdarms bzw Treitz-Band (lig. suspensorium duodeni s. lig. Treitz) Gebildet durch eine Bauchfellfalte, die den Muskel bedeckt, der den Zwölffingerdarm aufhängt (m. suspensorius duodeni). Die Muskelbündel des letzteren entspringen an der Wendestelle der kreisförmigen Muskelschicht des Darms. Der schmale und starke Muskel ist gerichtet flexura duodenojejunalis nach oben, hinter der Bauchspeicheldrüse dehnt es sich fächerförmig aus und ist in die Muskelbündel der Zwerchfellbeine eingewebt.
Pankreasplenalband (lig. pancreaticolienale) ist eine Fortsetzung des Zwerchfell-Milz-Bandes und eine Bauchfellfalte, die sich vom Schwanz der Drüse bis zum Milztor erstreckt.
1. Rund um den Anfang des Jejunums bildet das parietale Peritoneum eine Falte, die den Darm von oben und links begrenzt – dies ist die obere Zwölffingerdarmfalte (Plica duodenalis superior). In diesem Bereich ist der Recessus duodeni superior lokalisiert (Recessus duodenalis superior), rechts wird es durch die Zwölffingerdarm-Jejunal-Flexur 12 begrenzt, oben und links durch die obere Zwölffingerdarmfalte, in der die untere Mesenterialvene verläuft.
2. Links vom aufsteigenden Teil des Zwölffingerdarms befindet sich eine paraduodenale Falte (Plica paraduodenalis). Diese Falte begrenzt den inkonstanten Recessus paraduodenalis nach vorne. (Recessus paraduodenalis), dessen Hinterwand das parietale Peritoneum ist.
3. Links und unten verläuft vom aufsteigenden Teil des Zwölffingerdarms die untere Zwölffingerdarmfalte (Plica duodenalis inferior), wodurch der Recessus inferior duodeni begrenzt wird (Recessus duodenalis inferior).
4. Links von der Wurzel des Mesenteriums des Dünndarms, hinter dem aufsteigenden Teil des Zwölffingerdarms, befindet sich ein retroduodenaler Recessus (recessus retroduodenalis).
5. An der Stelle, an der das Ileum in den Blinddarm eintritt, bildet sich eine Ileozökalfalte (Plica ileocecalis). Es befindet sich zwischen der medialen Wand des Blinddarms und der vorderen Wand des Ileums und verbindet außerdem die mediale Wand des Blinddarms oben mit der unteren Wand des Ileums und unten mit der Basis des Blinddarms. Unter der Ileozökalfalte liegen die Taschen oberhalb und unterhalb des Ileums: die oberen und unteren Ileozökalrezessionen (Recessus ileocecalis superior und Recessus ileocecalis inferior). Der obere Ileozökal-Recessus wird oben durch die Ileokolfalte, unten durch den Endabschnitt des Ileums und außen durch den Anfangsabschnitt des aufsteigenden Dickdarms begrenzt. Der untere Ileozökal-Recessus wird oben durch das terminale Ileum, hinten – durch das Mesenterium des Blinddarms und vorne – durch die Ileozökalfalte des Peritoneums begrenzt.
6. Postkolische Rezession (recessus retrocecalis) Vorne begrenzt durch den Blinddarm, hinten durch das parietale Peritoneum und außen durch die Blinddarmfalten des Peritoneums (plicae cecales), erstreckt sich zwischen dem seitlichen Rand des Blinddarmbodens und dem parietalen Peritoneum der Fossa iliaca.
7. Intersigmoidaler Recessus (Recessus intersigmoideus) befindet sich links an der Wurzel des Mesenteriums des Sigmas.