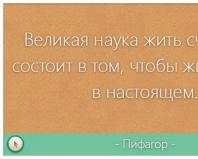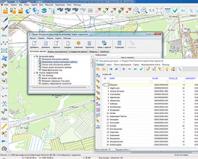Frontale Sagittal- und Horizontalebene. Einführung in die Anatomie. Aus welchen Teilen besteht unser Körper?
Frontalebene.
3. Horizontale Ebene.
Linien:
1. Vorderseite - vordere Mittellinie, rechtes und linkes Sternal (entlang der entsprechenden Ränder des Brustbeins zeichnen). Rechtes und linkes Mittelklavikular (durch die Mitte des Schlüsselbeins).
2. Seitenfläche vordere, mittlere, hintere, Achsellinien. Durch die entsprechenden Ränder und die Mitte der Fossa axillaris führen.
3. Rückenlinie- hintere Mitte, auch bekannt als Wirbel, auch bekannt als Wirbel, rechter und linker Paravertebral (paravertebral). Das rechte und das linke Schulterblatt werden durch die unteren Winkel der Schulterblätter geführt.
Körpertypen:
Der Körpertyp wird durch genetische (erbliche) Faktoren, Umwelteinflüsse und soziale Bedingungen bestimmt.
1. Mesomorph Durchschnittliche Normostheniker sind Menschen, deren anatomische Merkmale nahe an den durchschnittlichen Parametern liegen (unter Berücksichtigung von Alter und Geschlecht).
2. Brachymorph(Brachus broadus) Hyperstheniker. Sie zeichnen sich durch überwiegende Quermaße aus, sind wohlgenährt und nicht sehr groß. Solche Menschen haben ein hohes Zwerchfell, verkürzte Lungen und ein horizontales Herz.
3. Dolichomorph(Dolichos lang) Astheniker überwiegen in ihrer Längsgröße, sind schlank und leicht.
Tabelle Nr. 1
| Flugzeuge | Achsen | Linien | Körpertypen |
| 1. Horizontal verläuft parallel zur (II) Horizontlinie und teilt den vertikal stehenden menschlichen Körper in Ober- und Unterteil. 2. Frontal verläuft parallel zur (II)-Ebene der Stirn (Frons) und teilt den Körper in einen vorderen und einen hinteren Teil. 3. Sagittal Es verläuft wie in Pfeilrichtung (Sagitta) und teilt den Körper in einen rechten und einen linken Teil. | Zur Charakterisierung von Bewegungen an Gelenken werden Achsen verwendet. 1. Frontal Die Bewegungsachse wird Flexion und Extension sein. 2 . Sagittal Abduktions- und Adduktionsachse. 3. Vertikal Drehachse für Drehung | 1.Vorderseite; vordere Mittellinie, rechte linke Sternallinien werden entlang der entsprechenden Kanten des Brustbeins gezeichnet. Rechtes und linkes Mittelklavikular durch die Mitte des Schlüsselbeins. 2. Seitenfläche vordere, mittlere, hintere, Achsellinien. Durch die entsprechenden Ränder und die Mitte der Fossa axillaris führen. 3. Hintere Linie; hintere Mitte, auch bekannt als Wirbel, auch bekannt als Wirbel, rechter und linker Paravertebral (paravertebral) Das rechte und linke Schulterblatt werden durch die unteren Ecken der Schulterblätter geführt. | Der Körpertyp wird durch genetische (erbliche) Faktoren, Umwelteinflüsse und soziale Bedingungen bestimmt. 1. Mesomorph durchschnittlich, normosthenisch sind Menschen, deren anatomische Merkmale nahe an den durchschnittlichen Parametern liegen (unter Berücksichtigung von Alter und Geschlecht). 2. Brachymorph(Brachus breit) hypersthenisch. Sie zeichnen sich durch überwiegende Quermaße aus, sind wohlgenährt und nicht sehr groß. Sie haben ein hohes Zwerchfell, verkürzte Lungen und ein horizontales Herz. 3. Dolichomorph(Dolichos lang) Asthenische überwiegen in Längsgröße, schlank und leicht. |
Kontrollfragen:
1. Definition der Konzepte Anatomie, Physiologie, Ontogenese?
2. Perioden der Ontogenese?
3. Maslows Pyramide der menschlichen Bedürfnisse?
4. Beschreiben Sie die Bewegungen in den Gelenken?
5. Zweck der Linie?
6. Werden Körpertypen bestimmt?
7. Welche Körpertypen gibt es?
8. Beschreiben Sie den brachymorphen Körpertyp?
9. Groß, dünn, Herz senkrecht angeordnet, niedriges Zwerchfell:
A. Dolichomorpher Körpertyp.
B. Mesomorpher Körpertyp.
B. Brachymorpher Körpertyp.
SAGITTALFLUGZEUG
anat. eine Ebene, die den Körper in Längsrichtung in eine rechte und eine linke Hälfte teilt.
Wörterbuch ausländischer Ausdrücke. 2012
Siehe auch Interpretationen, Synonyme, Bedeutungen des Wortes und was SAGITTALPLANE auf Russisch in Wörterbüchern, Enzyklopädien und Nachschlagewerken ist:
- SAGITTALFLUGZEUG im Neuen Fremdwörterbuch:
(lat. sagitta Pfeil) anat. eine Ebene, die den Körper in Längsrichtung in rechts und links teilt... - FLUGZEUG im Wörterbuch der Postmoderne:
- ein Begriff aus der naturwissenschaftlichen Tradition, der in der modernen Philosophie (Heidegger, Deleuze, Derrida etc.) im Kontext der Konstituierung des philosophischen Paradigmas multidimensionaler Strukturen verwendet wird... - FLUGZEUG im großen enzyklopädischen Wörterbuch:
- FLUGZEUG in der Großen Sowjetischen Enzyklopädie, TSB:
eines der Grundkonzepte der Geometrie. In einer systematischen Darstellung der Geometrie wird der Begriff „P“ verwendet. wird normalerweise als eines der ersten Konzepte angesehen, das nur... - FLUGZEUG im Enzyklopädischen Wörterbuch von Brockhaus und Euphron:
(geom.) - siehe... - FLUGZEUG im Modern Encyclopedic Dictionary:
- FLUGZEUG im Enzyklopädischen Wörterbuch:
Die einfachste Fläche ist so beschaffen, dass jede Gerade, die durch zwei ihrer Punkte verläuft, zu ... gehört. - FLUGZEUG im Enzyklopädischen Wörterbuch:
, -i, pl. -und, -ey und -ey, w. 1. Siehe Wohnung. 2.(s). In der Geometrie: eine Fläche, die zwei Dimensionen hat. Linie... - FLUGZEUG im Großen Russischen Enzyklopädischen Wörterbuch:
EBENHEIT, die einfachste Oberfläche. Das Konzept von P. (wie ein Punkt und eine gerade Linie) ist eines der wichtigsten. Konzepte der Geometrie. P. hat die Eigenschaft, dass... - FLUGZEUG in der Brockhaus- und Efron-Enzyklopädie:
(geom.) ? cm. … - FLUGZEUG
Ebenheit, Ebenheit, Ebenheit, Ebenheit, Ebenheit, Ebenheit, Ebenheit, Ebenheit, Ebenheit, Ebenheit, Ebenheit, … - FLUGZEUG im vollständigen akzentuierten Paradigma nach Zaliznyak:
Ebenheit, Ebenheit, Ebenheit, Ebenheit, Ebenheit, Ebenheit, Ebenheit, Ebenheit, Ebenheit, Ebenheit, Ebenheit, … - FLUGZEUG im Thesaurus des russischen Wirtschaftsvokabulars:
- FLUGZEUG im russischen Sprachthesaurus:
Syn: flach, flach Ameise: gerippt, ... - FLUGZEUG in Abramovs Synonymwörterbuch:
cm. … - FLUGZEUG im russischen Synonymwörterbuch:
Syn: flach, flach Ameise: gerippt, ... - SAGITTAL
- FLUGZEUG im neuen erklärenden Wörterbuch der russischen Sprache von Efremova:
1. g. Eine Fläche mit nur zwei Dimensionen, zwischen zwei beliebigen Punkten kann eine gerade Linie gezogen werden, die vollständig mit ihr verschmilzt... - FLUGZEUG in Lopatins Wörterbuch der russischen Sprache:
- FLUGZEUG im vollständigen Rechtschreibwörterbuch der russischen Sprache:
Flugzeug, -i, pl. -i, -ey (Oberfläche) und -ey (flach...) - FLUGZEUG im Rechtschreibwörterbuch:
Ebenheit, -i, pl. -i, -`ey (Oberfläche) und -ey (flach...) - FLUGZEUG in Ozhegovs Wörterbuch der russischen Sprache:
<= плоский плоскость В геометрии: поверхность, имеющая два измерения Линия на плоскости. плоскость Obs плоские N3 тривиальные слова, тривиальность Говорить … - FLUGZEUG im Modern Explanatory Dictionary, TSB:
einfachste Oberfläche. Das Konzept einer Ebene (wie ein Punkt und eine gerade Linie) ist eines der Grundkonzepte der Geometrie. Ein Flugzeug hat die Eigenschaft, dass jedes... - FLUGZEUG in Uschakows Erklärendem Wörterbuch der russischen Sprache:
Flugzeuge, Plural Flugzeuge, Flugzeuge, g. 1. Nur Einheiten Ablenkung Substantiv flach (buchen). Flache Brust. Die Ebene der Witze. 2. Oberfläche mit... - SAGITTAL
sagittal g. Zersetzung Eine Ebene, die den Körper in Längsrichtung in eine rechte und eine linke Hälfte teilt; sagittal... - FLUGZEUG im Ephraims erklärenden Wörterbuch:
Flugzeug 1. g. Eine Fläche mit nur zwei Dimensionen, zwischen zwei beliebigen Punkten kann eine gerade Linie gezogen werden, die vollständig mit ... verschmilzt. - SAGITTAL
Und. Zersetzung Eine Ebene, die den Körper in Längsrichtung in eine rechte und eine linke Hälfte teilt; sagittal... - FLUGZEUG im Neuen Wörterbuch der russischen Sprache von Efremova:
- SAGITTAL
Und. Zersetzung Eine Ebene, die den Körper in Längsrichtung in eine rechte und eine linke Hälfte teilt; sagittal... - FLUGZEUG im Großen Modernen Erklärwörterbuch der russischen Sprache:
ICH Eine Fläche mit nur zwei Dimensionen, zwischen zwei beliebigen Punkten kann eine gerade Linie gezogen werden, die vollständig mit ihr verschmilzt... - Sagittale Okklusion in medizinischer Hinsicht:
(o. sagittalis) siehe vordere Okklusion ... - SAGITTALE OKKLUSALKURVE in medizinischer Hinsicht:
siehe Okklusionskurve anterior... - Sagitale Schädelhernie in medizinischer Hinsicht:
(h. cerebralis sagittalis) G. h.-m., entstehend durch einen Schädeldefekt im Bereich der sagittalen und (oder) frontalen ... - VORNE VERSCHLUSS in medizinischer Hinsicht:
(o. anterior; syn. o. sagittal) O. wenn sich der Unterkiefer nach vorne bewegt; gekennzeichnet durch das Schließen der Schneidezähne, in manchen Fällen auch der letzten... - Vordere okklusale Kurve in medizinischer Hinsicht:
(syn. o.c. sagittal) O.c., das auf einer Seite durch die Kauflächen der Zähne verläuft (vom Eckzahn bis zum letzten ... - SONNENKALBA-PROJEKTION in medizinischer Hinsicht:
(v. Sonnenkalb, dt. Radiologe) Röntgenbild der Spitze des Warzenfortsatzes, zu dessen Aufnahme der Kopf des Patienten auf eine Kassette gelegt wird, so dass die sagittale ... - WEINSTEIN-METHODE in medizinischer Hinsicht:
(E. S. Vainstein, geb. 1919, sowjetischer Augenarzt) Methode der Radiographie der Sehkanäle in posterioren Schrägprojektionen, bei der der Patient ...
Um die Beschreibung seiner Struktur und Krankheiten zu erleichtern, werden imaginäre Achsen und Ebenen des menschlichen Körpers benötigt. Ihre Erwähnungen finden sich häufig in der Fachliteratur zur Anatomie. Lassen Sie uns kurz auf die Eigenschaften all dieser Ebenen eingehen und näher auf die sagittale Ebene eingehen.
Achsen des menschlichen Körpers
Es gibt drei Achsen des menschlichen Körpers, sie schneiden sich in einem Winkel von 90 Grad:
- Die vertikale Achse ist die längste, sie steht direkt senkrecht zur Stütze, auf der die Person steht.
- Die Querachse verläuft parallel zum Träger.
- Die Sagittalachse teilt den Körper von vorne nach hinten.
Herkömmlich ist es möglich, beliebig viele Quer- und Sagittalachsen durch den menschlichen Körper zu zeichnen. Da es nur eine vertikale Achse gibt, wird sie auch als Hauptachse bezeichnet.
Die Achsen entsprechen den Körperebenen – sagittal, frontal und horizontal.
Ebenen des menschlichen Körpers
Lassen Sie uns alle Flugzeuge kurz beschreiben:
- Die Sagittalebene fällt mit der gleichnamigen Achse zusammen. Die Querrichtung steht senkrecht dazu.
- Die Frontalebene fällt mit der vertikalen Achse zusammen und teilt den Körper in zwei Hälften: die vordere und die hintere. Verläuft im rechten Winkel zur Stütze. Es erhielt seinen Namen, weil die vorderen Körperteile (Front), insbesondere die Stirn, parallel dazu verlaufen.
- Die horizontale Ebene verläuft entlang der Querachse. Konventionell wird der Körper in Ober- und Unterteile unterteilt.
Sagittalebene
Dieses Flugzeug wird wie die beiden anderen in der Anatomie von Mensch und Tier häufig verwendet. Die Sagittalebene des Körpers wird durch eine gedachte Linie in die rechte und linke Seite geteilt. Wie bereits erwähnt, können beliebig viele solcher Ebenen durch einen Körper gezogen werden.

Die Linie, die durch die Hauptachse verläuft, ist die mittlere Sagittalebene oder Medialebene. Es teilt den menschlichen Körper in zwei gleiche Hälften – links und rechts. Symmetrie wird nicht nur äußerlich beobachtet, sondern auch in Bezug auf innere Organe. Zum Beispiel linke und rechte Niere, linke und rechte Lunge. Ungepaarte Organe verletzen es. Das Herz liegt beispielsweise näher an der linken Seite des Brustbeins, Magen und Milz tendieren ebenfalls zu dieser Seite der Bauchregion.
Position von Organen relativ zu Ebenen
Abhängig von der Nähe ihrer Lage zu einer bestimmten Ebene werden Organe mit folgenden Begriffen beschrieben:
- kranial: diejenigen, die dem Schädel, dem Kopf am nächsten liegen;
- lateral: extern, lateral, von der medialen Ebene entfernt;
- kaudal: Organe, die näher an der unteren Körperhälfte liegen;
- medial: näher an der Hauptachse gelegen;
- ventral: Organe, die sich in der vorderen Bauchhälfte befinden;
- dorsal: befindet sich auf dem dorsalen, hinteren Teil des Körpers.
Wenn wir von Gliedmaßen sprechen, gelten folgende Formulierungen:
- distal: von jedem Körperteil entfernt;
- proximal: im Gegenteil, näher daran.
Haltung: Konzept, Norm
Ozhegov beschreibt die Haltung als eine Art, sich zu halten. Medizinische Wörterbücher charakterisieren dieses Konzept als eine gewohnheitsmäßige, entspannte, entspannte Haltung einer stehenden Person. Zwei wichtige Faktoren bestimmen die Körperhaltung: der Grad der Muskelentwicklung und die Position des Beckens.

Die sagittale Haltungsebene sollte symmetrisch sein. Eine korrekte, normale Haltung zeichnet sich aus durch:
- streng vertikale Kopfhaltung, leicht angehobenes Kinn;
- streng horizontaler Verlauf der Unterarmlinie: relativ zueinander symmetrische Winkel, die die Seitenflächen des Halses und die Umrisse der Schultergürtel bilden;
- ein zur Mittelebene symmetrischer Brustkorb, der weder hervorsteht noch einsinkt;
- vertikaler Bauchbereich: Der Nabel liegt streng auf der Linie der Mittelebene;
- an den Körper gedrückte Schulterblätter, symmetrisch zur Wirbelsäule;
- Parallelität der durch die Kniekehle und die Gesäßfalten gezogenen Linien;
- von der Seite betrachtet: eingezogener Bauch, angehobener Brustkorb, gerade untere Gliedmaßen, der Neigungswinkel der Beckenregion beträgt nicht mehr als 30-35 Grad.
Haltungsfehler
Haltungsstörungen (Abweichungen vom Normalzustand) sind funktionelle Veränderungen im menschlichen Bewegungsapparat, die durch das Auftreten neuer bedingter Reflexverbindungen gekennzeichnet sind, die eine abnormale Körperhaltung verstärken.
Häufige Ursachen für Haltungsfehler:
- Angewohnheit, in falschen Positionen zu sitzen;
- geschwächter Körper: durch Rachitis, Asthma bronchiale, Infektionen im Kindesalter;
- unzureichende körperliche Entwicklung.

Eine Fehlhaltung ist in zwei Ebenen sichtbar: frontal und sagittal. Der erste Typ ist mit einer mangelnden Symmetrie zwischen Körperteilen verbunden – der sogenannten asymmetrischen Haltung. Die zweite – mit einer Abweichung von der normalen Krümmung der Wirbelsäule. Insbesondere:
- Verstärkte Krümmung der Wirbelsäule: gebeugter, runder oder rundgewölbter Rücken.
- Reduzierte Krümmung: flacher und flach-konkaver Rücken.
Schauen wir uns diese Änderungen genauer an.
Schlechte Haltung in der Sagittalebene
Merkmale jedes Mangels:
- Faulheit. Die Vorwärtskrümmung der Wirbelsäule wird verstärkt und gleichzeitig die Rückwärtskrümmung verringert. Beim Gehen sind die Beine leicht gebeugt, der Beckenwinkel nimmt ab. Charakteristisch sind ein hervorstehender Bauch, flügelförmige Schulterblätter und erhöhte Schultergürtel.
- Runder Rücken. Bei dieser Form ist die stärkere Krümmung der Wirbelsäule mit bloßem Auge sichtbar. Neben flügelförmigen Schulterblättern und einem hervorstehenden Bauch gibt es auch einen nach vorne geneigten Kopf, eine eingefallene Brust und mit etwas Abstand vor dem Körper herabhängende Arme.
- Rundgewölbter Rücken. Alle physiologischen Krümmungen der Wirbelsäule nehmen zu. Die Beine sind beim Gehen leicht angewinkelt, der Bauch kann nicht nur hervorstehen, sondern auch hängen. Manchmal werden erhabene Unterarme und flügelförmige Schulterblätter beobachtet. Der Kopf ist leicht nach vorne gedrückt.
- Flache Rückseite. Reduzierung aller Krümmungen der Wirbelsäule, des normalen Beckenneigungswinkels. Der Brustkorb bewegt sich nach vorne, der Unterbauch ragt leicht hervor. Häufig wird eine flügelartige Form der Schulterblätter beobachtet.
- Flach-konkaver Rücken. Verringern der Vorwärtskrümmung der Wirbelsäule unter Beibehaltung der Norm oder Erhöhen der Rückwärtskrümmung. Die Linie der Halswirbel ist oft abgeflacht und die Form der Schulterblätter kann flügelförmig sein. Das Becken bewegt sich nach hinten, die Beine sind beim Gehen leicht gebeugt und die Knie sind in eine unnatürliche Richtung überstreckt.

Vertikale, horizontale, sagittale Ebene – diese Konzepte werden in der Anatomie häufig verwendet. Sie sind auch für die Charakterisierung der Erscheinungsformen einer Reihe von Krankheiten, Entwicklungsstörungen, insbesondere Haltungsstörungen, unverzichtbar.
Bei der Beschreibung des Aufbaus des menschlichen Körpers, bei der Lagebestimmung seiner einzelnen Teile, bei der Bestimmung der Projektionen von Knochen, Muskeln, inneren Organen, Gefäßen und Nerven in der Anatomie werden die allgemein anerkannten Bezeichnungen zueinander senkrechter Ebenen verwendet:
1) sagittal;
2) frontal;
3) horizontal.
Es muss daran erinnert werden, dass wir, wenn sich diese Ebenen auf den menschlichen Körper beziehen, seine vertikale Position meinen (Abb. 1).
Abb.1. Ebenen des menschlichen Körpers
Um die Position einzelner Punkte oder Linien in diesen Ebenen anzugeben, werden Begriffe verwendet – Antonyme; erinnern Sie sich an diese vier Paare:
1) medial - lateral;
2) ventral – dorsal;
3) kranial – kaudal;
4) proximal – distal .
Unter Sagittalebene bezieht sich auf eine vertikale Ebene, die den menschlichen Körper von vorne nach hinten und entlang des Körpers in die rechte und linke Körperhälfte schneidet (wie ein Pfeil – sagitta). Die Sagittalebene wird aufgerufen die mittlere Mittelebene.
Eine Ebene, die ebenfalls vertikal, aber im rechten Winkel zur Sagittalebene verläuft, heißt frontal, parallel zur Stirn (Stirn – Frontus). Es unterteilt den Körper in einen vorderen und einen hinteren Abschnitt.
Horizontale Ebene horizontal ausgeführt, d.h. im rechten Winkel sowohl zur Sagittal- als auch zur Frontalrichtung. Es unterteilt den Körper in einen oberen und einen unteren Abschnitt.
Was näher an der Mittelebene liegt, wird als bezeichnet medial(von lat. mediale – Mitte), davon entfernt – seitlich(von lateinisch lateris – Seite). Beispielsweise wird als bezeichnet, was sich näher an der Vorderfläche des Körpers befindet ventral(vom lateinischen venter – Bauch) und näher an der Rückenfläche – dorsal(von lateinisch dorsum – zurück). Beispielsweise befindet sich im Brustkorb das Herz ventral der Speiseröhre und im Becken liegt das Rektum dorsal der Blase.
Das, was näher am oberen Ende des Körpers liegt, ist kranial(von lateinisch cranium – Schädel), nach unten – kaudal(vom lateinischen caudo – Schwanz). Beispielsweise liegt die Schilddrüse im Nacken weiter kranial im menschlichen Körper als die Keimdrüsen in der Bauchhöhle.
Für Gliedmaßen werden zwei Begriffe akzeptiert: Das Ende, das näher an der Stelle liegt, an der die Gliedmaße am Körper befestigt ist, wird als bezeichnet proximal, und der weiter unten - distal. Beispielsweise befindet sich die Hand distal des Ellenbogengelenks und das Knie proximal der Ferse.

Achsen und Ebenen des menschlichen Körpers A B C D- Sagittalebene (Medianebene); ERON- Frontalebene, senkrecht zur Sagittalebene; KLMN horizontale (Quer-)Ebene senkrecht zu den beiden vorherigen; ah ah- Sagittalachse; rein-in- Vorderachse; s-s- vertikale Achse
Flugzeuge und Äxte
Die menschliche Struktur ist bilateral symmetrisch. Um die Tiefe der Organe zu bestimmen, wird eine dreidimensionale Messung verwendet, die es ermöglicht, die Topographie der notwendigen Formationen visuell darzustellen. Zu diesem Zweck werden konventionell Flugzeuge gezeichnet: horizontal - entsprechend der Erdoberfläche; frontal – verläuft von rechts nach links und vertikal zur horizontalen Ebene; sagittal – verläuft von vorne nach hinten, vertikal zur horizontalen Ebene. Somit stehen alle drei Ebenen senkrecht zueinander. Die horizontale Ebene teilt den Körper in Ober- und Unterteil, die Frontalebene in Vorder- und Hinterteil, die Sagittalebene (Medianebene) in rechte und linke gleich große Teile. Verläuft die Sagittalebene nicht entlang der Mittellinie, sondern parallel dazu nach rechts oder links ausweichend, nennt man diese Ebene Parasagittal. Natürlich können in Bezug auf eine Person alle Ebenen auf jeder Ebene und Tiefe des Körpers gezeichnet werden. Wenn wir beispielsweise die Topographie der Bauchspeicheldrüse beschreiben, können wir sagen, dass sie sich in der horizontalen und frontalen Ebene auf der Höhe des ersten Lendenwirbels befindet. Um die Bewegungsrichtung in den Gelenken zu bestimmen, werden üblicherweise Achsen verwendet; die Vertikale verläuft in der Sagittalebene von oben nach unten, die Sagittalebene – in der Sagittal- und Parasagittalebene (von vorne nach hinten), die Frontalebene – von rechts nach links (quer). Bezogen auf den Bewegungsapparat im Schulter-Ellenbogen-Gelenk sind beispielsweise Bewegungen nur um die Frontalachse möglich, im Schultergelenk – um die Vertikal-, Frontal- und Sagittalachse (Abb. 29).
Biomechanik der Gelenke. Im Körper eines lebenden Menschen spielen Gelenke eine dreifache Rolle: 1) Sie helfen, die Körperhaltung aufrechtzuerhalten; 2) an der Bewegung von Körperteilen zueinander beteiligt sind und 3) Organe der Fortbewegung (Bewegung) des Körpers im Raum sind.
Da im Laufe der Evolution die Bedingungen für die Muskelaktivität unterschiedlich waren, entstanden Gelenke unterschiedlicher Form und Funktion. In ihrer Form können die Gelenkflächen als Segmente geometrischer Rotationskörper betrachtet werden: ein Zylinder, der sich um eine Achse dreht; eine Ellipse, die sich um zwei Achsen dreht, und eine Kugel – um drei oder mehr Achsen.
An den Gelenken finden Bewegungen um drei Hauptachsen statt.
Folgende Arten von Gelenkbewegungen werden unterschieden:
1. Bewegung um die frontale (horizontale) Achse – Biegen (Flexio), d. h. Verringerung des Winkels zwischen den Gelenkknochen, und Erweiterung (extensio), - d.h. eine Vergrößerung dieses Winkels.
2. Bewegungen um die sagittale (horizontale) Achse – Adduktion, d. h. Annäherung an die Mittelebene, und Entführung, d.h. sich davon entfernen.
3. Bewegungen um eine vertikale Achse, d.h. Drehung: nach innen ( Pronatio) und nach außen ( supinatio).
4. Kreisbewegung (Circumductio), bei dem ein Übergang von einer Achse zur anderen erfolgt, wobei ein Ende des Knochens einen Kreis beschreibt und der gesamte Knochen eine Kegelfigur beschreibt.
Auch Gleitbewegungen der Gelenkflächen sind möglich, ebenso wie deren Auseinanderbewegen, wie es beispielsweise beim Strecken der Finger zu beobachten ist.
Die Art der Bewegung in den Gelenken wird durch die Form der Gelenkflächen bestimmt. Das Ausmaß der Bewegung in den Gelenken hängt von der unterschiedlichen Größe der Gelenkflächen ab. Wenn beispielsweise die Glenoidgrube einen Bogen von 140 Grad Länge und der Kopf 210 Grad hat, beträgt der Bewegungsbogen 70 Grad. Je größer der Unterschied in den Flächen der Gelenkflächen ist, desto größer ist der Bewegungsbogen (Volumen) und umgekehrt. Bewegungen in den Gelenken können neben der Verringerung des Flächenunterschieds der Gelenkflächen auch durch verschiedene Arten von Bremsen eingeschränkt werden, deren Rolle einige Bänder, Muskeln, Knochenvorsprünge usw. spielen. Da erhöhte körperliche ( Kraft) Belastung führt zu einer Arbeitshytrophie von Knochen, Bändern und Muskeln, führt zum Wachstum dieser Formationen und zu einer Einschränkung der Beweglichkeit, dann haben verschiedene Sportler je nach Sportart unterschiedliche Flexibilität in den Gelenken. Beispielsweise hat das Schultergelenk bei Leichtathleten einen größeren Bewegungsbereich und bei Gewichthebern einen kleineren Bewegungsbereich. Wenn die Bremsvorrichtungen in den Gelenken besonders stark ausgeprägt sind, sind die Bewegungen in ihnen stark eingeschränkt. Solche Gelenke werden genannt eng.
Das Ausmaß der Bewegung wird auch durch den intraartikulären Knorpel beeinflusst, was die Bewegungsvielfalt erhöht. So sind im Kiefergelenk, das hinsichtlich der Form der Gelenkflächen zu den biaxialen Gelenken gehört, aufgrund des Vorhandenseins einer intraartikulären Bandscheibe drei Arten von Bewegungen möglich.
Muster der Bandanordnung. Der verstärkende Teil des Gelenks ist Bänder, Ligamenta, die die Arbeit der Gelenke steuern und aufrechterhalten; Von hier aus werden sie unterteilt in Führer Und halten. Die Anzahl der Bänder im menschlichen Körper ist groß. Um sie besser studieren und im Gedächtnis behalten zu können, ist es daher notwendig, die allgemeinen Gesetze ihrer Lage zu kennen.
1. Bänder lenken die Bewegung der Gelenkflächen um eine bestimmte Drehachse eines bestimmten Gelenks und sind daher in jedem Gelenk abhängig von der Anzahl und Position seiner Achsen verteilt.
2. Die Bänder befinden sich: a) zentral zur gegebenen Rotationsachse und b) hauptsächlich an ihren Enden.
3. Sie liegen in der Ebene einer bestimmten Gelenkbewegung.
So befinden sich im Interphalangealgelenk mit einer frontalen Rotationsachse die Führungsbänder seitlich (ligg. collateralia) und vertikal. Im biaxialen Ellenbogengelenk ligg. Kollateralien verlaufen ebenfalls vertikal, ᴨрᴨȇndikular zur Frontalachse, entlang ihrer Enden, ein Lig. anulare liegt horizontal, senkrecht zur vertikalen Achse. Schließlich verlaufen bei einem mehrachsigen Hüftgelenk die Bänder in unterschiedliche Richtungen.
Arten von Gelenkbewegungen
Es gibt Bewegungen in den Gelenken in Bezug auf drei zueinander ausgerichtete Achsen: um die frontale (horizontale) Achse - Biegen(Flexio) und Verlängerung(Erweiterung); um die Sagittalachse - Gießen(adductio) und führen(Entführung); um die vertikale Achse - Rotationsbewegung(Rotation). Die Rotationsbewegung der Gliedmaßen wird ausgeführt als nach innen(Pronatio) und nach außen(Supinatio). Bei Kugelgelenken sind zusätzlich zu den angegebenen Bewegungen auch solche möglich Kreisverkehr(Circumductio), bei der die Spitze des Rotationszentrums dem Kugelgelenk entspricht und die Radipherie die Basis des Kegels beschreibt.
Gemeinsam stellt eine diskontinuierliche, hohle, bewegliche Verbindung oder Artikulation dar, articulatio synovialis(Griechisch arthron – Gelenk, daher Arthritis – Gelenkentzündung). In jedem Gelenk gibt es Gelenkflächen der Gelenkknochen, eine Gelenkkapsel, die die Gelenkenden der Knochen in Form einer Kupplung umgibt, und eine Gelenkhöhle, die sich innerhalb der Kapsel zwischen den Knochen befindet.
1. Gelenkflächen, facies articulares, mit Gelenkknorpel bedeckt, cartilago articularis, hyalin, seltener faserig, 0,2 - 0,5 mm dick. Durch die ständige Reibung wird der Gelenkknorpel glatt, was das Gleiten der Gelenkflächen erleichtert. Durch die Elastizität des Knorpels dämpft er Stöße und dient als Puffer. Die Gelenkflächen sind in der Regel mehr oder weniger konsistent (kongruent). Wenn also die Gelenkfläche eines Knochens konvex ist (der sogenannte Gelenkkopf), dann ist die Oberfläche des anderen Knochens entsprechend konkav (die Gelenkpfanne).
2. Gelenkkapsel, Kapsel articularis, die die Gelenkhöhle hermetisch umschließt, wächst an den Gelenkknochen entlang der Kante ihrer Gelenkflächen oder zieht sich leicht von ihnen zurück. Es besteht aus einer äußeren Fasermembran, Membranfibrose und innere Synovialis, Membran Synovialis. Die Synovialmembran ist auf der der Gelenkhöhle zugewandten Seite mit einer Schicht aus Endothelzellen bedeckt, wodurch sie ein glattes und glänzendes Aussehen erhält. Es sondert klebrige, transparente Synovialflüssigkeit in die Gelenkhöhle ab – Synovia, Synovia, dessen Vorhandensein die Reibung der Gelenkflächen verringert. Die Synovialmembran endet an den Rändern der Gelenkknorpel. Es bilden sich oft kleine Fortsätze, sogenannte Synovialzotten. Zotten synoviales. Darüber hinaus bildet es an manchen Stellen Synovialfalten, manchmal größer oder kleiner, Plicae synoviales in die Gelenkhöhle wandern. Manchmal enthalten Synovialfalten eine erhebliche Menge an Fett, die von außen in sie hineinwächst, dann entstehen sogenannte Fettfalten, Plicae adiposae Ein Beispiel hierfür sind die Plicae alares des Kniegelenks.
Manchmal bilden sich an dünnen Stellen der Kapsel sackartige Vorsprünge oder Inversionen der Synovialmembran – Synovialschleimbeutel, Schleimbeutel synoviales, befindet sich um die Sehnen oder unter den gelenknahen Muskeln. Da diese Schleimbeutel aus Synovia bestehen, reduzieren sie die Reibung von Sehnen und Muskeln bei Bewegungen.
3. Gelenkhöhle, cavitas articularis stellt einen hermetisch geschlossenen schlitzartigen Raum dar, der durch Gelenkflächen und Synovialmembran begrenzt wird. Normalerweise handelt es sich nicht um einen freien Hohlraum, sondern er ist mit Gelenkflüssigkeit gefüllt, die die Gelenkflächen befeuchtet und schmiert und so die Reibung zwischen ihnen verringert. Darüber hinaus spielt die Synovia eine Rolle beim Flüssigkeitsaustausch und bei der Stärkung des Gelenks durch die Adhäsion von Oberflächen. Es dient auch als Puffer und mildert die Kompression und den Stoß der Gelenkflächen, da die Bewegung in den Gelenken nicht nur ein Gleiten, sondern auch eine Divergenz der Gelenkflächen ist. Zwischen den Gelenkflächen herrscht ein Unterdruck (weniger als der Atmosphärendruck). Dabei wird ihre Divergenz durch den Atmosphärendruck verhindert. (Dies erklärt die Empfindlichkeit der Gelenke gegenüber Schwankungen des Luftdrucks bei bestimmten Krankheiten, weshalb solche Patienten eine Verschlechterung des Wetters vorhersagen können.)
Bei einer Schädigung der Gelenkkapsel dringt Luft in die Gelenkhöhle ein, wodurch sich die Gelenkflächen sofort trennen. Unter normalen Bedingungen wird die Divergenz der Gelenkflächen neben dem Unterdruck in der Höhle auch durch Bänder (intra- und extraartikulär) und Muskeln mit in der Dicke ihrer Sehnen eingebetteten Sesambeinen verhindert. Bänder und Sehnen der Muskeln bilden den Hilfsapparat zur Stärkung des Gelenks.
In einer Reihe von Gelenken gibt es Zubehör, ergänzend zu den Gelenkflächen - intraartikulärer Knorpel; Sie bestehen aus faserigem Knorpelgewebe und sehen aus wie feste Knorpelplatten – Festplatten, Disci-Artikel, oder nicht kontinuierliche, sichelförmige Formationen und daher genannt in Tüten, menisci articulares(Meniskus, lat. - Halbmond) oder in Form von Knorpelrändern, Labra articularia (Gelenklippen).
Alle diese intraartikulären Knorpel entlang ihres Umfangs verwachsen mit der Gelenkkapsel. Sie entstehen durch neue Funktionsanforderungen als Reaktion auf die Komplikation und Zunahme statischer und dynamischer Belastungen. Sie entwickeln sich aus dem Knorpel der primären durchgehenden Gelenke und vereinen Festigkeit und Elastizität, widerstehen Stößen und fördern die Bewegung in den Gelenken.
Es gibt Gelenke
einfach, bestehend aus nur zwei Knochen (zum Beispiel dem Schultergelenk),
komplex – wenn das Gelenk eine größere Anzahl von Knochen umfasst (z. B. das Ellenbogengelenk) und
kombiniert, Ermöglicht Bewegungen nur gleichzeitig mit Bewegungen in anderen anatomisch getrennten Gelenken (z. B. dem proximalen und distalen Radioulnargelenk).
Zur Zusammensetzung des Gelenks gehören: Gelenkflächen, die Gelenkkapsel bzw. Gelenkkapsel und die Gelenkhöhle.
Gelenkflächen Verbindungsknochen entsprechen mehr oder weniger einander (kongruent). An einem Knochen, der ein Gelenk bildet, ist die Gelenkfläche normalerweise konvex und wird als bezeichnet Köpfe. Am anderen Knochen entsteht eine dem Kopf entsprechende Konkavität - Depression, oder Loch Sowohl der Kopf als auch die Schädelgrube können aus zwei oder mehr Knochen bestehen. Die Gelenkflächen sind mit hyalinem Knorpel bedeckt, der die Reibung verringert und die Bewegung im Gelenk erleichtert.
Schleimbeutel wächst bis an die Ränder der Gelenkflächen der Knochen und bildet eine verschlossene Gelenkhöhle. Die Gelenkkapsel besteht aus zwei Schichten. Die oberflächliche, faserige Schicht wird durch faseriges Bindegewebe gebildet, geht in die Knochenhaut der Gelenkknochen über und hat eine Schutzfunktion. Die innere oder Synovialschicht ist reich an Blutgefäßen. Es bildet Auswüchse (Zotten), die eine zähe Flüssigkeit absondern – Synovia, Dadurch werden die Gelenkflächen geschmiert und ihr Gleiten erleichtert. In normal funktionierenden Gelenken gibt es nur sehr wenig Synovia, beispielsweise im größten Gelenk – dem Knie – nicht mehr als 3,5 cm 3. In manchen Gelenken (Knie) bildet die Synovialmembran Falten, in denen sich Fett ablagert, das hier eine Schutzfunktion hat. In anderen Gelenken, beispielsweise in der Schulter, bildet die Synovialmembran äußere Vorsprünge, über denen sich fast keine Faserschicht befindet. Diese Vorsprünge in der Form Schleimbeutel befinden sich im Bereich des Sehnenansatzes und reduzieren die Reibung bei Bewegungen.
Gelenkhöhle bezeichnet einen hermetisch geschlossenen schlitzartigen Raum, der durch die Gelenkflächen der Knochen und der Gelenkkapsel begrenzt wird. Es ist mit Synovium gefüllt. In der Gelenkhöhle zwischen den Gelenkflächen herrscht Unterdruck (unterhalb des Atmosphärendrucks). Der atmosphärische Druck, dem die Kapsel ausgesetzt ist, trägt zur Stärkung des Gelenks bei. Daher nimmt bei manchen Krankheiten die Empfindlichkeit der Gelenke gegenüber Schwankungen des Luftdrucks zu, und solche Patienten können Wetteränderungen „vorhersagen“. Das enge Aneinanderpressen der Gelenkflächen in einer Reihe von Gelenken ist auf den Tonus bzw. die aktive Muskelspannung zurückzuführen.
Zusätzlich zu den obligatorischen können im Gelenk Hilfsformationen vorkommen. Dazu gehören Gelenkbänder und Lippen, intraartikuläre Bandscheiben, Menisken und Sesamoide (aus dem Arabischen, Sesamo– Getreide) Knochen.
Gelenkbänder Es handelt sich um Bündel aus dichtem Fasergewebe. Sie befinden sich in der Dicke oder auf der Oberseite der Gelenkkapsel. Dabei handelt es sich um lokale Verdickungen seiner Faserschicht. Durch die Ausbreitung über das Gelenk und die Befestigung an den Knochen stärken die Bänder das Gelenk. Ihre Hauptaufgabe besteht jedoch darin, den Bewegungsspielraum einzuschränken: Sie lassen ihn nicht über bestimmte Grenzen hinausgehen. Die meisten Bänder sind nicht elastisch, aber sehr stark. Einige Gelenke, wie zum Beispiel das Knie, verfügen über intraartikuläre Bänder.
Gelenklippen bestehen aus faserigem Knorpel, der ringförmig die Ränder der Gelenkhöhlen bedeckt und deren Fläche ergänzt und vergrößert. Das Labrum verleiht dem Gelenk mehr Kraft, schränkt jedoch den Bewegungsumfang ein (zum Beispiel beim Schultergelenk).
Bandscheiben und Menisken Es handelt sich um knorpelige Polster – massiv und mit einem Loch. Sie befinden sich im Gelenk zwischen den Gelenkflächen und verwachsen an den Rändern mit der Gelenkkapsel. Die Oberflächen der Bandscheiben und Menisken wiederholen die Form der Gelenkflächen der auf beiden Seiten angrenzenden Knochen. Bandscheiben und Menisken fördern vielfältige Bewegungen im Gelenk. Sie kommen in den Knie- und Unterkiefergelenken vor.
Sesamoidknochen klein und in der Nähe einiger Gelenke gelegen. Einige dieser Knochen liegen tief in der Gelenkkapsel und artikulieren, indem sie die Fläche der Gelenkgrube vergrößern, mit dem Gelenkkopf (zum Beispiel im Gelenk des großen Zehs); andere werden in die Sehnen der Muskeln eingeführt, die das Gelenk überspannen (z. B. die Patella, die von der Quadrizepssehne umhüllt ist). Sesambeine sind auch Hilfsmuskelformationen.
Bei Sportlern nimmt die Beweglichkeit der Gelenke unter dem Einfluss des Trainings zu. Bei Kindern sind die meisten Gelenke tendenziell beweglicher als bei Erwachsenen oder älteren Menschen

Reis. 1.6. Form der Gelenke: A – zylindrisch (proximal radioulnar); B – blockförmig (interflank); B – Sattel (Karpometakarpal des Zeigefingers); G – Ellipsoid (Handgelenk); D – sphärisch (Schulter); Es – (zwischen den Gelenkfortsätzen der Wirbel)
Klassifizierung von Gelenken kann nach folgenden Grundsätzen durchgeführt werden:
1) durch die Anzahl der Gelenkflächen, 2) durch die Form der Gelenkflächen und 3) durch die Funktion.
Anhand der Anzahl der Gelenkflächen werden unterschieden:
1. Einfaches Gelenk (Art. Simplex) mit nur 2 Gelenkflächen, zum Beispiel Interphalangealgelenken.
2. Komplexes Gelenk (Art. Komposit) mit mehr als zwei Gelenkflächen, zum Beispiel dem Ellenbogengelenk. Ein komplexes Gelenk besteht aus mehreren einfachen Gelenken, in denen Bewegungen getrennt ausgeführt werden können. Das Vorhandensein mehrerer Gelenke in einem komplexen Gelenk bestimmt die Gemeinsamkeit ihrer Bänder.
3. Komplexes Gelenk (Art. Komplex), enthält intraartikulären Knorpel, der das Gelenk in zwei Kammern unterteilt (Zweikammergelenk). Die Aufteilung in Kammern erfolgt entweder vollständig, wenn der intraartikuläre Knorpel die Form einer Scheibe hat (z. B. im Kiefergelenk), oder unvollständig, wenn der Knorpel die Form eines Mondsacks annimmt (z. B. im Kniegelenk).
4. Kombiniertes Gelenk ist eine Kombination mehrerer isolierter Gelenke, die getrennt voneinander angeordnet sind, aber zusammenarbeiten. Dies sind beispielsweise sowohl Kiefergelenke als auch proximale und distale Radioulnargelenke usw. Da ein kombiniertes Gelenk eine funktionelle Kombination von zwei oder mehr anatomisch getrennten Gelenken darstellt, unterscheidet es sich von komplexen und komplexen Gelenken, die jeweils anatomisch einheitlich sind. aus funktionell unterschiedlichen Verbindungen zusammengesetzt.
Nach Form und Funktion erfolgt die Einteilung wie folgt.
Die Funktion eines Gelenks wird durch die Anzahl der Achsen bestimmt, um die Bewegungen ausgeführt werden. Die Anzahl der Achsen, um die Bewegungen in einem bestimmten Gelenk stattfinden, hängt von der Form seiner Gelenkflächen ab. Beispielsweise erlaubt die zylindrische Form eines Gelenks eine Bewegung nur um eine Drehachse. In diesem Fall stimmt die Richtung dieser Achse mit der Positionsachse des Zylinders selbst überein: Wenn der zylindrische Kopf vertikal ist, erfolgt die Bewegung um die vertikale Achse (zylindrisches Gelenk); Liegt der zylindrische Kopf horizontal, erfolgt die Bewegung um eine der horizontalen Achsen, die mit der Kopfachse zusammenfallen, beispielsweise die Frontalachse (Trochleagelenk).
Die Kugelform des Kopfes hingegen ermöglicht eine Drehung um mehrere Achsen, die mit den Radien der Kugel übereinstimmen (Kugelgelenk).
Folglich besteht eine vollständige Übereinstimmung zwischen der Anzahl der Achsen und der Form der Gelenkflächen: Die Form der Gelenkflächen bestimmt die Art der Bewegungen des Gelenks und umgekehrt bestimmt die Art der Bewegungen eines bestimmten Gelenks seine Form (P. F. Lesgaft).
Hier sehen wir die Manifestation des dialektischen Prinzips der Einheit von Form und Funktion.
Basierend auf diesem Prinzip können wir die folgende einheitliche anatomische und physiologische Klassifizierung von Gelenken skizzieren.
Einachsige Gelenke.
1. Zylindrisches Gelenk, Art.-Nr. Trochoidea. Eine zylindrische Gelenkfläche, deren Achse vertikal, parallel zur Längsachse der Gelenkknochen oder zur vertikalen Achse des Körpers liegt, sorgt für Bewegung um eine vertikale Achse – Rotation, Rotatio; ein solches Gelenk wird auch Rotationsgelenk genannt.
2. Trochleagelenk, Ginglymus(Beispiel: Interphalangealgelenke der Finger). Seine Trochlea-Gelenkfläche ist ein quer liegender Zylinder, dessen Längsachse quer, in der Frontalebene, senkrecht zur Längsachse der Gelenkknochen liegt; Dabei werden Bewegungen im Trochleagelenk um diese Frontalachse ausgeführt (Flexion und Extension). Die auf den Gelenkflächen vorhandenen Führungsrillen und -rippen verhindern die Möglichkeit eines seitlichen Verrutschens und fördern die Bewegung um eine einzige Achse.
Liegt die Führungsnut des Blocks nicht senkrecht zur Achse des Blocks, sondern in einem bestimmten Winkel dazu, so entsteht beim Ausfahren eine Schraubenlinie. Bei einem solchen Trochleagelenk handelt es sich um ein schraubenförmiges Gelenk (zum Beispiel das Schulter-Ellenbogengelenk). Die Bewegung im Schraubengelenk ist die gleiche wie im reinen Trochleagelenk.
Nach den Gesetzen der Lage des Bandapparates befinden sich die Führungsbänder in einem zylindrischen Gelenk δψψξndikular zur vertikalen Rotationsachse, in einem Trochleagelenk – δΨενωνndikulär zur Frontalachse und an den Seiten davon. Diese Anordnung der Bänder hält die Knochen in ihrer Position, ohne die Bewegung zu behindern.
ZweiachsigGelenke
1. Ellipsoidgelenk, articuldtio ellipsoidea(Beispiel: Handgelenk). Die Gelenkflächen stellen Segmente einer Ellipse dar: Eine davon ist konvex, oval mit ungleicher Krümmung in zwei Richtungen, die andere ist entsprechend konkav. Sie sorgen für Bewegungen um zwei horizontale Achsen, die orthogonal zueinander sind: um die Frontalachsen – Flexion und Extension, und um die Sagittalachse – Abduktion und Adduktion. Die Bänder in den Ellipsoidgelenken liegen an ihren Enden senkrecht zu den Rotationsachsen.
2. Kondylengelenk, Articulatio condyldris(Beispiel: Kniegelenk).
Das Kondylengelenk hat einen konvexen Gelenkkopf in Form eines hervorstehenden runden Fortsatzes, der in seiner Form einer Ellipse ähnelt und Kondylus genannt wird, woher auch der Name des Gelenks stammt. Der Kondylus entspricht einer Vertiefung auf der Gelenkfläche eines anderen Knochens, obwohl der Größenunterschied zwischen ihnen erheblich sein kann.
Das Kondylengelenk kann als eine Art Ellipsoidgelenk betrachtet werden, das eine Übergangsform vom Trochleagelenk zum Ellipsoidgelenk darstellt. In dieser Hinsicht wird seine Hauptdrehachse frontal sein.
Das Kondylengelenk unterscheidet sich vom Trochleagelenk dadurch, dass zwischen den Gelenkflächen ein großer Unterschied in Größe und Form besteht. Dadurch sind im Kondylengelenk im Gegensatz zum Trochleagelenk Bewegungen um zwei Achsen möglich.
Es unterscheidet sich vom Ellipsoidgelenk durch die Anzahl der Gelenkköpfe. Kondylengelenke haben immer zwei mehr oder weniger sagittal angeordnete Kondylen, die sich entweder in derselben Kapsel befinden (z. B. die beiden am Kniegelenk beteiligten Femurkondylen) oder in unterschiedlichen Gelenkkapseln liegen, wie im Atlanto-Occipital gemeinsam.
Da die Köpfe im Kondylengelenk keine regelmäßige elliptische Konfiguration haben, wird die zweite Achse nicht unbedingt horizontal sein, wie es bei einem typischen Ellipsoidgelenk der Fall ist; es kann auch vertikal sein (Kniegelenk).
Befinden sich die Kondylen in unterschiedlichen Gelenkkapseln, so ist ein solches Kondylengelenk in seiner Funktion dem Ellipsoidgelenk (Atlantookzipitalgelenk) nahe. Wenn die Kondylen nahe beieinander liegen und sich in derselben Kapsel befinden, wie zum Beispiel im Kniegelenk, dann ähnelt der Gelenkkopf als Ganzes einem liegenden Zylinder (Block), der in der Mitte (dem Raum zwischen den Kondylen) präpariert wird. . In diesem Fall wird das Kondylengelenk in seiner Funktion näher am Trochleagelenk liegen.
3. Sattelgelenk, Art.-Nr. Sellaris(Beispiel: Karpometakarpalgelenk des Zeigefingers).
Dieses Gelenk besteht aus zwei sattelförmigen Gelenkflächen, die „rittlings“ aufeinandersitzen und von denen sich die eine entlang und quer über die andere bewegt. Dadurch werden darin Bewegungen um zwei gegenseitig interendikuläre Achsen ausgeführt: frontal (Flexion und Extension) und sagittal (Abduktion und Adduktion).
Bei zweiachsigen Gelenken ist es auch möglich, Bewegungen von einer Achse auf eine andere zu übertragen, also eine Kreisbewegung (Circumductio).
MehrachsigGelenke
1. Kugelgelenk, Art.-Nr. Sphäroidea(Beispiel: Schultergelenk). Eine der Gelenkflächen bildet einen konvexen, kugelförmigen Kopf, die andere eine entsprechend konkave Gelenkhöhle. Theoretisch kann die Bewegung um viele Achsen erfolgen, die den Radien des Balls entsprechen. In der Praxis werden jedoch normalerweise drei Hauptachsen unterschieden, die seitlich zueinander liegen und sich in der Mitte des Kopfes schneiden: 1) quer (frontal), um die sich gebogen wird tritt auf, Flexio, wenn der bewegliche Teil einen nach vorne offenen Winkel der Frontalebene bildet, und Extension, Extensio, wenn der Winkel nach hinten offen ist; 2) in der Mitte des hinteren Bereichs (sagittal), um den herum Abduktion, Abductio und Adduktion, Adductio auftreten; 3) vertikal, um die herum die Drehung erfolgt, Rotatio, nach innen, Pronatio, und nach außen, Supinatio. Bei der Bewegung von einer Achse zur anderen entsteht eine Kreisbewegung, Circumductio. Das Kugelgelenk ist das lockerste aller Gelenke. Da das Ausmaß der Bewegung von der unterschiedlichen Fläche der Gelenkflächen abhängt, ist die Gelenkgrube in einem solchen Gelenk im Vergleich zur Größe des Kopfes klein. Typische Kugelgelenke verfügen über wenige Hilfsbänder, was ihre Bewegungsfreiheit bestimmt.
Eine Art Kugelgelenk – Topfgelenk, Art.-Nr. Cotylica(Cotyle, griechisch - Schüssel). Seine Gelenkhöhle ist tief und bedeckt den größten Teil des Kopfes. Dadurch ist die Bewegung in einem solchen Gelenk weniger frei als in einem typischen Kugelgelenk; Wir haben ein Beispiel für ein schalenförmiges Gelenk im Hüftgelenk, bei dem eine solche Vorrichtung zu einer größeren Stabilität des Gelenks beiträgt.
2. Flachfugen, Art.plana(Beispiel - artt. intervertebrales), haben fast flache Gelenkflächen. Sie können als Oberflächen einer Kugel mit einem sehr großen Radius betrachtet werden; daher werden Bewegungen in ihnen um alle drei Achsen ausgeführt, der Bewegungsbereich ist jedoch aufgrund der geringfügigen Unterschiede in den Flächen der Gelenkflächen gering.
Bänder in mehrachsigen Gelenken befinden sich auf allen Seiten des Gelenks.
3. Steife Gelenke – Amphiarthrose. Unter diesem Namen versteht man eine Gruppe von Gelenken mit unterschiedlich geformten Gelenkflächen, die sich aber in anderen Merkmalen ähneln: Sie haben eine kurze, straff gedehnte Gelenkkapsel und einen sehr starken, nicht dehnbaren Hilfsapparat, insbesondere kurze Verstärkungsbänder (z. B , das Iliosakralgelenk).
Dadurch stehen die Gelenkflächen in engem Kontakt zueinander, was die Bewegung stark einschränkt. Solche inaktiven Gelenke werden als enge Gelenke bezeichnet – Amphiarthrose (BNA). Enge Gelenke mildern Stöße und Stöße zwischen den Knochen.
Zu diesen Verbindungen zählen auch Flachverbindungen, Art.-Nr. plana, bei der, wie erwähnt, die flachen Gelenkflächen flächengleich sind. In engen Gelenken sind die Bewegungen gleitend und äußerst unbedeutend.
VERBINDUNGEN DER SCHÄDELKNOCHEN
Administrator
Die Verbindungen der Schädelknochen sind überwiegend durchgehend, etwa Syndesmosen und Synchondrosen (Tabelle 1). Nur der Unterkiefer ist durch eine diskontinuierliche Artikulation – das Kiefergelenk – und das Zungenbein – durch Synsarkose – durch die suprahyoidalen Muskeln verbunden.
Syndesmosen- Dies sind faserige Verbindungen in Form verschiedener Nähte (Abb. 1). Normalerweise werden die Namen der Nähte aus den Namen der Verbindungsknochen gebildet, einige Nähte haben jedoch auch eigene Namen. Dadurch bilden sich die Verbindungen der Scheitelknochen untereinander Sagittalnaht (Sutura sagittalis), Stirn- und Scheitelknochen - Koronarnaht (Sutura coronalis), Hinterhaupts- und Scheitelknochen - Lambdoidea-Naht (Sutura lambdoidea). Zwischen der rechten und linken Hälfte der Squama des Stirnbeins findet man sie frontale (metopische) Naht (Sutura frontalis persistens (metopica). Diese Verbindungen sind gezackte Nähte (Suturae serratae), am charakteristischsten für den Gehirnschädel. Als Nähte werden die Nähte zwischen Scheitel- und Schläfenbein bezeichnet schuppig (Sutura squamosa). Die Knochen im Gesichtsschädel sind meist miteinander verbunden glatte Nähte (Suturae planae). Bei Neugeborenen werden die Syndesmosen des Hirnschädels auch durch Bindegewebsmembranen dargestellt, sie werden auch als Syndesmosen bezeichnet Fontanellen (Fonticuli cranii).
Tabelle 1. Kontinuierliche Verbindungen des Schädels
|
Schädelabschnitt |
Art der Verbindung |
Verbindungsmethode |
|
Schädeldach |
Syndesmosen |
Gezackte Nähte Koronar; Sagittal (sagittal); Lambdoid; Schuppig |
|
Gesichtsschädel |
Syndesmosen |
Flache (harmonische) Naht |
|
Verbindungen zwischen Zähnen und Kieferalveolen |
Syndesmosen |
Impaktion (Zahn-Alveolar-Übergang) |
|
Schädelbasis |
Synchondrosen (vorübergehend), ersetzt durch Synostosen Keilbein-Occipital; Synchondrose (permanent) Interokzipital; Keilethmoid; Keilsteinig; Petrookzipital |
Synchondrosen oder Knorpelgelenke kommen vor allem an der Schädelbasis in Form von Faserknorpel vor. Dies ist die Verbindung zwischen den Körpern des Hinterhaupts- und Keilbeinknochens - sphenooccipitale Synchondrose (Synchrondose sphenooccipitalis)(mit zunehmendem Alter wird Knorpelgewebe durch Knochengewebe ersetzt und es bildet sich eine Synostose); zwischen der Vorderkante des Felsenbeins und dem Keilbein - Keilsteinige Synchondrose (Synchrondose sphenopetrosa), sowie zwischen der Unterkante des Felsenbeins des Schläfenbeins und dem Hinterhauptbein - steinig-okzipitale Synchondrose (Synchrondose petrooccipitalis). Beide Verbindungen sind dauerhaft und bleiben ein Leben lang bestehen.


Reis. 1. Nähte und Synchondrose des Schädels:
a - rechte Ansicht: 1 - schuppige Naht; 2 - koronale Naht; 3 - sphenoparietale Naht; 4 - Keilbein-Frontal; 5 - frontozygomatische Naht; 6 - nasomaxilläre Naht; 7 - ethmoidolacrimale Naht; 8 - Jochbeinnaht; 9- Schläfenbeinnaht; 10 - Okzipital-Mastoid-Naht; 11- Parietal-Mastoid-Naht; 12 - Lambdoidnaht;
b – Ansicht von unten: 1 – mittlere Gaumennaht; 2 - keilsteinige Synchondrose; 3 - steinig-okzipitale Synchondrose; 4 - Lambdoidnaht; 5 - keilförmige Plattenepithelnaht; 6 - Jochbeinnaht; 7 - transversale Gaumennaht;
c – Rückansicht: 1 – Sagittalnaht; 2 - Okzipital-Mastoid-Naht; 3 - schuppige Naht; 4 - Lambdoidnaht
Neugeborenenschädel
Der Schädel eines Neugeborenen weist folgende charakteristische Merkmale auf: 1) Form und Größe des Schädels sowie das Verhältnis seiner Teile unterscheiden sich deutlich vom Schädel eines Erwachsenen (Abb. 73).
 73. Proportionale Beziehungen des Schädels eines Neugeborenen und eines Erwachsenen (nach Andronescu). A – Neugeborenes; B - Erwachsener.
73. Proportionale Beziehungen des Schädels eines Neugeborenen und eines Erwachsenen (nach Andronescu). A – Neugeborenes; B - Erwachsener.
2) die Anzahl der Knochen ist größer als die eines Erwachsenen; 3) Zwischen den Knochen des Daches und der Schädelbasis befinden sich bedeutende Schichten aus membranösem Bindegewebe und Knorpel. Der Schädel eines Neugeborenen ist sehr elastisch, da zahlreiche Knochenteile durch Bindegewebsschichten miteinander verbunden sind. Dieses Merkmal erleichtert zweifellos die Anpassung des fetalen Kopfes an den osteofaserigen Ring des kleinen Beckens der Frau während der Geburt, wenn die Ränder der Scheitelknochen einander entlang der Mittellinie überlappen, sowie die Schuppen der Stirn- und Hinterhauptknochen darauf die Scheitelknochen. Dadurch verringern sich die interparietalen und anteroposterioren Durchmesser und die Längsgröße des Kopfes nimmt zu. Der Schädel eines Neugeborenen hat eine dolichozephale Form. Der Kopfumfang beträgt 34 cm, das Volumen für Jungen beträgt 375–380 cm 3, für Mädchen 350–360 cm 3.
Abmessungen des Schädels eines Neugeborenen Abstand zwischen den Tuberkeln der Scheitelknochen......9,5 cm Abstand zwischen den äußeren Gehörgängen......8 cm Hinterhaupts-Frontalgröße...... .......... ......11,5 cm Hinterhaupts- und Mentalgröße.............13 cm
Aus diesen Abmessungen folgt, dass der Kopf während der Geburt nicht die okzipitomentale Größe durch den Geburtskanal überschreiten sollte, da es sonst zu Komplikationen kommen kann. Bei der Betrachtung des Schädels eines Neugeborenen von vorne (Abb. 73) ist eine deutliche Entwicklung des Gehirnteils des Schädels im Vergleich zum Gesichtsteil zu erkennen, der 65 % der Kopflänge ausmacht. Der Gesichtsschädel ist kurz und breit, mit gut entwickelten Augenhöhlen. Dies liegt daran, dass der Augapfel und die Hilfsapparate des Auges gut entwickelt und auf die Wahrnehmung von Lichtreizen vorbereitet sind. Der Oberkiefer, der das Rudiment des Air Sinus aufweist und dem der Alveolarfortsatz fehlt, ist klein. Dies wiederum beeinflusst die Größe der Nasenhöhle und des Nasopharynx, die sich in Form eines schmalen Schlitzes darstellen. Erst durch die Einbeziehung des Saug- und Atemvorgangs kommt es zu einer Steigerung der Muskelfunktion, die zusammen mit Nahrung und Luft eine prägende Wirkung auf die Schädelknochen hat. Die Schädelhöhlen unterscheiden sich deutlich von den Höhlen des erwachsenen Schädels. Das Knochengewebe des äußeren Gehörgangs fehlt und die Paukenhöhle mit den von Bindegewebe umschlossenen Gehörknöchelchen liegt unter der Haut. Die Umlaufbahn hat die Form einer dreieckigen Pyramide, der Eingang ist abgerundet, ihr Durchmesser beträgt 25–27 mm (bei einem Erwachsenen 35–40 mm). Die oberen und unteren Augenhöhlenspalten sind weit geöffnet. Zwischen den Knochen, die die Augenhöhle bilden, befinden sich auffällige Bindegewebsschichten. Aufgrund der schlechten Entwicklung der Orbitalplatte des Siebbeinknochens ist die mediale Wand nur schwach ausgeprägt. Die Nasenhöhle wird durch einen Spalt von 18 mm Höhe und 7 mm Breite auf Höhe des unteren Nasengangs dargestellt; auf der oberen Ebene - Breite 3 mm (für einen Erwachsenen 54, 15 bzw. 10 mm). Das Rudiment des Luftsinus des Oberkiefers kommuniziert mit dem mittleren Gehörgang. Andere Nebenhöhlen und Zellen des Siebbeinknochens fehlen. Die Fossa pterygopalatinum ist gut ausgeprägt und kommuniziert mit fünf breiten Kanälen. Die Schläfengrube wird auf der medialen Seite durch die Squama des Schläfenbeins und den großen Keilbeinflügel begrenzt. Die Tiefe der Fossa auf Höhe des Jochbeinfortsatzes beträgt 12 mm, bei einem Erwachsenen ist sie doppelt so groß, obwohl andere Abmessungen des Schädels eines Erwachsenen um ein Vielfaches größer sind als die Abmessungen des Schädels eines Neugeborenen. Dies weist indirekt darauf hin, dass sich in der Schläfengrube große und gut entwickelte Kaumuskeln befinden. Viele der Schädelknochen eines Neugeborenen, die bei einem Erwachsenen wie ein einziger Knochen erscheinen, bestehen aus einzelnen Teilen. Dieses Merkmal lässt sich nicht nur dadurch erklären, dass sich ein solcher Mosaikschädel leichter an die Form des Geburtskanals anpasst, sondern auch dadurch, dass er seine phylogenetische Entwicklung wiederholt. Alle Tiere, die niedriger als der Mensch sind, haben eine größere Anzahl Knochen im Schädel. Die Knochenverschmelzung im erwachsenen Schädel ist auf die Notwendigkeit zurückzuführen, die Gehirnhälften zu schützen. Zwischen einzelnen Knochen und deren Teilen liegen große Schichten häutigen Bindegewebes und Knorpels, sogenannte Fontanellen. Die Schichten zwischen den Knochen an der Schädelbasis sind mit Knorpel gefüllt.
Das Neugeborene hat sechs Fontanellen (Abb. 74). Außen sind sie mit Haut und der Aponeurose des Kopfes bedeckt, seitlich der Schädelhöhle schließt sich an sie die Dura mater an. Im Bereich der Fontanellen ist das Pulsieren der Arterien des Gehirns und der Membranen zu spüren, weshalb diese Bereiche als pulsierend, sprudelnd bezeichnet werden. Größe und Größe der Fontanellen unterliegen je nach Verknöcherungsgeschwindigkeit der Schädelknochen erheblichen Schwankungen. Wenn sich die Fontanellen schließen, kann man den Mineralstoffwechsel beurteilen und die körperliche Entwicklung des Kindes beurteilen. 1. Die vordere Fontanelle (Fonticulus anterior) ist unpaarig, normalerweise rautenförmig und misst 3,5 x 2,5 cm. Sie wird von den Schuppen des Stirnbeins und zweier Scheitelknochen begrenzt. Bis zum Ende des 2. Lebensjahres durch Knochen ersetzt. 2. Die hintere Fontanelle (Fonticulus posterior) ist ungepaart, liegt zwischen den Schuppen des Hinterhauptbeins und den Ecken der Scheitelknochen, hat eine dreieckige Form mit einer Länge von 1 cm. Der endgültige Verschluss wird am Ende des 2. Monats beobachtet nach der Geburt. 3. Die keilförmige Fontanelle (Fonticulus sphenoidalis) ist paarig, unregelmäßig rechteckig und misst 0,8 x 1,2 cm. Sie wird durch den Rand der vorderen unteren Ecke des Scheitelbeins, die Schuppen des Stirn- und Schläfenbeins und die begrenzt großer Flügel des Keilbeinknochens. 4. Mastoidfontanelle (Fonticulus mastoideus) ist paarig, etwas kleiner als die vorherige. Im Gegensatz zu anderen Fontanellen ist sie mit Knorpel bedeckt. Es befindet sich zwischen dem unteren hinteren Winkel des Scheitelbeins, der Schuppenschicht des Schläfenbeins und dem Hinterhauptbein. Die Keilbein- und Mastoidfontanellen schließen sich im 3. Monat nach der Geburt. Es gibt auch zusätzliche Fontanellen, die sich in den ersten Tagen nach der Geburt schließen (Abb. 75).
An der Schädelbasis werden mit Knorpel gefüllte Schichten unterschieden: 1) eine paarige Schicht, begrenzt durch die Pyramide des Schläfenbeins und die seitlichen Teile des Hinterhauptbeins, gefüllt mit Faserknorpel; 2) die Dampfschicht, die sich zwischen der Spitze der Pyramide und dem Keilbeinkörper befindet; 3) eine Knorpelschicht zwischen dem Keilbein und dem Hinterhauptsknochen. Dadurch entsteht ein Hang; 4) eine Knorpelschicht zwischen den einzelnen Teilen des Hinterhauptbeins.
Kiefergelenk(art. temporomandibularis), paarig, komplex (hat eine Gelenkscheibe), ellipsoidförmig, gebildet aus dem Gelenkkopf des Unterkiefers, der Fossa mandibularis und dem Gelenkhöcker des Schläfenbeins, bedeckt mit Faserknorpel (Abb. 107). ). Kopf des Unterkiefers(Caput mandibulae) hat die Form einer Walze. Unterkiefergrube(Fossa mandibularis) des Schläfenbeins dringt nicht vollständig in die Höhle des Kiefergelenks ein, daher werden seine extrakapsulären und intrakapsulären Anteile unterschieden. Der extrakapsuläre Teil der Fossa mandibularis liegt hinter der Felsspalte, der intrakapsuläre Teil liegt vor dieser Spalte. Dieser Teil der Fossa ist von einer Gelenkkapsel umschlossen, die bis zum Gelenkhöcker (Tuberculum articulae) des Schläfenbeins reicht. Gelenkkapsel

Reis. 107. Kiefergelenk, rechts. Aussenansicht. Das Gelenk wurde mit einem sagittalen Schnitt eröffnet. Der Jochbogen wurde entfernt.
1 - Unterkiefergrube, 2 - oberer Boden der Gelenkhöhle, 3 - Gelenkhöcker, 4 - oberer Kopf des M. pterygoideus lateralis, 5 - unterer Kopf des M. pterygoideus lateralis, 6 - Tuberkel des Oberkieferknochens, 7 - medial Pterygoidmuskel, 8 - Naht pterygomandibularis, 9 - Winkel des Unterkiefers, 10 - Ligamentum stylomandibularis, 11 - Ast des Unterkiefers, 12 - Kopf des Unterkiefers, 13 - unterer Boden der Gelenkhöhle des Kiefergelenks, 14 - Gelenkkapsel, 15 - Gelenkscheibe.
breit, frei, am Unterkiefer bedeckt es den Hals. Die Gelenkflächen sind mit Faserknorpel bedeckt. Im Inneren des Gelenks befindet sich Gelenkscheibe(Discus articularis), bikonkav, der die Gelenkhöhle in zwei Abschnitte (Böden) unterteilt, einen oberen und einen unteren. Die Ränder dieser Bandscheibe sind mit der Gelenkkapsel verwachsen. Der Hohlraum des Obergeschosses ist ausgekleidet obere Synovialmembran(Membrana synovialis superior), Untergeschoss des Kiefergelenks - Untere Synovialmembran(Membrana synovialis inferior). Ein Teil der Sehnenbündel des M. pterygoideus lateralis ist am medialen Rand des Diskus articularis befestigt.
Das Kiefergelenk wird durch intrakapsuläre (intraartikuläre) und Kapselbänder sowie extrakapsuläre Bänder gestärkt. In der Höhle des Kiefergelenks befinden sich die vorderen und hinteren diskotemporalen Bänder, die vom oberen Rand der Bandscheibe nach oben, nach vorne und hinten und zum Jochbogen verlaufen. Die intraartikulären (intrakapsulären) lateralen und medialen diskomandibulären Bänder verlaufen vom unteren Rand der Bandscheibe bis zum Hals des Unterkiefers. Seitenband(lig. laterale) ist eine seitliche Verdickung der Kapsel; sie hat die Form eines Dreiecks, dessen Basis dem Jochbogen zugewandt ist (Abb. 108). Dieses Band beginnt an der Basis des Jochbeinfortsatzes des Schläfenbeins und am Jochbogen und reicht bis zum Unterkieferhals.

Reis. 108. Seitenband des Kiefergelenks, rechts. Aussenansicht. 1 – Jochbogen, 2 – Jochbein, 3 – Processus coronoideus des Unterkiefers, 4 – Oberkieferknochen, 5 – zweiter Molar, 6 – Unterkiefer, 7 – dritter Molar, 8 – Kauhöcker, 9 – Ramus des Unterkiefers, 10 - Stylomandibularband, 11 - Kondylenfortsatz des Unterkiefers, 12 - vorderer (äußerer) Teil des Seitenbandes des Kiefergelenks, 13 - hinterer (innerer) Teil des Seitenbandes des Kiefergelenks, 14 - Warzenfortsatz des Schläfenbein, 15 - äußerer Gehörgang
Innenband (lig. mediale) verläuft entlang der ventralen Seite der Kiefergelenkskapsel. Dieses Band beginnt am inneren Rand der Gelenkfläche der Fossa mandibularis und der Basis der Wirbelsäule des Keilbeinknochens und ist am Hals des Unterkiefers befestigt.
Außerhalb der Gelenkkapsel des Gelenks befinden sich zwei Bänder (Abb. 109). Keilbeinband(lig. sphenomandibulare) beginnt an der Wirbelsäule des Keilbeinknochens und setzt an der Zäpfchenzäpfchen des Unterkiefers an. Stylomandibuläres Band(lig. stylomandibulare) verläuft vom Processus styloideus des Schläfenbeins zur Innenfläche des Unterkiefers, in der Nähe seines Winkels.
Im rechten und linken Kiefergelenk werden folgende Bewegungen ausgeführt: Senken und Anheben des Unterkiefers, entsprechend dem Öffnen und Schließen des Mundes, Vorwärtsbewegen des Unterkiefers und Zurückkehren in seine ursprüngliche Position; Bewegung des Unterkiefers nach rechts und links (seitliche Bewegungen). Das Absenken des Unterkiefers erfolgt, wenn sich die Köpfe des Unterkiefers im unteren Bereich des Gelenks um eine horizontale Achse drehen. Die seitliche Bewegung des Unterkiefers erfolgt unter Beteiligung der Gelenkscheibe. Im rechten Kiefergelenk dreht sich bei einer Bewegung nach rechts (und im linken Gelenk bei einer Bewegung nach links) der Kopf des Unterkiefers unter der Gelenkscheibe (um die vertikale Achse) und im gegenüberliegenden Gelenk der Der Kopf mit der Bandscheibe bewegt sich nach vorne (gleitend) auf das Tuberculum articularis.

Reis. 109. Extraartikuläre Bänder des Kiefergelenks. Innenansicht. Sagittaler Schnitt. 1 - Keilbeinhöhle, 2 - Seitenplatte des Processus pterygoideus des Keilbeinknochens, 3 - Ligamentum pterygospinale, 4 - Wirbelsäule des Keilbeinknochens, 5 - Unterkieferhals, 6 - Keilbeinband, 7 - Processus styloideus des Schläfenbeins Knochen, 8 - Kondylenfortsatz des Unterkiefers, 9 - Stylomandibularband, 10 - Öffnung des Unterkiefers, 11 - Pterygoideushaken, 12 - Pterygoideustuberosität, 13 - Winkel des Unterkiefers, 14 - Mylohyoidlinie, 15 - Backenzähne, 16 - Prämolaren, 17 – Reißzähne, 18 – harter Gaumen, 19 – mediale Platte des Pterygoideus, 20 – untere Muschel, 21 – Foramen sphenopalatinum, 22 – mittlere Muschel, 23 – obere Muschel, 24 – Stirnhöhle.
30,31 Fragen
Verbindungen zwischen der Wirbelsäule und dem Schädel
Zwischen dem Hinterhauptbein des Schädels und dem ersten Halswirbel befindet sich Atlantookzipitalgelenk(Art. atlanto-occipitalis), kombiniert (gepaart), kondylär (ellipsoidisch oder kondylär). Dieses Gelenk wird von zwei Kondylen des Hinterhauptbeins gebildet, die mit den entsprechenden oberen Gelenkgruben des Atlas verbunden sind (Abb. 112). Die Gelenkkapsel ist am Rand des Gelenkknorpels befestigt. Dieses Gelenk wird durch zwei atlantookzipitale Membranen verstärkt. Vordere Atlantookzipitalmembran (membrana atlanto-occipitalis anterior) erstreckt sich zwischen der Vorderkante des Foramen occipitalis des Hinterhauptbeins und dem vorderen Atlasbogen. Hintere Atlantookzipitalmembran (Membrana atlantooccipitalis posterior) ist dünner und breiter und liegt zwischen dem hinteren Halbkreis des Foramen occipitalis und der Oberkante des hinteren Atlasbogens. Die seitlichen Teile der hinteren Atlantookzipitalmembran werden genannt laterale atlantookzipitale Bänder (lig. atlantooccipitale laterale).
Am rechten und linken Atlanto-Occipital-Gelenke wird der Kopf um die Frontalachse nach vorne und hinten geneigt (Nickenbewegungen), um die Abduktion (Neigung des Kopfes zur Seite) und um die Adduktion (Rückwärtsbewegung des Kopfes zur Mitte). Sagittalachse.
Zwischen Atlas und Axialwirbeln befinden sich ein ungepaartes medianes Atlantoaxialgelenk und ein paariges laterales Atlantoaxialgelenk.
Atlantookzipitales Gelenk. Dies ist ein Kombinationsgelenk. Es besteht aus zwei Kondylengelenken, die symmetrisch rechts und links vom Foramen magnum unterhalb des Hinterhauptbeins angeordnet sind. Die Gelenkflächen jedes Kondylengelenks werden vom Kondylus des Hinterhauptbeins und der oberen Gelenkgrube des ersten Halswirbels gebildet. Jedes Gelenk ist in einer separaten Gelenkkapsel eingeschlossen und zusammen werden sie durch die vordere und hintere Atlantookzipitalmembran verstärkt. Die vordere Hinterhauptsmembran ist zwischen dem Basilarteil des Hinterhauptbeins und der Oberkante des vorderen Atlasbogens gespannt. Die hintere Atlantookzipitalmembran ist dünn, aber breiter als die vordere und erstreckt sich zwischen dem hinteren Halbkreis des Foramen magnum und der Oberkante des hinteren Atlasbogens. In beiden Gelenken erfolgt die Bewegung gleichzeitig um zwei Achsen: frontal und sagittal. Um die Frontalachse herum werden Flexion und Extension durchgeführt, also eine Neigung des Kopfes nach vorne und hinten (Nickenbewegungen). Normalerweise sind eine Flexion von 20° und eine Extension von 30° möglich. Um die Sagittalachse herum findet eine Abduktionsbewegung des Kopfes von der Mittellinie und eine Adduktion zu dieser statt. Das Bewegungsvolumen beträgt 15-20°.
Das Atlantoaxialgelenk besteht aus:
A. Medianes Atlantoaxialgelenk(Articulatio atlantoaxialis mediana)
Dieses Gelenk ist:
Zylindrisch (articulatio cylindrica) – hinter der Form;
Kombiniert (articulatio combinata) – hinter der Struktur (Art des Gelenks);
Einachsig – für die Funktion.
Gelenkflächen(facies articulares):
Zahngrube auf Atlanta (Fovea dentis atlantis);
Vordere Gelenkfläche des Zahns des Axialwirbels (Facies articularis anterior dentis axis);
Hintere Gelenkfläche des Zahns des Axialwirbels (Facies articularis posterior dentis axis);
Querband des Atlanta (Ligamentum transversum atlantis).
Bewegungen herum
Arten von Bewegungen:
Drehung (Rotatio) des Kopfes nach rechts und links, also Drehung nach außen (Rotatio externa);
Einwärtsrotation (rotatio interna).
B. Laterales Atlantoaxialgelenk (Articulatio atlantoaxialis lateralis), Dampfbad
Flach (articulatio plana) – hinter der Form;
Kombiniert (articulatio combinata) – hinter der Struktur (Art des Gelenks);
Mehrachsig – für die Funktion.
Gelenkflächen:
Untere Gelenkflächen von Atlantis (facies articulares inferiores atlantis);
Die oberen Gelenkflächen des Axialwirbels (Fazies articulares superiores axis).
Bewegungen herum vertikale Achse (Axis Verticalis).
Arten von Bewegungen: Drehung (Rotatio) des Kopfes nach rechts und links.
Hilfsapparat des medianen Atlantoaxialgelenks (Art. atlantoaxialis mediana) und des lateralen Atlantoaxialgelenks (Art. atlantoaxialis lateralis) allgemein und hat:
Pterygoidbänder (ligg. alaria);
Band der Zahnspitze (lig. apicis dentis);
Das Atlanta-Kreuzband (lig. cruciforme atlantis), das Folgendes umfasst:
Längsbündel (Fasciculi longitudinales);
Querband des Atlanta (lig. transversum atlantis);
Reifenmembran (membrana tectoria).

Reis. 112. Atlanto-okzipitale und atlanto-axiale Gelenke. Rückansicht. Die hinteren Teile des Hinterhauptbeins und der hintere Atlasbogen werden entfernt. 1 - Clivus, 2 - Band der Zahnspitze, 3 - Pterygoideum, 4 - seitlicher Teil des Hinterhauptbeins, 5 - Zahn des Axialwirbels, 6 - Foramen transversum des Atlas, 7 - Atlas, 8 - Axialwirbel, 9 - laterales Atlanto-Axis-Gelenk, 10 - Atlanto-Occipital-Gelenk, 11 - Kanal des Nervus hypoglossus, 12 - Vorderkante des Foramen magnum.
Mittleres Atlantoaxialgelenk (Art. atlantoaxialis mediana) gebildet durch die vorderen und hinteren Gelenkflächen des Zahns des Axialwirbels. Der vordere Zahn ist mit der Zahngrube verbunden, die sich auf der Rückseite des vorderen Atlasbogens befindet (Abb. 113). Nach hinten artikuliert der Zahn mit Querband des Atlas(lig. transversum atlantis), gespannt zwischen den Innenflächen der lateralen Massen des Atlas. Die vorderen und hinteren Gelenke des Zahns haben getrennte Gelenkhöhlen und Gelenkkapseln, werden aber als ein einziges medianes atlantoaxiales Gelenk betrachtet, bei dem eine Drehung des Kopfes relativ zur vertikalen Achse möglich ist: Drehung des Kopfes nach außen – Supination, und Drehung des Kopfes nach innen – Pronation.
Laterales Atlantoaxialgelenk (Art. atlantoaxialis lateralis), gepaart (kombiniert mit dem medianen Atlanto-Axial-Gelenk), gebildet durch die Gelenkgrube an der lateralen Masse des Atlas und die obere Gelenkfläche am Körper des Axialwirbels. Das rechte und das linke Atlantoaxialgelenk besitzen getrennte Gelenkkapseln. Die Gelenke sind flach geformt. Bei diesen Gelenken kommt es während der Rotation im medianen Atlanto-Axial-Gelenk zu einem Gleiten in der horizontalen Ebene.

Reis. 113. Verbindung des Atlas mit dem Zahn des Axialwirbels. Blick von oben. Horizontaler Schnitt auf Höhe des Zahns des Axialwirbels. 1 - Zahn des Axialwirbels, 2 - Gelenkhöhle des medianen Atlanto-Axialgelenks, 3 - Queratlasband, 4 - hinteres Längsband, 5 - Hautmembran, 6 - Foramen transversum des Axialwirbels, 7 - laterale Masse des Atlas, 8 - vorderer Atlasbogen.
Die medialen und lateralen Atlantoaxialgelenke werden durch mehrere Bänder gestärkt. Spitzenband(lig. apicis dentis), unpaarig, gespannt zwischen der Mitte des hinteren Randes des vorderen Umfangs des Foramen magnum und der Zahnspitze des Axialwirbels. Pterygoidbänder(ligg. alaria), gepaart. Jedes Band beginnt an der Seitenfläche des Zahns, ist schräg nach oben und seitlich gerichtet und an der Innenseite des Kondylus des Hinterhauptbeins befestigt.
Hinter dem Band der Zahnspitze liegen die Bänder des Pterygoideums Kreuzbandatlas(lig. cruciforme atlantis). Es wird vom Querband des Atlas und gebildet Längsträger(Fasciculi longitudinales) faseriges Gewebe, das vom Querband des Atlas auf und ab verläuft. Das obere Bündel endet am vorderen Halbkreis des Foramen magnum, das untere – an der hinteren Oberfläche des Axialwirbelkörpers. Hinten, von der Seite des Wirbelkanals her, sind die Atlantoaxialgelenke und ihre Bänder mit einem breiten und haltbaren Band bedeckt Bindegewebsmembran(membrana tectoria). Die Hautmembran gilt als Teil des hinteren Längsbandes der Wirbelsäule. Oben endet die Hautmembran an der Innenfläche des Vorderrandes des Foramen magnum.
Gelenke der Rumpfknochen
Es gibt 7 Wirbel im Halsbereich (in der Medizin werden sie üblicherweise als CI-CVII bezeichnet), im Brustbereich - 12 (TI-TXII), im Lendenbereich - 5 (LI-LV) und im Kreuzbeinbereich - 5 Wirbel (SI-SV), miteinander verwachsen (Abb. 1). Darüber hinaus befinden sich im Steißbein noch 3 bis 5 kleine Wirbel.
Die Wirbelsäule nimmt an folgenden Bewegungen teil:
¦ Flexion und Extension (Gesamtamplitude – 170–245°);
¦ nach rechts und links neigbar (Gesamtspannweite – 165°);
¦ dreht sich nach rechts und links (ca. 120°).
Im Wesentlichen sitzen die Wirbel auf einer Stange, dem Rückenmark. Unabhängig von der Zugehörigkeit zu einem bestimmten Teil der Wirbelsäule haben alle Wirbel eine gemeinsame Struktur und bestehen aus Körper, Bögen Und Prozesse.
Wirbelverbindungen
Zwischen den Wirbeln gibt es verschiedene Arten von Gelenken. Die Körper benachbarter Wirbel sind durch verbunden Bandscheiben(Disci intervertebrales), Prozesse – mit Hilfe von Gelenken und Bändern und Bögen – mit Hilfe von Bändern. Die Bandscheibe hat einen zentralen Teil

Reis. 110. Bandscheiben- und Facettengelenke. Blick von oben.
1 - unterer Gelenkfortsatz, 2 - Gelenkkapsel, 3 - Gelenkhöhle, 4 - oberer Gelenkfortsatz, 5 - Rippenfortsatz des Lendenwirbels, 6 - Faserring, 7 - Nucleus Pulposus, 8 - vorderes Längsband, 9 - hinterer Längsband, 10 – untere Wirbelkerbe, 11 – Ligamentum flavum, 12 – Dornfortsatz, 13 – supraspinales Band.
dauert Nucleus Pulposus(Nucleus Pulposus) und der periphere Teil - Anulus fibrosus(Annulus fibrosus), (Abb. 110). Der Nucleus Pulposus ist elastisch und verschiebt sich bei Beugung der Wirbelsäule in Richtung Streckung. Der Anulus fibrosus besteht aus Faserknorpel. Zwischen Atlas und Axialwirbel befindet sich keine Bandscheibe.
Die Verbindungen der Wirbelkörper werden durch die vorderen und hinteren Längsbänder verstärkt (Abb. 111). Vorderes Längsband(lig. longitudinale anterius) verläuft entlang der Vorderfläche der Wirbelkörper und Bandscheiben. Hinteres Längsband(lig. longitudinale posterius) verläuft innerhalb des Wirbelkanals entlang der hinteren Oberfläche der Wirbelkörper vom Axialwirbel bis zur Höhe des ersten Steißbeinwirbels.
Zwischen den Bögen liegen benachbarte Wirbel gelbe Bänder(ligg. flava), gebildet durch elastisches Bindegewebe.
Es bilden sich die Gelenkfortsätze benachbarter Wirbel bogenförmig, oder Zwischenwirbelgelenke(art. zygapophysiales, s. intervertebrales). Die Gelenkhöhle richtet sich nach der Lage und Richtung der Gelenkflächen. Im Halsbereich ist die Gelenkhöhle nahezu in einer horizontalen Ebene ausgerichtet, im Brustbereich – in der Frontalebene und im Lendenbereich – in der Sagittalebene.
Die Dornfortsätze der Wirbel sind über die Bänder interspinale und supraspinale miteinander verbunden. Interspinöse Bänder(ligg. interspinalia) liegt zwischen benachbarten Dornfortsätzen. Supraspinales Band(lig. supraspinale) ist an den Spitzen der Dornfortsätze aller Wirbel befestigt. Im Halsbereich wird dieses Band genannt Nackenband(lig. nuchae). Zwischen den Querfortsätzen befinden sich intertransversale Bänder(ligg. intertransversaria).
lumbosakraler Übergang, oder lumbosakral Das Gelenk (Articulatio lumbosacralis), das sich zwischen dem V-Lendenwirbel und der Basis des Kreuzbeins befindet, wird durch das Iliopsoas-Band gestärkt. Dieses Band verläuft vom hinteren oberen Rand des Darmbeins bis zu den Querfortsätzen der IV. und V. Lendenwirbel.
Kreuzbeingelenk(Art. sacrococcygea) stellt die Verbindung der Spitze des Kreuzbeins mit dem ersten Steißbeinwirbel dar. Die Verbindung des Kreuzbeins mit dem Steißbein wird durch das paarige laterale Kreuzbeinband verstärkt, das vom seitlichen Kreuzbeinkamm bis zum Querfortsatz des ersten Steißbeinwirbels verläuft. Kreuz- und Steißbein sind durch Bindegewebe miteinander verbunden (Syndemose).

Reis. 111. Verbindungen der Halswirbel und des Hinterhauptbeins. Ansicht von der medialen Seite. Die Wirbelsäule und das Hinterhauptbein werden in der Mittelsagittalebene gesägt.
1 - Basilarteil des Hinterhauptbeins, 2 - Zahn des Axialwirbels, 3 - oberer Längsbündel des Kreuzbandes des Atlas, 4 - Hautmembran, 5 - hinteres Längsband, 6 - hintere Atlantookzipitalmembran, 7 - Querband des Atlas, 8 - unteres Längsbündel des Kreuzbandes des Atlas, 9 - gelbe Bänder, 10 - interspinales Band, 11 - Foramen intervertebrale, 12 - vorderes Längsband, 13 - Gelenkhöhle des medianen Atlantis- Axialgelenk, 14 - vorderer Atlasbogen, 15 - Band der Zahnspitze, 16 - vordere Atlanto-Occipitalmembran, 17 - vorderes Atlanto-Occipital-Band.
Wirbelsäule (columna vertebralis) gebildet aus Wirbeln, die durch Bandscheiben (Symphysen), Gelenke, Bänder und Membranen miteinander verbunden sind. Die Wirbelsäule bildet Biegungen in der Sagittal- und Frontalebene (Kyphose und Lordose) und verfügt über eine große Beweglichkeit. Folgende Bewegungsarten der Wirbelsäule sind möglich: Beugung und Streckung, Abduktion und Adduktion (Seitenbeugung), Drehung (Rotation) und Kreisbewegung.
Physiologische Krümmungen der Wirbelsäule (Hals- und Lendenlordose, Brust- und Sakralkyphose) sowie elastische Bandscheiben sorgen für Federfunktionen der Wirbelsäule, schützen das Gehirn, das Rückenmark und die inneren Organe vor übermäßigen Stößen und erhöhen die Stabilität und Beweglichkeit des Körpers . Die physiologischen Krümmungen der Wirbelsäule entstehen während der Entwicklung der motorischen Fähigkeiten des Kindes und werden durch die Art der Veränderungen im Tonus seiner Muskeln bestimmt, und ihre Schwere hängt weitgehend vom Winkel des Beckens ab. Mit zunehmender Wirbelsäule beugt sich die Wirbelsäule, um die vertikale Position des Körpers beizubehalten, und die Lendenlordose und, kompensatorisch, die höheren Krümmungen nehmen entsprechend zu. Mit abnehmendem Beckenneigungswinkel nimmt die Krümmung der Wirbelsäule entsprechend ab.
Ein ähnlicher Mechanismus tritt auf, wenn sich die Position der Wirbelsäule in der Frontalebene ändert. Allerdings hat jede Biegung der Wirbelsäule den Charakter eines pathologischen Zustands.
Die normale Körperhaltung zeichnet sich durch eine symmetrische Anordnung der Körperteile relativ zur Wirbelsäule aus.
Die häufigste Pathologie der Wirbelsäule ist die Verschiebung der Bandscheiben. Die Wirbelsäule besteht aus Wirbeln, die durch Bandscheiben und Bänder miteinander verbunden sind. Wirbel sind Knochen, Bandscheiben und Bänder sind elastische und langlebige Gebilde. Es sind die Bandscheiben und Bänder, die für die Beweglichkeit und Federfähigkeit der Wirbelsäule sorgen. Wie bereits erwähnt, ist die Bandscheibe ein Faserring, in dessen Mitte sich ein mit einer gallertartigen Substanz gefüllter Kern befindet. Oben und unten ist die Bandscheibe durch Knorpelplatten vor Knochenkontakt geschützt. Wenn der Faserring der Bandscheibe geschwächt ist oder einer starken und/oder plötzlichen Belastung ausgesetzt ist, kann der Kern durch die Außenhülle in den Wirbelkanal austreten – es entsteht ein Bandscheibenvorfall. Dies liegt daran, dass beim Beugen der Wirbelsäule auch die Bandscheiben in die gleiche Richtung komprimiert werden und den Kern in die entgegengesetzte Richtung drücken. Daher ist es notwendig, Gewichte richtig zu heben, sich zu beugen und zu tragen, damit die Wirbelsäule gerade bleibt und der Druck auf die Bandscheiben gleichmäßig ist. Andernfalls drücken die Wirbel die Bandscheibe schräg und diese neigt dazu, in die Richtung des geringsten Drucks zu „schießen“. Infolgedessen kann eine verschobene Bandscheibe starken Druck auf das Rückenmark und die von ihm ausgehenden Nervenwurzeln ausüben. All dies verursacht starke und anhaltende Schmerzen, Entzündungen und Steifheit. Wenn Sie nichts tun, können Sie arbeitsunfähig werden.