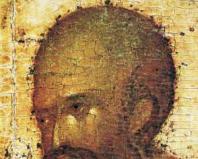Interaktives Diagramm des Betriebs einer Dampflokomotive. Allgemeiner Aufbau und Funktionsprinzip einer Dampflokomotive. Nach der Axialformel
In einigen Ländern werden noch immer Dampflokomotiven eingesetzt, deren Konstruktion im Vergleich zu anderen Technologien heute primitiv ist. Es handelt sich um autonome Lokomotiven Dampfmaschine. Die allerersten Lokomotiven dieser Art erschienen im 19. Jahrhundert und spielten eine Schlüsselrolle für die wirtschaftliche Entwicklung zahlreicher Länder.
Das Design der Dampflokomotive wurde ständig verbessert, wodurch neue Designs entstanden, die sich stark vom klassischen unterschieden. So entstanden Modelle mit Getriebe, Turbine und ohne Tender.
Funktionsprinzip und Aufbau einer Dampflokomotive
Auch wenn es welche gibt verschiedene Modifikationen Die Designs dieses Transportmittels bestehen alle aus drei Hauptteilen:
- Dampfmaschine;
- Kessel;
- Besatzung.
Dampf wird in einem Dampfkessel erzeugt – dieses Gerät ist die primäre Energiequelle und Dampf ist das Hauptarbeitsmedium. In einer Dampfmaschine wird es in eine Hubkolbenmaschine umgewandelt mechanisches Uhrwerk Kolben, der wiederum mit Hilfe eines Kurbelmechanismus in einen Rotationskolben umgewandelt wird. Dadurch drehen sich die Räder der Lokomotive. Dampf treibt auch eine Dampf-Luft-Pumpe und einen Dampfturbinengenerator an und wird in einer Pfeife verwendet.
Der Wagen des Fahrzeugs besteht aus einem Fahrgestell und einem Rahmen und ist eine bewegliche Basis. Diese drei Elemente sind die wichtigsten beim Entwurf einer Dampflokomotive. Am Fahrzeug ist außerdem ein Tender angebracht – ein Waggon, der als Lager für Kohle (Brennstoff) und Wasser dient.

Dampfkessel
Wenn Sie über den Aufbau und das Funktionsprinzip einer Dampflokomotive nachdenken, müssen Sie mit dem Kessel beginnen, da dieser die primäre Energiequelle ist Hauptbestandteil dieser Maschine. An dieses Element werden bestimmte Anforderungen gestellt: Zuverlässigkeit und Sicherheit. Der Dampfdruck in der Anlage kann 20 Atmosphären oder mehr erreichen, was sie praktisch explosiv macht. Eine Fehlfunktion eines beliebigen Elements des Systems kann zu einer Explosion führen, die der Maschine ihre Energiequelle entzieht.
Außerdem muss dieses Element einfach zu handhaben, zu reparieren, zu warten und flexibel sein, d. h. mit unterschiedlichen Brennstoffen (mehr oder weniger leistungsstark) arbeiten können.
Feuerraum
Das Hauptelement des Kessels ist der Ofen, in dem sie brennen fester Brennstoff, die über einen Kohlenstoffzuführer gespeist wird. Wenn die Maschine mit flüssigem Kraftstoff betrieben wird, erfolgt die Zufuhr über Düsen. Die bei der Verbrennung freigesetzten Hochtemperaturgase übertragen Wärme durch die Wände des Feuerraums auf Wasser. Dann geben die Gase nach am meisten Wärme zur Verdampfung von Wasser und Erhitzung von Sattdampf wird durch diese an die Atmosphäre abgegeben Schornstein und eine Funkenlöschvorrichtung.

Der im Kessel erzeugte Dampf wird in der Dampfglocke (im oberen Teil) gesammelt. Wenn der Dampfdruck über 105 Pa liegt, wird er durch ein spezielles Sicherheitsventil freigegeben, wodurch der Überschuss in die Atmosphäre abgegeben wird.
Über Rohre wird heißer Dampf unter Druck den Zylindern der Dampfmaschine zugeführt, wo er auf den Kolben, die Pleuelstange und den Kurbeltrieb drückt und so die Antriebsachse in Drehung versetzt. Der Abdampf gelangt in den Schornstein und erzeugt im Rauchraum ein Vakuum, das den Luftstrom in den Feuerraum des Kessels erhöht.
Arbeitsplan
Das heißt, wenn wir das Funktionsprinzip im Allgemeinen beschreiben, erscheint alles äußerst einfach. Wie das Schema einer Dampflokomotive aussieht, ist auf dem im Artikel veröffentlichten Foto zu sehen.

Ein Dampfkessel verbrennt Brennstoff, der Wasser erhitzt. Das Wasser wird in Dampf umgewandelt und mit zunehmender Erwärmung steigt der Dampfdruck im System. Wenn es einen hohen Wert erreicht, wird es in den Zylinder geleitet, in dem sich die Kolben befinden.
Durch den Druck auf die Kolben dreht sich die Achse und die Räder werden in Bewegung gesetzt. Überschüssiger Dampf wird durch ein spezielles Sicherheitsventil in die Atmosphäre abgegeben. Die Rolle des Letzteren ist übrigens äußerst wichtig, denn ohne ihn wäre der Kessel von innen zerrissen worden. So sieht der Kesselaufbau einer Dampflokomotive aus.
Vorteile
Wie andere Typen haben sie bestimmte Vor- und Nachteile. Die Vorteile sind wie folgt:
- Einfachheit des Designs. Aufgrund der einfachen Konstruktion der Dampfmaschine und des Kessels der Lokomotive war es nicht schwierig, die Produktion in Maschinenbau- und Hüttenwerken aufzubauen.
- Zuverlässigkeit im Betrieb. Die erwähnte Einfachheit des Designs gewährleistet eine hohe Zuverlässigkeit des gesamten Systems. Es gibt praktisch nichts, was man kaputt machen könnte, weshalb Dampflokomotiven 100 Jahre und länger im Einsatz sind.
- Kraftvolle Traktion beim Anfahren.
- Nutzungsmöglichkeit verschiedene Typen Kraftstoff.
Früher gab es so etwas wie „Allesfresser“. Es wurde auf Dampflokomotiven angewendet und ermittelte die Möglichkeit, Holz, Torf, Kohle und Heizöl als Treibstoff für diese Maschine zu verwenden. Manchmal wurden Lokomotiven mit Industrieabfällen beheizt: verschiedene Sägespäne, Getreidespelzen, Holzspäne, fehlerhaftes Getreide und gebrauchte Schmiermittel.
Natürlich wurden die Traktionsfähigkeiten der Maschine reduziert, aber auf jeden Fall ermöglichte dies erhebliche Einsparungen, da klassische Kohle teurer ist.

Mängel
Es gab auch einige Nachteile:
- Geringe Effizienz. Selbst bei den modernsten Dampflokomotiven lag der Wirkungsgrad bei 5–9 %. Dies ist angesichts des geringen Wirkungsgrades der Dampfmaschine selbst (ca. 20 %) logisch. Ineffiziente Brennstoffverbrennung, große Wärmeverluste bei der Übertragung der Dampfwärme vom Kessel auf die Zylinder.
- Der Bedarf an riesigen Treibstoff- und Wasserreserven. Besonders relevant wurde dieses Problem beim Betrieb von Maschinen in trockenen Gebieten (z. B. in Wüsten), wo die Wasserversorgung schwierig ist. Natürlich kamen etwas später Dampflokomotiven mit Abdampfkondensation auf den Markt, was das Problem jedoch nicht vollständig löste, sondern nur vereinfachte.
- Brandgefahr durch offenes Feuer brennenden Kraftstoffs. Dieser Nachteil besteht bei unbefeuerten Dampflokomotiven nicht, allerdings ist deren Reichweite begrenzt.
- Rauch und Ruß werden in die Atmosphäre freigesetzt. Dieses Problem wird gravierend, wenn Dampflokomotiven innerhalb besiedelter Gebiete fahren.
- Schwierige Bedingungen für das Team, das das Fahrzeug wartet.
- Arbeitsintensität von Reparaturen. Wenn an einem Dampfkessel etwas kaputt geht, dauert die Reparatur lange und erfordert Investitionen.
Trotz ihrer Mängel genossen Dampflokomotiven einen hohen Stellenwert, da ihr Einsatz das Niveau der Industrie erheblich steigerte verschiedene Länder. Natürlich ist der Einsatz solcher Maschinen heutzutage nicht mehr relevant, da es mehr davon gibt moderne Motoren Verbrennungs- und Elektromotoren. Es waren jedoch Dampflokomotiven, die den Grundstein für die Entstehung des Eisenbahnverkehrs legten.

Abschließend
Jetzt kennen Sie den Aufbau einer Dampflokomotive, ihre Eigenschaften, Vor- und Nachteile des Betriebs. Heute übrigens auf den Bahnstrecken unterentwickelte Länder(zum Beispiel in Kuba) sind diese Maschinen immer noch im Einsatz. Bis 1996 wurden sie auch in Indien eingesetzt. In europäischen Ländern, den USA und Russland existiert diese Transportart nur in Form von Denkmälern und Museumsausstellungen.
Beschreibung des Gerätes und Grundprinzipien des Betriebs von Dampflokomotiven, Fotos von Dampflokomotiven
Schematischer Ausschnitt der Dampflokomotive E:
1 - Feuerraum;
2 - Flammrohre;
3 - Rauchrohre;
4 - Rauchkammer;
6 - Sicherheit
7 - Dampftank;
8 - Regler;
9 - Elemente
Überhitzer;
10 - Dampfarbeitsrohre;
11 - Dampfzylinder
12 - Kolben;
14 - Kolbendeichsel;
15 - Paare;
16 - Spule;
17 - Pfeife;
18 - Fahrerkabine;
19 - Sandkasten,
20 - Hauptluft
Lagertank;
21 - Kohlereserven im Tender;
22 - Tenderwassertank
Die in den vorherigen Kapiteln genannten Informationen basieren auf minimalen Kenntnissen über den Aufbau einer Dampflokomotive. Zur Zeit ist eine lebende Dampflokomotive im Einsatz Eisenbahn- sehr selten. Das Erscheinen eines solchen Autos am Bahnhof löst bei vielen Überraschung, Freude und ein helles nostalgisches Gefühl aus. Leider kennt die überwiegende Mehrheit der Menschen den Aufbau der Lokomotive, der ihre Aufmerksamkeit so sehr auf sich zieht, nicht. Deshalb müssen wir kurz darüber sprechen.
Eine Dampflokomotive besteht aus drei Hauptteilen: einem Kessel, der Dampf erzeugt, einer Dampfmaschine, in der der Dampfdruck in die Drehung der Räder umgewandelt wird, und dem Fahrwerk – dem Rahmen und den Radpaaren. Der fest mit der Lokomotive gekoppelte Tender sorgt während der Fahrt für den nötigen Wasser- und Treibstoffvorrat.
Der Kessel besteht aus einem Verbrennungsteil, einem zylindrischen Teil und einer Rauchkammer.
Die Energiequelle einer Dampflokomotive ist die Verbrennung von Kraftstoff. Sie findet im Feuerraum (1) statt, der sich an der Rückseite des Kessels in der Nähe der Kabine befindet. Der Feuerraum ist an den Seiten und oben von Wasser umgeben und unten befindet sich ein Rost, auf dem tatsächlich die Verbrennung stattfindet.
Anschließend strömen die heißen Rauchgase durch die Flammen- (2) und Rauchrohre (3), die sich im zylindrischen Teil des Kessels befinden, und geben ihre Wärme weiterhin an das Wasser um diese Rohre ab (ein sogenannter Feuerkessel). -Rohr Typ). Flammrohre haben einen viel größeren Durchmesser als Rauchrohre. Die Flammrohre enthalten dünne Überhitzerrohre, sogenannte Elemente, die im Folgenden erläutert werden. Rauchrohre dienen ausschließlich der Durchleitung von Rauchgasen.
Aus den Flammen- und Rauchrohren austretend gelangen die Rauchgase in die Rauchkammer (4) und treten durch den Schornstein aus. Ein Lokomotivkessel ist in der Regel horizontal angeordnet und die Höhe vom Rost bis zur Schornsteinoberkante reicht nicht aus, um den für eine intensive Verbrennung notwendigen starken Zug zu erzeugen. Daher wird es in einer Dampflokomotive eingesetzt Zwangsentzug. Der in der Dampfmaschine ausgestoßene Dampfstrahl wird durch eine unter dem Schornstein angebrachte Düse, den sogenannten Kegel (5), in den Schornstein geleitet. Dadurch entsteht ein starkes Vakuum in der Räucherkammer, wodurch heißer Rauch durch den gesamten Gasweg des Kessels gedrückt wird intensive Verbrennung Kraftstoff. Durch die Erwärmung kocht das Wasser im Kessel. Wenn der entstehende Dampf nicht nach außen abgegeben wird, erhöht sich sein Druck. Unter Druck stehender Dampf wird zum Betrieb einer Dampfmaschine verwendet. In der Lokomotive der E-Serie wird der Dampfdruck auf 12 Atmosphären gehalten. Steigt der Druck über den Betriebsdruck, werden die Sicherheitsventile (6) aktiviert und geben überschüssigen Dampf an die Luft ab.
Dampf für den Betrieb der Dampfmaschine wird aus der Dampfkammer (7) – dem Deckel oben am Kessel – entnommen. Der Zweck des Dampfgarers besteht darin, den Dampf von Wasserspritzern zu reinigen. Im Dampftank befindet sich der Anfang der Dampfleitung zur Dampfmaschine, verschlossen durch ein spezielles Ventil – Regler (8). Mit dem Regler können Sie den Dampfdurchgang ganz stufenlos erhöhen und so die erforderliche Leistung der Lokomotive regulieren. Der Steuergriff für dieses Ventil befindet sich im Lokkasten und wird auch Regler genannt.
Ziehen um
und Dampfverteilungsmechanismus der Lokomotive der E-Serie.
1 - Kolbenstange (Nudelholz);
2 - Kreuzkopf (Schieber, Faust);
3 - Kolben (Antrieb)
4 - Kupplungsdeichsel (doppelt);
5 - Gegenkurbel;
6 - Kippstange;
7 - Kordelzug;
8 - Spulenstange;
10 - parallel;
11 - Spulenstange;
12 - Kipphebelhalterung;
13 - Antriebsradpaar;
14 - Kupplungsradsatz;
15 - Pendelleine;

Der Dampf, der den Siedepunkt von Wasser hat, kondensiert schnell und verwandelt sich wieder in Wasser. Gleichzeitig werden Leistung und Effizienz der Lokomotive reduziert. Daher verwenden Dampflokomotiven ein Gerät, das die Temperatur des Dampfes erhöht – einen Überhitzer. Der Überhitzer besteht aus vielen dünnen Rohren (9), die jeweils in einem Flammrohr liegen. Vom Steuerrohr aus gelangt der Dampf verzweigt in alle diese dünnen Rohre, macht in den Flammrohren ein oder zwei Umdrehungen und wird in diesen durch die Hitze der Rauchgase auf 300-350 °C erhitzt. Überhitzter Dampf wird durch Dampfarbeitsrohre (10) in die Zylinder (11) der Dampfmaschine der Lokomotive geleitet.
Die Dampfmaschine einer Dampflokomotive besteht in der Regel aus zwei Dampfzylinder mit der einfachsten Kurbelwelle und anderen Mechanismen. Die Dampfmaschinenzylinder befinden sich auf der rechten und linken Seite der Lokomotive vor den Kuppelradpaaren. Dampf strömt abwechselnd in den vorderen und hinteren Teil des Zylinders und bewegt mit seinem Druck den im Zylinder befindlichen Kolben (12) von einem Ende des Zylinders zum anderen. Eine starr mit dem Kolben verbundene Stange (13) bewegt das Kolbenventil (Pleuel) (14), was wiederum das Antriebsrad der Lokomotive in Drehung versetzt. Die übrigen Räder sind über Zwillinge (15) mit dem Antriebsrad verbunden und werden von diesem in Drehung versetzt.
Natürlich kann der Dampf selbst nicht abwechselnd in den vorderen und hinteren Teil der Zylinder gelangen. Dafür gibt es Schaltanlage- Spule (16). Die Bewegung der Spule erfolgt über einen komplexen Hebelmechanismus, der die Bewegung des Antriebsrads und der Stange berücksichtigt. Der Hub der Spule lässt sich stufenlos verstellen. Dieser als Dampfverteilungsmechanismus bezeichnete Mechanismus sorgt nicht nur für den richtigen Wechsel von Dampfeinlass und -auslass, sondern ermöglicht auch, dass der Zylinder nicht während des gesamten Kolbenhubs, sondern nur für einen Teil davon mit Dampf gefüllt wird, wodurch der Einlass unterbrochen wird. Dies ist notwendig, um den Wirkungsgrad der Lokomotive zu steigern und die benötigte Leistung zu regulieren. Darüber hinaus ermöglicht der Dampfverteilungsmechanismus eine Richtungsänderung der Lokomotive. Die Einstellung der Bewegungsrichtung und die stufenlose Änderung der Abschaltung erfolgen von der Kabine aus über eine Steuerung namens Rückwärtsgang.
Dampf in einer Dampflokomotive wird nicht nur zur Erfüllung der Hauptfunktion – der Traktionserzeugung – verwendet, sondern auch zum Antrieb aller Hilfsgeräte.
Der Lokkasten (18) befindet sich hinter dem Feuerraum. Im Lokkasten befinden sich Bedienelemente für die Lokomotive und Steuergeräte. Die Kabine ist mit Injektoren zur Wasserversorgung des Kessels und allen Ventilen (etwa zwanzig davon) ausgestattet, die den Dampfzugang für alle ermöglichen zusätzliche Geräte. In die Kabine mündet ein Verbrennungsloch – ein Loch, durch das Kohle geworfen wird.
Verkaufsstand - Arbeitsplatz Fahrer und Beifahrer. Die Aufgabe des Triebfahrzeugführers besteht darin, die Bewegung des Zuges zu kontrollieren. Die Aufgabe des Assistenten besteht darin, den erforderlichen Dampfdruck im Kessel aufrechtzuerhalten. Der Assistent heizt die Lokomotive auf und überwacht den Wasserstand im Kessel, indem er Wasser mit einem Injektor pumpt. Bei der Kohleheizung arbeitet das dritte Mitglied der Lokbesatzung, der Heizer, am Tender. Er schaufelt die Kohle zur Vorderseite des Tenders in einen Schacht, von wo aus der Sumpfmann die Kohle aufnimmt.
Trotz der scheinbaren Einfachheit und Klarheit konstruktive Lösungen Aus technischer Sicht ist die Lokomotive ungewöhnlich fein organisiert.
Wenn wir von einer Dampflokomotive als Lokomotive sprechen ( Kraftwerk für die Traktion von Zügen), dann ist jede Dampflokomotive in den beiden wichtigsten Worten eine Feuerbüchse und ein Kuppelgewicht. Der Feuerraum ist der Energieerzeuger der Lokomotive. Die von der Lokomotive entwickelte Leistung hängt vollständig davon ab, wie viel Kraftstoff pro Zeiteinheit im Ofen verbrannt wird. Ein ausreichendes Klebegewicht sorgt für eine dieser Kraft entsprechende Zugkraft. In einer gut konstruierten Dampflokomotive, der einzigen Lokomotive aller Art, wird automatisch das genaueste Gleichgewicht zwischen Leistung und Gewicht aufrechterhalten, genau das, was V.I. Lopuschinsky nannte es Harmonie.
Der Hauptvorteil einer Dampflokomotive gegenüber einer Diesellokomotive und einer Elektrolokomotive liegt in den Eigenschaften ihrer Kolbendampfmaschine. Er ist absolut unempfindlich gegenüber Überlastungen und ist im Gegensatz zu einem Verbrennungsmotor und einem Elektromotor in der Lage, beim Anfahren ein maximales Drehmoment zu entwickeln.
Der zweite Vorteil liegt in der Eigenschaft eines Flammrohrdampfkessels, der über einen erheblichen Vorrat an unter Betriebsdruck siedendem Wasser verfügt, von dem ein Teil bei Bedarf sofort in Dampf umgewandelt werden kann (der Wasserstand im Kessel und der Dampf). Druck wird reduziert). Bei besonders intensivem Betrieb einer Dampflokomotive diente der Kessel als Batterie zur Freisetzung vorgespeicherter Energie, die es ermöglichte, die von der Lokomotive entwickelte Leistung kurzzeitig zu erhöhen, ohne die Lokomotive zu beschädigen. Diese Eigenschaft war weit verbreitet und wurde treffend als „Leiharbeit aus dem Kessel“ bezeichnet.
Eine Dampflokomotive besteht aus drei Hauptteilen, die zu einem zusammengefasst sind: dem Kessel, der Dampfmaschine und der Besatzung. Der Besatzung ist in der Regel ein Tender fest angeschlossen, der der Lagerung von Treibstoff, Wasser, Schmier- und Reinigungsmitteln dient.
Das Funktionsprinzip einer Dampflokomotive ist wie folgt. Im Teil des Kessels, der Brennkammer A (Abb. 1) genannt wird, wird Brennstoff verbrannt. Verbrennungsgase aus weiterverbrennendem Kraftstoff Gitter 29, um den Bogen 3 herumgehend, unterstützt durch die Zirkulationsrohre 2, waschen die Wände des Feuerraums 4 und treten durch die Löcher des hinteren Rohr-(Feuer-)Gitters 5 in die Feuer- und Rauchrohre 7 ein und geben sie durch deren Wände ab geben ihre Hitze ans Wasser ab. Nachdem die Gase durch die Löcher des vorderen Rohrbodens 11 in die Rauchkammer B ausgetreten sind, umgehen sie die Funkenschilde, passieren das Funkenfangnetz 16 und treten durch den Schornstein 15 in die Atmosphäre aus. Schlacke und Asche fallen durch die Löcher des Rosts in den Aschekasten 28. Der beim Erhitzen des Wassers im Kessel entstehende Dampf sammelt sich oberhalb des Wassers in einem von den Kesselwänden umschlossenen Raum, wodurch sein Druck allmählich ansteigt , den Arbeiter erreichen.
Um die Lokomotive in Bewegung zu setzen, wird der Regler 10 über den Antrieb 30 geöffnet und Dampf aus der Dampfhaube 9 gelangt in die Sattdampfkammer 12 des Überhitzerverteilers. Anschließend strömt der Dampf durch die in den Flammrohren befindlichen Rohre (Elemente) 5 des Überhitzers. Durch die Erwärmung durch Verbrennungsgase steigt die Temperatur des Dampfes in den Elementen des Überhitzers auf 400–450 °C und bei dieser Temperatur gelangt er in die Heißdampfkammer 13 des Überhitzerverteilers, von wo aus er durch die Dampfeinlassrohre 14 gelangt zur Dampfmaschine der Lokomotive.
20 Zylinder potenzielle Energie Paar verwandelt sich in mechanische Energie Durch die Hin- und Herbewegung des Kolbens 21 drehen die zugehörige Kolbenzugstange 22 und die Kupplungszugstangen 23 die Antriebsräder 24. Der in der Dampfmaschine ausgestoßene Dampf tritt durch die Dampfauslassrohre 19 in den Kraftkegel 18 aus und erzeugt einen Gaszug in der Dampfmaschine Kessel und dann durch den Schornstein 15 zusammen mit den Verbrennungsgasen in die Atmosphäre.
Die Besatzung der Dampflokomotive umfasst einen Kessel, eine Dampfmaschine, einen Führerstand 1 und bei Nichttenderlokomotiven Tanks für Treibstoff- und Wasservorräte. Durch die Wechselwirkung der Antriebsräder des Wagens mit den Schienen während des Betriebs der Dampfmaschine entsteht eine Zugkraft, die über die Kupplung 27 zwischen Lokomotive und Tender und dann über die automatische Kupplung 26 auf die Wagen einwirkt an der Lokomotive befestigt und zwingt sie, sich mit ihr fortzubewegen.
Zur Erleichterung der Durchfahrt und Verkehrssicherheit mit hohe Geschwindigkeit Auf gekrümmten Streckenabschnitten sind Hochgeschwindigkeits-Dampflokomotiven mit einem vorderen Drehgestell (Läufer) 40 ausgestattet. Bei Hochleistungslokomotiven mit breitem und schwerem Feuerraum wurde die Besatzung durch ein hinteres (tragendes) Drehgestell 25 ergänzt, das hat Räder mit kleinem Durchmesser, die es ermöglichen, es unter dem Feuerraum zu platzieren.
Dampflokomotiven, die für den Betrieb von Werks- und Zufahrtsgleisen gebaut wurden Industrieunternehmen, haben keine Tender (Tenderlokomotive).
 Eine visuelle Darstellung der Wärmeverteilung im von einer Lokomotive verbrauchten Kraftstoff kann das Diagramm in Abb. 2.
Eine visuelle Darstellung der Wärmeverteilung im von einer Lokomotive verbrauchten Kraftstoff kann das Diagramm in Abb. 2.
Die Verluste im Ofen 1 werden auf durchschnittlich 8 % geschätzt und bestehen aus chemisch und mechanisch unverbranntem Brennstoff. Chemische Unterverbrennung wird durch die Unfähigkeit erklärt, den gesamten Kohlenstoff C in Oxid – CO 2 – zu verbrennen; Ein Teil des Kohlenstoffs verbrennt aufgrund von Luftmangel zu Kohlenmonoxid CO, ohne die gesamte Wärme abzugeben, die bei der vollständigen Oxidation von Kohlenstoff freigesetzt werden kann. Die mechanische Unterverbrennung besteht aus der Verschleppung unverbrannter kleiner Brennstoffpartikel aus dem Ofen mit Luft- und Gasströmen sowie aus dem Eintritt in die Schlacke und dem Ausfall einer bestimmten Brennstoffmenge durch den Rost in den Aschekasten.
Der Betriebsverbrauch von Dampf 2, der durchschnittlich etwa 6,5 % beträgt, ist für den Betrieb der Dampfmaschine der Kohlezuführung, die Verteilung der Kohle auf dem Rost, die Wasserversorgung des Kessels, die Spülung von Flammen- und Rauchrohren und den Betrieb der Dampf-Luft-Pumpe erforderlich und Antreiben der Turbine des elektrischen Generators.
Verluste für die externe Kühlung des Kessels 3, die auf durchschnittlich 1,5 % geschätzt werden, bedürfen keiner Erklärung. IN Winterzeit Sie nehmen zu, da die Temperatur der den Kessel umgebenden Luft sinkt.
Der zweitgrößte Verlust – bei Abgasen 4 – kann im Mittel mit 17–18 % angenommen werden. Sie kann durch Erhitzen der Luft mit Abgasen reduziert werden.
Der unvermeidliche Dampfaustritt 5 durch die Dichtungen und verschiedene Dichtungen wird üblicherweise mit 5 % angenommen. Durch sorgfältige Pflege der Lokomotive und hochwertige Reparaturen können diese Verluste jedoch deutlich reduziert werden.
Die größten Verluste entstehen durch die im Abdampf 6 enthaltene Wärmereserve, die die Dampfmaschine verlässt; Sie betragen 52–53 % und können durch die Nutzung eines Teils des Abdampfs zur Erwärmung des Speisewassers, eine gute Einstellung der Dampfverteilung und eine ordnungsgemäße Steuerung der Lokomotive reduziert werden.
Mechanische Verluste in der Maschine und in den Lagerzapfen aufgrund von Reibung 7 werden auf 1,5–2 % geschätzt. Durch den Einsatz von Wälzlagern in der Deichselmechanik und den Achslagern können diese Verluste etwas reduziert werden gute Pflege, rechtzeitige und korrekte Schmierung der Reibstellen.
Aus den vorgelegten Daten sticht es deutlich hervor sehr wichtig sparsamer Kraftstoffverbrauch.