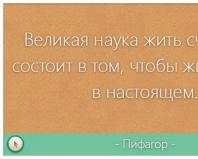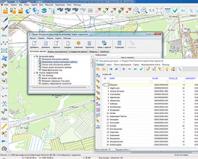Eisschlacht am Ladogasee. Schlacht am Eis (Schlacht am Peipussee)
Quellen lieferten uns nur sehr dürftige Informationen über die Eisschlacht. Dies trug dazu bei, dass die Schlacht nach und nach von einer Vielzahl von Mythen und widersprüchlichen Fakten überwuchert wurde.
Wieder Mongolen
Es ist nicht ganz richtig, die Schlacht am Peipussee als Sieg russischer Truppen über die deutsche Ritterschaft zu bezeichnen, da der Feind modernen Historikern zufolge eine Koalitionstruppe war, zu der neben den Deutschen auch dänische Ritter, schwedische Söldner usw. gehörten Miliz bestehend aus Esten (Chud).
Es ist durchaus möglich, dass die von Alexander Newski angeführten Truppen nicht ausschließlich russisch waren. Der polnische Historiker deutscher Herkunft, Reinhold Heidenstein (1556-1620), schrieb, dass Alexander Newski vom mongolischen Khan Batu (Batu) in die Schlacht gedrängt wurde und ihm seine Abteilung zu Hilfe schickte.
Diese Version hat das Recht auf Leben. Die Mitte des 13. Jahrhunderts war geprägt von einer Konfrontation zwischen der Horde und westeuropäischen Truppen. So besiegten Batus Truppen 1241 die Deutschen Ritter in der Schlacht von Liegnitz, und 1269 halfen mongolische Truppen den Nowgorodern, die Stadtmauern vor der Invasion der Kreuzfahrer zu verteidigen.
Wer ist unter Wasser gegangen?

In der russischen Geschichtsschreibung war einer der Faktoren, die zum Sieg der russischen Truppen über die Deutschen und Livländischen Ritter beitrugen, das fragile Quelleis und die sperrige Rüstung der Kreuzfahrer, die zu massiven Überschwemmungen des Feindes führten. Glaubt man jedoch dem Historiker Nikolai Karamzin, war der Winter in diesem Jahr lang und das Frühlingseis blieb stark.
Es ist jedoch schwierig zu bestimmen, wie viel Eis einer großen Anzahl in Rüstung gekleideter Krieger standhalten könnte. Der Forscher Nikolai Chebotarev bemerkt: „Es ist unmöglich zu sagen, wer in der Eisschlacht schwerer oder leichter bewaffnet war, weil es keine Uniform als solche gab.“
Schwere Plattenrüstungen tauchten erst im 14. und 15. Jahrhundert auf, und im 13. Jahrhundert war die Hauptrüstung ein Kettenhemd, über dem ein Lederhemd mit Stahlplatten getragen werden konnte. Aufgrund dieser Tatsache vermuten Historiker, dass das Gewicht der Ausrüstung der russischen und Ordenskrieger ungefähr gleich war und 20 Kilogramm erreichte. Wenn wir davon ausgehen, dass das Eis das Gewicht eines Kriegers in voller Ausrüstung nicht tragen konnte, dann müsste es auf beiden Seiten Versunkene gegeben haben.
Interessanterweise gibt es in der Livländischen Reimchronik und in der Originalausgabe der Novgorod-Chronik keine Informationen darüber, dass die Ritter durch das Eis gefallen sind – sie wurden erst ein Jahrhundert nach der Schlacht hinzugefügt.
Auf der Insel Woronii, in deren Nähe Kap Sigovets liegt, ist das Eis aufgrund der Strömungseigenschaften recht schwach. Dies veranlasste einige Forscher zu der Vermutung, dass die Ritter genau dort durch das Eis fallen könnten, wenn sie auf ihrem Rückzug ein gefährliches Gebiet durchquerten.
Wo war das Massaker?

Forscher können den genauen Ort, an dem die Eisschlacht stattfand, bis heute nicht bestimmen. Quellen aus Nowgorod sowie der Historiker Nikolai Kostomarov sagen, dass die Schlacht in der Nähe des Rabensteins stattfand. Der Stein selbst wurde jedoch nie gefunden. Einigen zufolge handelte es sich um hohen Sandstein, der im Laufe der Zeit von der Strömung weggespült wurde, andere behaupten, dass es sich bei dem Stein um Crow Island handele.
Einige Forscher neigen zu der Annahme, dass das Massaker überhaupt nichts mit dem See zu tun hat, da die Ansammlung einer großen Anzahl schwer bewaffneter Krieger und Kavallerie eine Schlacht auf dem dünnen Aprileis unmöglich machen würde.
Diese Schlussfolgerungen basieren insbesondere auf der Livländischen Reimchronik, die berichtet, dass „auf beiden Seiten die Toten ins Gras fielen“. Diese Tatsache wird durch moderne Forschungen am Grund des Peipsi-Sees mit modernster Ausrüstung gestützt, bei denen keine Waffen oder Rüstungen aus dem 13. Jahrhundert gefunden wurden. Auch am Ufer scheiterten Ausgrabungen. Dies ist jedoch nicht schwer zu erklären: Rüstungen und Waffen waren sehr wertvolle Beute und konnten selbst beschädigt schnell abtransportiert werden.
Doch bereits zu Sowjetzeiten ermittelte eine Expeditionsgruppe des Instituts für Archäologie der Akademie der Wissenschaften unter der Leitung von Georgi Karajew den angeblichen Ort der Schlacht. Forschern zufolge handelte es sich dabei um einen Abschnitt des Teploe-Sees, der 400 Meter westlich von Kap Sigovets liegt.
Anzahl der Parteien

Sowjetische Historiker geben bei der Bestimmung der Zahl der am Peipussee aufeinandertreffenden Truppen an, dass die Truppen von Alexander Newski etwa 15.000 bis 17.000 Menschen zählten und die Zahl der deutschen Ritter 10.000 bis 12.000 erreichte.
Moderne Forscher halten solche Zahlen für deutlich überschätzt. Ihrer Meinung nach konnte der Orden nicht mehr als 150 Ritter hervorbringen, zu denen etwa 1,5 Tausend Knechts (Soldaten) und 2000 Milizen hinzukamen. Ihnen standen Truppen aus Nowgorod und Wladimir in Höhe von 4-5.000 Soldaten gegenüber.
Das wahre Kräfteverhältnis ist recht schwer zu bestimmen, da die Zahl der deutschen Ritter in den Chroniken nicht angegeben ist. Sie lassen sich aber an der Zahl der Burgen im Baltikum messen, von denen es Historikern zufolge Mitte des 13. Jahrhunderts nicht mehr als 90 gab.
Jede Burg gehörte einem Ritter, der auf einem Feldzug 20 bis 100 Söldner und Diener mitnehmen konnte. In diesem Fall durfte die maximale Zahl der Soldaten, ohne die Miliz, 9.000 Menschen nicht überschreiten. Aber höchstwahrscheinlich sind die tatsächlichen Zahlen viel bescheidener, da einige der Ritter im Jahr zuvor in der Schlacht von Liegnitz gefallen sind.
Moderne Historiker können mit Sicherheit nur eines sagen: Keine der gegnerischen Seiten hatte eine nennenswerte Überlegenheit. Vielleicht hatte Lev Gumilyov Recht, als er annahm, dass die Russen und Germanen jeweils 4.000 Soldaten versammelten.
Die Schlacht auf dem Eis oder die Schlacht am Peipussee gilt zu Recht als einer der wichtigsten Siege in der Geschichte unseres Landes.
Es ist sehr wichtig für die nationale Identität des russischen Volkes.
Nicht umsonst wurde der russische Fürst, unter dessen Führung dieser Sieg errungen wurde, viel später heiliggesprochen und ging unter dem Namen Alexander Newski in die russische Geschichte ein.
Geschichte der Ereignisse
Bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts litt Rus nicht nur unter feudalen Fehden zwischen Fürsten und den brutalsten Überfällen der Mongolen-Tataren. Der militante Livländische Orden drang ständig in seine nordwestlichen Gebiete ein. Die Mönche dieses militanten Ritterordens verbreiteten im Dienste der römischen Kirche den Katholizismus mit Feuer und Schwert.
Nachdem sie die baltischen Länder vollständig unter ihre Kontrolle gebracht hatten, wollten sie Pskow und Nowgorod unterwerfen. 1242 eroberten die Kreuzfahrer Pskow, Isborsk und Koporje. Bis Nowgorod waren es nur noch 30 km. Die Nowgoroder wandten sich an ihren Fürsten Alexander Jaroslawitsch mit der Bitte, ihnen zu verzeihen und mit seiner Truppe zurückzukehren, um die Stadt zu verteidigen.
Fortschritt der Schlacht
Und am 5. April 1242 fand diese bedeutende Schlacht statt. Die Armee der Angreifer bestand aus Kreuzrittern, es waren überwiegend Deutsche. Auf ihrer Seite standen die Krieger des Chud-Stammes, die sich dem Livländischen Orden unterwarfen. Die Gesamtzahl betrug etwa 20.000. Alexanders Armee zählte zusammen mit seinem Trupp und seiner Miliz 15.000 Mann.
Der Prinz wartete nicht auf den Angriff des Feindes, sondern kam ihm entgegen. Die Deutschen gingen davon aus, dass sie die Russen, die in der Mehrheit über Fußsoldaten verfügten, leicht besiegen würden, doch es kam völlig anders. Die Vorhut der Ritter stürmte in die Schlacht und zerschmetterte die Infanterieformation der Nowgorod-Miliz. Unter dem Druck des Feindes begann die Infanterie, sich auf das Eis des Peipussees zurückzuziehen und riss die Ritter mit sich.

Schlacht am Eis (Schlacht am Peipussee) 1242g Foto
Als sich die meisten Deutschen auf dem Eis befanden, schlug die Kavallerie im Hinterhalt von den Flanken aus zu. Der Feind war umzingelt und die fürstliche Truppe zog in die Schlacht. Das dünne Frühlingseis begann unter den schwer bewaffneten, in Eisen gekleideten Rittern zu brechen. Die Überlebenden flohen um ihr Leben. Der russische Prinz errang einen vollständigen Sieg. Nach diesem Sieg nannten sie ihn Newski.
Die Einzigartigkeit der Schlacht am Peipussee liegt darin, dass die schwer bewaffnete Kavallerie aus Berufskriegern von der Fußarmee der Miliz besiegt wurde. Natürlich spielten das Wetter und das Gelände eine wichtige Rolle bei diesem Sieg. Aber das Verdienst des russischen Kommandanten besteht darin, dass er all dies kompetent berücksichtigt und auch den Überraschungsfaktor genutzt hat.
Bedeutung
Der Sieg von Alexander Newski in der Eisschlacht zwang den Livländischen Orden, Frieden zu schließen und nicht nur auf Gebietsansprüche zu verzichten, sondern auch die zuvor eroberten Gebiete Pskow und Nowgorod zurückzugeben. Aber das Wichtigste war, dass Nowgorod in der Lage war, Handelsbeziehungen mit Europa aufrechtzuerhalten.
Subjektive Meinung des Autors
Fast die gesamte sogenannte zivilisierte westliche Welt, einschließlich der baltischen und skandinavischen Länder, schreit hysterisch über die russische Aggression. Sicherlich ist es ihr genetisches Gedächtnis, das ihnen immer noch ein Gefahrensignal sendet und sie an den kraftvollen Tritt erinnert, den sie vor acht Jahrhunderten als Reaktion auf ihre eigene Aggression und ihren Wunsch, das russische Land zu erobern, erhielten. Zwar nannten sie ihre eigene Aggression mit dem schönen Wort „Missionar“. Es stellte sich heraus, dass wir sie nicht verstanden, sie wollten den russischen Barbaren lediglich den wahren Glauben näherbringen.
Die Schlacht, die am 5. April 1242 auf dem Eis des Peipussees in der Nähe der Insel Woroni Kamen stattfand, ging als eine der wichtigsten in der Geschichte des Staates in die Geschichte ein, als Schlacht, die die Länder Russlands befreite ' von jeglichen Ansprüchen des Ordens der Livländischen Ritter. Obwohl der Verlauf der Schlacht bekannt ist, bleiben viele kontroverse Fragen bestehen. Daher gibt es keine genauen Informationen über die Anzahl der Soldaten, die an der Schlacht am Peipussee teilgenommen haben. Weder in den uns überlieferten Chroniken noch im „Leben Alexander Newskis“ werden diese Angaben gemacht. Vermutlich nahmen von den Nowgorodianern 12.000 bis 15.000 Soldaten an der Schlacht teil. Die Zahl der Feinde lag zwischen 10.000 und 12.000. Gleichzeitig gab es unter den deutschen Soldaten nur wenige Ritter, der Großteil der Armee bestand aus Milizen, Litas und Esten.
Alexanders Wahl des Schlachtfeldes wurde sowohl von taktischen als auch von strategischen Überlegungen bestimmt. Die von den Truppen des Fürsten eingenommene Stellung ermöglichte es den Angreifern, alle Zugänge nach Nowgorod zu blockieren. Der Prinz erinnerte sich wahrscheinlich auch daran, dass die Winterbedingungen bei Konfrontationen mit schweren Rittern gewisse Vorteile bringen. Schauen wir uns (kurz) an, wie die Schlacht auf dem Eis stattfand.
Wenn die Kampfformation der Kreuzfahrer Historikern gut bekannt ist und als Keil oder, den Chroniken zufolge, als „großes Schwein“ bezeichnet wird (schwere Ritter befinden sich an den Flanken und leichter bewaffnete Krieger im Inneren des Keils), dann Über den Aufbau und Standort der Nowgorod-Armee liegen keine genauen Informationen vor. Es ist durchaus möglich, dass es sich hierbei um einen traditionellen „Regimentsstreit“ handelte. Die Ritter, die keine Informationen über die Anzahl und den Standort von Newskis Truppen hatten, beschlossen, auf offenem Eis vorzurücken.
Obwohl die Chroniken keine detaillierte Beschreibung der Schlacht am Peipussee enthalten, ist es durchaus möglich, das Schema der Eisschlacht zu rekonstruieren. Der Ritterkeil stürzte in die Mitte des Newski-Wachregiments, durchbrach dessen Verteidigung und stürmte weiter. Vielleicht hatte Prinz Alexander diesen „Erfolg“ im Voraus vorhergesehen, da die Angreifer damals auf viele unüberwindbare Hindernisse stießen. Der in einer Zange zusammengedrückte Ritterkeil verlor seine Ordnung und Manövrierfähigkeit, was sich für die Angreifer als schwerwiegender negativer Faktor herausstellte. Der Angriff des Hinterhaltregiments, das bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht an der Schlacht teilgenommen hatte, gab schließlich den Ausschlag zugunsten der Nowgoroder. Die Ritter stiegen in ihrer schweren Rüstung auf dem Eis von ihren Pferden und waren praktisch hilflos. Nur einem Teil der Angreifer gelang die Flucht, die die russischen Krieger dem Chronisten zufolge „bis zur Falkenküste“ verfolgten.
Nach dem Sieg des russischen Fürsten in der Eisschlacht am Peipsi-See war der Livländische Orden gezwungen, Frieden zu schließen und vollständig auf seine Ansprüche auf die Ländereien der Rus zu verzichten. Gemäß der Vereinbarung gaben beide Seiten die während der Schlacht gefangenen Soldaten zurück.
Es ist erwähnenswert, dass auf dem Eis des Peipsi-Sees zum ersten Mal in der Geschichte der Kriege eine Fußarmee die schwere Kavallerie besiegte, die im Mittelalter eine gewaltige Streitmacht war. Alexander Jaroslawitsch, der die Eisschlacht glänzend gewann, nutzte den Überraschungsfaktor maximal aus und berücksichtigte das Gelände.
Die militärpolitische Bedeutung von Alexanders Sieg kann kaum überschätzt werden. Der Fürst verteidigte nicht nur die Möglichkeit für die Nowgoroder, weiteren Handel mit europäischen Ländern zu betreiben und das Baltikum zu erreichen, sondern verteidigte auch den Nordwesten Russlands, denn im Falle einer Niederlage Nowgorods drohte die Eroberung des Ordens durch den Orden nordwestlich von Rus würde ziemlich real werden. Darüber hinaus verzögerte der Prinz den deutschen Angriff auf osteuropäische Gebiete. Der 5. April 1242 ist eines der wichtigsten Daten in der Geschichte Russlands.
Mythen über die Eisschlacht
Verschneite Landschaften, Tausende von Kriegern, ein zugefrorener See und Kreuzfahrer, die unter der Last ihrer eigenen Rüstung durch das Eis fallen.
Für viele unterscheidet sich die Schlacht, die den Chroniken zufolge am 5. April 1242 stattfand, kaum von den Aufnahmen aus Sergej Eisensteins Film „Alexander Newski“.
Aber war es wirklich so?
Der Mythos dessen, was wir über die Eisschlacht wissen
Die Eisschlacht wurde wirklich zu einem der bedeutsamsten Ereignisse des 13. Jahrhunderts, das sich nicht nur in „inländischen“, sondern auch in westlichen Chroniken widerspiegelte.
Und auf den ersten Blick scheint es, dass wir über genügend Dokumente verfügen, um alle „Komponenten“ der Schlacht gründlich zu studieren.
Doch bei näherer Betrachtung stellt sich heraus, dass die Popularität einer historischen Handlung keineswegs ein Garant für deren umfassende Erforschung ist.
So ist die detaillierteste (und am häufigsten zitierte) Beschreibung der Schlacht, die „unmittelbar auf den Fersen“ aufgezeichnet wurde, in der ersten Novgorod-Chronik der älteren Ausgabe enthalten. Und diese Beschreibung umfasst etwas mehr als 100 Wörter. Die restlichen Erwähnungen sind noch prägnanter.
Darüber hinaus enthalten sie manchmal sich gegenseitig ausschließende Informationen. Beispielsweise gibt es in der maßgeblichsten westlichen Quelle – der Elder Livonian Rhymed Chronicle – kein Wort darüber, dass die Schlacht auf dem See stattgefunden hat.
Die Biografien von Alexander Newski können als eine Art „Synthese“ der frühen Chronikhinweise auf den Zusammenstoß angesehen werden, sie sind Experten zufolge jedoch ein literarisches Werk und können daher nur mit „großen Einschränkungen“ als Quelle verwendet werden.
Was die historischen Werke des 19. Jahrhunderts betrifft, so wird angenommen, dass sie nichts grundlegend Neues für das Studium der Eisschlacht brachten, sondern hauptsächlich das nacherzählten, was bereits in den Chroniken gesagt wurde.
Der Beginn des 20. Jahrhunderts ist geprägt von einem ideologischen Umdenken der Schlacht, bei dem die symbolische Bedeutung des Sieges über die „deutsche ritterliche Aggression“ in den Vordergrund gerückt wurde. Laut dem Historiker Igor Danilevsky war das Studium der Eisschlacht vor der Veröffentlichung von Sergej Eisensteins Film „Alexander Newski“ nicht einmal in den Vorlesungen der Universitäten enthalten.
Der Mythos einer vereinten Rus
Für viele ist die Eisschlacht ein Sieg der vereinigten russischen Truppen über die Streitkräfte der deutschen Kreuzfahrer. Diese „verallgemeinernde“ Vorstellung der Schlacht entstand bereits im 20. Jahrhundert, in der Realität des Großen Vaterländischen Krieges, als Deutschland der Hauptrivale der UdSSR war.
Allerdings war die Eisschlacht vor 775 Jahren eher ein „lokaler“ als ein nationaler Konflikt. Im 13. Jahrhundert erlebte Russland eine Zeit der feudalen Zersplitterung und bestand aus etwa 20 unabhängigen Fürstentümern. Darüber hinaus könnte sich die Politik von Städten, die formal zum selben Territorium gehörten, erheblich unterscheiden.
Somit befanden sich Pskow und Nowgorod de jure im Nowgorod-Gebiet, einer der damals größten Territorialeinheiten der Rus. De facto war jede dieser Städte eine „Autonomie“ mit eigenen politischen und wirtschaftlichen Interessen. Dies galt auch für die Beziehungen zu seinen nächsten Nachbarn im östlichen Baltikum.
Einer dieser Nachbarn war der katholische Schwertorden, der nach der Niederlage in der Schlacht von Saul (Šiauliai) im Jahr 1236 als Livländischer Landmeister dem Deutschen Orden angegliedert wurde. Letzterer wurde Teil der sogenannten Livländischen Konföderation, zu der neben dem Orden fünf baltische Bistümer gehörten.
Wie der Historiker Igor Danilevsky feststellt, war die Hauptursache für Territorialkonflikte zwischen Nowgorod und dem Orden das Land der Esten, die am Westufer des Peipsi-Sees lebten (die mittelalterliche Bevölkerung des modernen Estland, die in den meisten russischsprachigen Chroniken unter dem Namen auftauchte). Namen „Chud“). Gleichzeitig hatten die von den Nowgorodianern organisierten Feldzüge praktisch keinen Einfluss auf die Interessen anderer Länder. Die Ausnahme bildete die „Grenze“ Pskow, die ständig Vergeltungsangriffen der Livländer ausgesetzt war.
Dem Historiker Alexej Walerow zufolge war es die Notwendigkeit, sich gleichzeitig sowohl den Kräften des Ordens als auch den regelmäßigen Versuchen Nowgorods, in die Unabhängigkeit der Stadt einzugreifen, zu widersetzen, die Pskow 1240 dazu zwingen konnte, den Livländern „die Tore zu öffnen“. Zudem war die Stadt nach der Niederlage bei Isborsk stark geschwächt und war vermutlich nicht in der Lage, den Kreuzfahrern langfristigen Widerstand zu leisten.
Gleichzeitig gab es, wie die Livländische Reimchronik berichtet, im Jahr 1242 kein vollwertiges „deutsches Heer“ in der Stadt, sondern nur zwei Vogt-Ritter (vermutlich begleitet von kleinen Abteilungen), die laut Valerov auftraten richterliche Funktionen auf kontrolliertem Land und überwachte die Aktivitäten der „lokalen Pskower Verwaltung“.
Wie wir aus den Chroniken wissen, „vertrieb“ der Nowgoroder Fürst Alexander Jaroslawitsch zusammen mit seinem jüngeren Bruder Andrei Jaroslawitsch (gesandt von ihrem Vater, dem Wladimir-Fürsten Jaroslaw Wsewolodowitsch) die Deutschen aus Pskow, woraufhin sie ihren Feldzug fortsetzten. „zum Chud“ gehen (d. h. in die Länder des livländischen Landmeisters).
Dort trafen sie auf die vereinten Kräfte des Ordens und des Bischofs von Dorpat.
Der Mythos vom Ausmaß der Schlacht
Dank der Novgorod-Chronik wissen wir, dass der 5. April 1242 ein Samstag war. Alles andere ist nicht so klar.
Schwierigkeiten beginnen bereits beim Versuch, die Anzahl der Teilnehmer an der Schlacht zu bestimmen. Über die Verluste in den Reihen der Deutschen sagen uns nur die uns vorliegenden Zahlen. So berichtet die Novgorod First Chronicle von etwa 400 Toten und 50 Gefangenen, die Livonian Rhymed Chronicle berichtet, dass „zwanzig Brüder getötet und sechs gefangen genommen wurden“.
Forscher glauben, dass diese Daten nicht so widersprüchlich sind, wie sie auf den ersten Blick scheinen.
Die Historiker Igor Danilevsky und Klim Zhukov sind sich einig, dass mehrere hundert Menschen an der Schlacht teilgenommen haben.
Auf deutscher Seite handelt es sich also um 35–40 Ritterbrüder, etwa 160 Knechts (durchschnittlich vier Diener pro Ritter) und Söldner-Ests („Chud ohne Zahl“), die die Abteilung um weitere 100 „erweitern“ könnten. 200 Krieger. Darüber hinaus galt eine solche Armee nach den Maßstäben des 13. Jahrhunderts als ziemlich ernstzunehmende Streitmacht (vermutlich überschritt die Höchstzahl des ehemaligen Ordens der Schwertkämpfer in seiner Blütezeit grundsätzlich nicht 100–120 Ritter). Der Autor der Livonian Rhymed Chronicle beklagte sich auch darüber, dass es fast 60-mal mehr Russen gab, was laut Danilevsky zwar übertrieben ist, aber immer noch Anlass zu der Annahme gibt, dass Alexanders Armee den Streitkräften der Kreuzfahrer deutlich überlegen war.
So überstieg die maximale Zahl des Stadtregiments Nowgorod, der fürstlichen Truppe Alexanders, der Susdal-Abteilung seines Bruders Andrei und der Pskowiter, die sich dem Feldzug anschlossen, kaum 800 Personen.
Aus Chronikberichten wissen wir auch, dass die deutsche Abteilung als „Schwein“ aufgestellt war.
Laut Klim Schukow handelt es sich höchstwahrscheinlich nicht um ein „trapezförmiges“ Schwein, das wir in Diagrammen in Lehrbüchern gewohnt sind, sondern um ein „rechteckiges“ Schwein (da die erste Beschreibung eines „Trapezes“ in schriftlichen Quellen erschien). erst im 15. Jahrhundert). Historikern zufolge gibt auch die geschätzte Größe der livländischen Armee Anlass, über die traditionelle Bildung des „Hundbanners“ zu sprechen: 35 Ritter, die den „Bannerkeil“ bilden, plus ihre Abteilungen (insgesamt bis zu 400 Personen).
Was die Taktik der russischen Armee betrifft, erwähnt die Rhymed Chronicle lediglich, dass „die Russen viele Schützen hatten“ (die offenbar die erste Formation bildeten) und dass „die Armee der Brüder umzingelt war“.
Mehr wissen wir darüber nicht.
Der Mythos, dass der livländische Krieger schwerer ist als der Nowgoroder
Es gibt auch ein Stereotyp, nach dem die Kampfkleidung russischer Soldaten um ein Vielfaches leichter war als die livländischer.
Wenn es einen Gewichtsunterschied gab, war dieser laut Historikern äußerst unbedeutend.
Schließlich nahmen auf beiden Seiten ausschließlich schwer bewaffnete Reiter an der Schlacht teil (man geht davon aus, dass alle Annahmen über Infanteristen eine Übertragung der militärischen Realitäten der folgenden Jahrhunderte auf die Realitäten des 13. Jahrhunderts darstellen).
Logischerweise würde sogar das Gewicht eines Kriegspferdes, ohne Berücksichtigung des Reiters, ausreichen, um das empfindliche Aprileis zu durchbrechen.
War es unter solchen Bedingungen sinnvoll, die Truppen gegen ihn abzuziehen?
Der Mythos der Schlacht auf dem Eis und der ertrunkenen Ritter
Lassen Sie sich gleich enttäuschen: In keiner der frühen Chroniken wird beschrieben, wie deutsche Ritter durch das Eis fallen.
Darüber hinaus gibt es in der Livländischen Chronik einen ziemlich seltsamen Satz: „Auf beiden Seiten fielen die Toten ins Gras.“ Einige Kommentatoren glauben, dass dies eine Redewendung ist, die „auf das Schlachtfeld fallen“ bedeutet (Version des mittelalterlichen Historikers Igor Kleinenberg), andere – dass es sich um Schilfdickichte handelt, die unter dem Eis in den flachen Gewässern hervorkamen, in denen die Die Schlacht fand statt (Version des sowjetischen Militärhistorikers Georgy Karaev, abgebildet auf der Karte).
Was die Chronikhinweise auf die Tatsache betrifft, dass die Deutschen „über das Eis“ getrieben wurden, sind sich moderne Forscher einig, dass dieses Detail von der Eisschlacht aus der Beschreibung der späteren Schlacht von Rakovor (1268) „entlehnt“ worden sein könnte. Laut Igor Danilevsky sind Berichte, dass russische Truppen den Feind sieben Meilen („bis zum Subolichi-Ufer“) vertrieben haben, angesichts des Ausmaßes der Rakovor-Schlacht durchaus gerechtfertigt, sehen aber im Kontext der Schlacht am Peipussee, wo die Entfernung liegt, seltsam aus Von Ufer zu Ufer am vermeintlichen Ort der Schlacht beträgt die Distanz nicht mehr als 2 km.
In Bezug auf den „Rabenstein“ (ein geografisches Wahrzeichen, das in Teilen der Chroniken erwähnt wird) betonen Historiker, dass jede Karte, die einen bestimmten Ort der Schlacht anzeigt, nichts weiter als eine Version ist. Niemand weiß genau, wo das Massaker stattgefunden hat: Die Quellen enthalten zu wenig Informationen, um Rückschlüsse zu ziehen.
Klim Schukow stützt sich insbesondere auf die Tatsache, dass bei archäologischen Expeditionen im Gebiet des Peipsi-Sees keine einzige „bestätigende“ Bestattung entdeckt wurde. Den Mangel an Beweisen führt der Forscher nicht auf den mythischen Charakter der Schlacht, sondern auf Plünderungen zurück: Im 13. Jahrhundert hatte Eisen einen sehr hohen Stellenwert, und es ist unwahrscheinlich, dass die Waffen und Rüstungen der gefallenen Soldaten bis dahin unversehrt geblieben sein könnten Tag.
Der Mythos von der geopolitischen Bedeutung der Schlacht
In den Augen vieler ist die Schlacht auf dem Eis „einzigartig“ und vielleicht die einzige „aktionsreiche“ Schlacht ihrer Zeit. Und es wurde wirklich zu einer der bedeutendsten Schlachten des Mittelalters, die den Konflikt zwischen Russland und dem Livländischen Orden fast zehn Jahre lang „auf Eis legte“.
Dennoch war das 13. Jahrhundert reich an anderen Ereignissen.
Aus der Sicht des Zusammenstoßes mit den Kreuzfahrern sind dies die Schlacht mit den Schweden an der Newa im Jahr 1240 und die bereits erwähnte Schlacht von Rakovor, in der die vereinte Armee von sieben nordrussischen Fürstentümern gegen den Livländischen Landherrn und den Livländischen Landherrn antrat Dänisches Estland.
Außerdem ist das 13. Jahrhundert die Zeit der Invasion der Horde.
Obwohl die Schlüsselschlachten dieser Ära (die Schlacht von Kalka und die Einnahme von Rjasan) den Nordwesten nicht direkt betrafen, beeinflussten sie die weitere politische Struktur der mittelalterlichen Rus und aller ihrer Komponenten erheblich.
Wenn wir außerdem das Ausmaß der Bedrohung durch die Germanen und die Horde vergleichen, wird der Unterschied in Zehntausenden von Soldaten berechnet. So überstieg die maximale Zahl der Kreuzfahrer, die jemals an Feldzügen gegen Russland teilnahmen, selten 1000 Menschen, während die geschätzte maximale Zahl der Teilnehmer am russischen Feldzug seitens der Horde bis zu 40.000 betrug (Version des Historikers Klim Schukow).
TASS dankt dem Historiker und Spezialisten für das antike Russland Igor Nikolajewitsch Danilewski und dem Militärhistoriker und Mediävisten Klim Alexandrowitsch Schukow für die Unterstützung bei der Vorbereitung des Materials.
© TASS INFOGRAPHICS, 2017
Am Material gearbeitet:
Er besiegte die Armee des Livländischen Ordens. Im Gegensatz zu den lakonischen und zurückhaltenden deutschen Chroniken werden in russischen Chroniken die Ereignisse am Peipussee in epischem Ausmaß beschrieben. „Und ich stieß auf das Regiment von Nemtsi und Chud und zerschmetterte das Regiment mit einem Schwein, und es gab ein großes Gemetzel an Nemtsi und Chud“, heißt es in „Das Leben von Alexander Newski“. Die Eisschlacht ist unter Historikern seit langem Gegenstand kontroverser Debatten. In der Diskussion ging es um den genauen Ort der Schlacht und die Anzahl der Teilnehmer.
Chronik der legendären Schlacht, die die Deutschen zwang, ihre Expansion nach Osten zu stoppen:
Im August 1240 begann der Livländische Orden einen Feldzug gegen Rus. Die Ritter eroberten Isborsk, Pskow und die Küste des Finnischen Meerbusens. Im Jahr 1241 stellte der Fürst von Nowgorod, Alexander Newski, eine Armee zusammen. Krieger aus Susdal und Wladimir kommen, um ihm zu helfen. Alexander erobert Pskow und Isborsk zurück, die livländischen Ritter ziehen sich zum Peipussee zurück.
Die meisten feindlichen Streitkräfte waren Esten – in russischsprachigen Quellen „chjud“. Die überwiegende Mehrheit der Esten waren keine professionellen Krieger und schlecht bewaffnet. Zahlenmäßig übertrafen die Abteilungen der versklavten Völker die deutschen Ritter deutlich.
Die Schlacht am Peipussee begann mit dem Einsatz russischer Schützen. Vor ihm platzierte Newski ein Regiment leichter Kavallerie, Bogenschützen und Schleuderer. Die Hauptkräfte waren auf die Flanken konzentriert. Der fürstliche Kavallerietrupp lag hinter der linken Flanke im Hinterhalt.
Die deutsche Kavallerie durchbrach die feindliche Formation. Die Russen griffen es von beiden Flanken an, was andere Einheiten des Ordens zum Rückzug zwang. Die Truppe von Alexander Newski schlug von hinten zu. Die Schlacht zerfiel in einzelne Gebiete. „Und Nemtsi fiel hin, und Chud ließ Spritzer fallen; und schlug sie als Verfolger sieben Werst entlang des Eises bis zur Küste von Subolich“, heißt es in der ersten Novgorod-Chronik der älteren Ausgabe.
So verfolgte die russische Armee den Feind über 7 Werst (mehr als 7 Kilometer) über das Eis. In späteren Quellen tauchten Informationen auf, dass die Deutschen unter das Eis gegangen seien, doch Historiker streiten immer noch über ihre Zuverlässigkeit.
Die Erste Novgorod-Chronik, die Susdal- und Laurentian-Chronik sowie „Das Leben von Alexander Newski“ erzählen von der Eisschlacht. Lange Zeit diskutierten Forscher über den genauen Ort der Schlacht; In den Chroniken wird erwähnt, dass die Truppen am Ufer des Peipussees am Krähenstein und am Uzmen-Trakt zusammenkamen.
Die Zahl der Kriegsparteien ist unbekannt. Zu Sowjetzeiten gab es folgende Zahlen: bis zu 12.000 Soldaten des Livländischen Ordens und bis zu 17.000 Menschen für Alexander Newski. Andere Quellen geben an, dass bis zu 5.000 Menschen auf russischer Seite kämpften. In der Schlacht wurden etwa 450 Ritter getötet.
Der Sieg am Peipussee verzögerte die deutsche Offensive lange und war für Nowgorod und Pskow, die unter westlichen Invasoren litten, von großer Bedeutung. Der Livländische Orden war gezwungen, Frieden zu schließen und seine Gebietsansprüche aufzugeben.