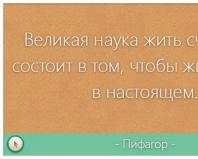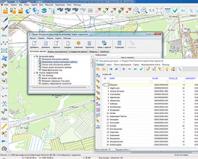Belastungsarten von Gebäuden. Belastungen und Einwirkungen auf das Gebäude. Strukturmechanik. Anforderungen an die Gestaltung von Treppen
Während der Errichtung und des Betriebs erfährt das Gebäude unterschiedliche Belastungen. Äußere Einflüsse kann in zwei Typen unterteilt werden: Leistung Und Nicht-Zwang oder Umwelteinflüsse.
ZU kraftvoll Die Auswirkungen umfassen verschiedene Arten von Belastungen:
dauerhaft– aus dem Eigengewicht (Masse) der Bauelemente, dem Bodendruck auf die unterirdischen Elemente;
vorübergehend (langfristig)– aus dem Gewicht stationärer Ausrüstung, langfristig gelagerter Ladung, dem Eigengewicht dauerhafter Bauelemente (z. B. Trennwände);
kurzfristig– aus dem Gewicht (der Masse) beweglicher Geräte (z. B. Kräne in Industriegebäuden), Personen, Möbeln, Schnee, aus Windeinwirkung;
besonders– durch seismische Einwirkungen, Einwirkungen infolge von Geräteausfällen usw.
ZU nicht gewaltsam betreffen:
Temperatur Auswirkungen, was zu Veränderungen der linearen Abmessungen von Materialien und Strukturen führt, was wiederum zum Auftreten von Krafteinwirkungen führt und auch die thermischen Bedingungen des Raums beeinflusst;
Exposition gegenüber Luft- und Bodenfeuchtigkeit, und auch dampfförmige Feuchtigkeit, in der Atmosphäre und der Innenluft enthalten sind und eine Veränderung der Eigenschaften der Materialien verursachen, aus denen die Gebäudestrukturen bestehen;
Luftbewegung verursacht nicht nur Belastungen (durch Wind), sondern dringt auch in die Struktur und Räumlichkeiten ein und verändert deren Luftfeuchtigkeit und thermische Bedingungen;
Exposition gegenüber Strahlungsenergie Sonne (Sonnenstrahlung), die durch lokale Erwärmung eine Veränderung der physikalischen und technischen Eigenschaften der Oberflächenschichten von Materialien, Bauwerken, Veränderungen der Licht- und Wärmebedingungen der Räumlichkeiten verursacht;
Exposition gegenüber aggressiven chemischen Verunreinigungen in der Luft enthalten, was in Gegenwart von Feuchtigkeit zur Zerstörung des Materials von Bauwerken führen kann (Korrosionsphänomen);
biologische Wirkungen verursacht durch Mikroorganismen oder Insekten, die zur Zerstörung von Bauwerken aus organischen Baustoffen führen;
Exposition gegenüber Schallenergie(Lärm) und Vibrationen von Quellen innerhalb oder außerhalb des Gebäudes.
Wo der Aufwand betrieben wird Ladungen sind geteilt in konzentriert(z. B. Gewicht der Ausrüstung) und gleichtgemessenverteilt(Eigengewicht, Schnee).
Abhängig von der Art der Belastung kann dies der Fall sein statisch, d.h. über die Zeit in ihrer Größe konstant und dynamisch(Schlagzeug).
In Richtung - horizontal (Winddruck) und vertikal (Eigengewicht).
Das. Auf ein Gebäude wirken unterschiedliche Belastungen hinsichtlich Größe, Richtung, Art der Einwirkung und Einsatzort ein.
Reis. 2.3. Belastungen und Einwirkungen auf das Gebäude.
Es kann zu einer Kombination von Lasten kommen, bei denen alle in die gleiche Richtung wirken und sich gegenseitig verstärken. Es sind diese ungünstigen Lastkombinationen, denen Baukonstruktionen standhalten sollen. Die Standardwerte aller auf das Gebäude einwirkenden Kräfte werden in DBN oder SNiP angegeben.
Es ist zu bedenken, dass die Auswirkungen auf Bauwerke ab dem Zeitpunkt ihrer Herstellung beginnen und während des Transports, während des Baus des Gebäudes und seines Betriebs anhalten.
Bei der Planung muss alles berücksichtigt werden, was das Gebäude aushalten muss, um seine Leistungs- und Festigkeitseigenschaften nicht zu verlieren. Unter Lasten versteht man äußere mechanische Kräfte, die auf ein Gebäude einwirken, Stöße sind innere Phänomene. Zur Klärung der Sachlage klassifizieren wir alle Belastungen und Einwirkungen nach folgenden Kriterien.
Nach Wirkungsdauer:
- konstant – das Eigengewicht der Struktur, die Masse und der Druck des Bodens in Böschungen oder Aufschüttungen;
- langfristig – das Gewicht von Geräten, Trennwänden, Möbeln, Personen, Schneelast, dazu gehören auch Einwirkungen durch Schrumpfen und Kriechen von Baumaterialien;
- kurzfristig - Temperatur-, Wind- und Eisklimaeinflüsse sowie solche, die mit Änderungen der Luftfeuchtigkeit und Sonneneinstrahlung verbunden sind;
- speziell - standardisierte Belastungen und Stöße (z. B. Erdbeben, Feuer usw.).
Unter Designern gibt es auch den Begriff Nutzlast, dessen Bedeutung nicht in Regulierungsdokumenten festgelegt ist, der Begriff jedoch in der Baupraxis existiert. Unter Nutzlast verstehen wir die Summe einiger temporärer Lasten, die in einem Gebäude immer vorhanden sind: Personen, Möbel, Ausrüstung. Für ein Wohngebäude beträgt sie beispielsweise 150...200 kg/m2 (1,5...2 MPa) und für ein Bürogebäude 300...600 kg/m2 (3...6 MPa).
Aufgrund der Art der Arbeit:
- statisch – Eigengewicht der Struktur, Schneedecke, Ausrüstung;
- dynamisch - Vibration, Windstoß.
Je nach Ort der Anstrengung:
- konzentriert - Ausrüstung, Möbel;
- gleichmäßig verteilt - die Masse der Struktur, die Schneedecke.
Aufgrund der Art der Auswirkungen:
- Kraftbelastungen (mechanisch) sind Belastungen, die Reaktionskräfte verursachen; alle oben genannten Beispiele gelten für diese Lasten;
- Einwirkungen ohne Gewalteinwirkung:
- Änderungen der Außenlufttemperaturen, die zu linearen Temperaturverformungen von Gebäudestrukturen führen;
- dampfförmige Feuchtigkeitsströme aus Räumlichkeiten – wirken sich auf das Material von Außenzäunen aus;
- Luft- und Bodenfeuchtigkeit, chemisch aggressive Umwelteinflüsse;
- Sonnenstrahlung;
- elektromagnetische Strahlung, Lärm usw., die die menschliche Gesundheit beeinträchtigen.
Alle Leistungslasten werden in die technischen Berechnungen einbezogen. Auch der Einfluss nicht gewaltsamer Einwirkungen muss bei der Konstruktion unbedingt berücksichtigt werden. Sehen wir uns zum Beispiel an, wie die Temperatur die Struktur beeinflusst. Tatsache ist, dass die Struktur unter Temperatureinfluss dazu neigt, zu schrumpfen oder sich auszudehnen, d.h. Größenänderung. Dies wird durch andere Strukturen verhindert, mit denen diese Struktur verbunden ist. Dadurch entstehen an den Stellen, an denen Strukturen interagieren, reaktive Kräfte, die aufgenommen werden müssen. Auch bei langen Gebäuden ist es notwendig, Lücken vorzusehen.
Auch andere Einflüsse unterliegen Berechnungen: Berechnungen zur Dampfdurchlässigkeit, wärmetechnische Berechnungen usw.
Sektionale Wohngebäude
Korridor-Wohngebäude. In Flurwohnhäusern liegen die Wohnungen auf beiden Seiten des Flurs. Solche Häuser können Wohnungen für den dauerhaften Aufenthalt sowie Herbergen und Hotels für den vorübergehenden Aufenthalt sein. In Korridorhäusern handelt es sich bei der vertikalen Kommunikation um Treppen (für Häuser mit einer Höhe von bis zu 5 Stockwerken) und Treppen mit Aufzügen für Häuser mit einer Höhe von 6 Stockwerken und mehr. Die Korridoranordnung ermöglicht eine sparsamere Nutzung der vertikalen Kommunikation und sorgt so für eine Erhöhung der Anzahl der Wohnungen pro Treppenhaus und Aufzug, was insbesondere bei Hochhäusern deutlich wird. Korridorwohngebäude haben in der Regel eine Meridianausrichtung, wodurch die Anforderungen an die Sonneneinstrahlung erfüllt werden können. Korridore in solchen Häusern müssen über ausreichende Breite, Beleuchtung und Belüftung verfügen. Durch Fensteröffnungen werden die Flure einseitig (bei einer Flurlänge bis 24 m) und zweiseitig (bei einer Länge bis 48 m) beleuchtet. Bei größeren Längen werden Lichthallen in einem Abstand von maximal 24 m zueinander angeordnet.
Galerie-Wohngebäude Im Grundriss unterscheiden sie sich von den Fluren dadurch, dass die Eingänge zu den Wohnungen in solchen Häusern aus geschossweise offenen Fluren-Galerien angeordnet sind, die über die Außenkante einer der Längswände hinausgehen. Wohnungen in Galeriegebäuden liegen auf einer Seite der Galerie und verfügen dementsprechend über eine Querlüftung. Es empfiehlt sich, diesen Haustyp dort zu bauen, wo Wohnräume vor Überhitzung geschützt werden müssen. An die Galerien grenzen Wohnungen in Galeriegebäuden mit ihren Wirtschaftsräumen an. Der vertikale Verkehrsknotenpunkt in Galeriegebäuden grenzt entweder an den Enden oder im mittleren Teil an die Galerien und liegt häufig außerhalb der Abmessungen des Wohngebäudes. Bei mehrgeschossigen Galeriebauten müssen mindestens zwei vertikale Transporteinheiten in Form von Fluchttreppen vorhanden sein.
3. Raumplanerische Lösungen für Wohnungen, Treppenhäuser und Aufzüge, Eingangsknoten
Die Anordnung von Räumlichkeiten einer bestimmten Größe und Form in einem Gebäude oder Gebäudekomplex unter Berücksichtigung funktionaler, technischer, architektonischer, künstlerischer und wirtschaftlicher Anforderungen wird als volumetrische Planungslösung des Gebäudes oder Gebäudekomplexes bezeichnet.
Die Räumlichkeiten im Gebäude werden je nach ihrer Rolle bei der Durchführung des Hauptfunktionsprozesses unterteilt in:
Die Haupträume, die die Hauptfunktionen des Gebäudes erfüllen sollen;
Versorgungsräume (Hilfsräume), die dazu bestimmt sind, Hilfsfunktionen auszuführen, die zur Erfüllung der Hauptfunktion beitragen;
Kommunikationsräume, die Verbindungen zwischen Räumen herstellen. Die Kommunikation kann horizontal (Korridore, Galerien, Durchgänge, Foyers, Korridore) und vertikal (Treppen, Aufzüge, Rolltreppen, Rampen) erfolgen.
Anforderungen an Außenwandplatten und deren Verbindungen. Allgemeine Informationen zu den Kraftwirkungen horizontaler und vertikaler Fugen von Paneelaußenwänden
Jedes Design muss die Anforderungen erfüllen:
Stärke,
Haltbarkeit,
Minimale Verformbarkeit,
Wärmedämmung,
Wechselwirkungen mit inneren tragenden Strukturen des Gebäudes
Architektonische und dekorative Eigenschaften
Die Verbindungen zwischen den Außenschichten der Wände werden starr oder flexibel ausgeführt.
Festigkeitsanforderungen werden durch den Einsatz von Materialien mit hoher Druckfestigkeit für die Innenschichten von Bauwerken erfüllt. Anforderung an die Haltbarkeit und Rissbeständigkeit der Außenschicht, die durch die Verwendung hochwertiger Wandmaterialklassen oder Qualitäten in Bezug auf die Druckfestigkeit (siehe oben) erfüllt wird, ihre Einhaltung der Anforderungen an die Wandmaterialqualität in Bezug auf die Frostbeständigkeit für jede Klimaregion Nachhaltigkeit. Die Verbindung von Außen- und Innenwänden wird bei Ziegelwänden durch die Verankerung des Mauerwerks der Wände, bei Betonplattenwänden durch diskrete Schlüsselverbindungen aus Beton gewährleistet
Möglichkeiten zur Anordnung horizontaler Fugen von Innenwandpaneelen. Allgemeine Informationen zu Kraftwirkungen an diesen Gelenken
Plattform
Kontakt;
Kontakt - Plattform;
Monolithische Plattform
a - Plattform; b – Kontakt; c – Kontakt – Plattform; g - monolithisch
Gewährleistung der Isoliereigenschaften von Paneelwänden. Anforderungen an den Wärmeschutz, die Feuchtigkeitsdichtheit und die Luftdichtheit der Anschlüsse von Außenwänden aus Paneelen. Offene und geschlossene entwässerte Fugen. Umfang ihrer Anwendung
Das Wichtigste und Schwierigste beim Bau eines Großtafelgebäudes sind die Fugen zwischen den Tafeln. Es gibt viele verschiedene Lösungen, aber keine davon erfüllt alle Anforderungen an Verbindungen: Festigkeit (starre Verbindung der Wandpaneele untereinander und mit der Decke), Haltbarkeit und Dichtheit, Wärme- und Schalldämmung, Einfachheit des Designs und künstlerische Ausdruckskraft. Strukturelle Lösungen für Fugen können nach folgenden Kriterien klassifiziert werden: nach der Gestaltung der Außenzone (offen, mit wasserdichtem Klebeband und geschlossen, geschützt mit Zementmörtel und Dichtungsmastix); je nach Art der Abdichtung (isoliert, mit wirksamer Isolierung und einbetoniert); nach der Art der Verbindung (geschweißt, gelenkig, verschraubt, selbstklemmend oder verkeilt). Konstruktionslösungen für Verbindungen können nach folgenden Kriterien klassifiziert werden:
Je nach Verbindungsart (geschweißt, geschlungen, verschraubt, selbstklemmend oder verkeilt)
Je nach Art der Abdichtung (gedämmt, mit wirksamer Dämmung und Einbettung in monolithischen Beton),
Es werden geschlossene, entwässerte und offene Fugen verwendet.
Je nach Gestaltung der Außenzone (oder entlang der Kanten der Zuschnittplatten)
Offen und geschlossen
Als Variante einer geschlossenen Fuge wird eine entwässerte Fuge verwendet, die mit Zementmörtel und Dichtungsmastix geschützt wird.
Die Wahl des Typs wird durch die Gestaltung der Außenwandpaneele und die klimatische Zoneneinteilung des Landes entsprechend der voraussichtlichen Wintertemperatur und windgetriebenen Regenfälle bestimmt. Die richtige Wahl der Fugenart begünstigt die Austrocknung der Außenwände während des Gebäudebetriebs. Die isolierenden Eigenschaften der Fugen werden durch ihren labyrinthischen Querschnitt und die elastische Abdichtung der Außennähte gewährleistet, wodurch die Öffnungsneigung im Winter ausgeglichen wird. Die Kondensation wird durch den Trocknungsmodus der Wand, unterstützt durch die natürliche Belüftung durch die Poren der Baustoffe und durch den Abtransport von über die Dämmzone eingedrungener Feuchtigkeit verhindert. Das Kondensat fließt durch Dekompressionskanäle in den Seitenkanten der Paneele und wird dann durch Entwässerungslöcher in entwässerten Fugen oder durch offene Mündungen in offenen Fugen aus der Wand abgeleitet.

21. Fußböden von Gebäuden aus großformatigen Elementen. Zweck, Anforderungen an sie, Einteilung nach Standort und Bautechnik

Klassifizierung von Dächern nach Material, nach Bauweise, nach dem Vorhandensein von Raum zwischen dem Dach und den Räumlichkeiten des Gebäudes, nach der Größe der Dachneigung, nach thermischen Eigenschaften, nach Dachtyp, nach Organisation der Entwässerung aus dem Gebäude
Das Dach ist ein dauerhafter Teil des Gebäudes, verbunden mit tragenden Strukturen, die sich oben befinden und den Innenraum vor dem Eindringen von Niederschlag schützen.
Das Dach muss stark und stabil sein und wasser- und wärmeisolierende Eigenschaften haben. Beim Bau sind Brandschutznormen zu berücksichtigen. Darüber hinaus ist das Dach eine Dekoration des Hauses; es kann sein Aussehen komplett verändern – ihm einen modernen oder antiken Stil verleihen, es optisch höher und luftiger oder umgekehrt zuverlässig und stabil machen.
Klassifizierung nach Bauweise
Es gibt zwei Arten von Dächern: Dachgeschoss und kombinierte Dächer.
Ein Dachgeschoss ist eine Konstruktion, die aus einem Außendach und Gebäudebindern besteht, die es tragen. Die Balken sind in der Regel mit einer Beplankung oder einem Belag abgedeckt. Die Dachneigung kann unterschiedlich sein; sie hängt von zwei Bedingungen ab: dem für das Dach verwendeten Material und dem Klima des Naturgebiets, in dem das Haus gebaut wird.
Bei großen Niederschlagsmengen sollte die Dachneigung in einem Winkel von 45° oder mehr ausgeführt werden, bei trockenem Wetter und starkem Wind sollte die Neigung 30° nicht überschreiten. Bei der Verwendung von Stückmaterialien für das Dach darf der Winkel nicht weniger als 22° betragen. Für Rollenmaterialien beträgt der optimale Winkel 5 bis 25° und für Asbestzementplatten und -fliesen 25–35° oder mehr. Mit zunehmender Dachneigung steigen der Materialverbrauch und die Gesamtkosten.
Ein Kombidach ist ein spezieller Bodenbelag, der Abdichtungsfunktionen übernimmt, auf dem Dachboden verlegt wird und praktisch kein Gefälle aufweist. Das Material dafür sind mehrere Schichten Dachmaterial, die mit Bitumenmastix beschichtet sind. Die Flüssigkeit wird durch interne Abflüsse abgeleitet.
Klassifizierung nach Wärmedämmniveau
Dächer können warm oder kalt sein. Das Vorhandensein eines Dachbodens in einer Struktur definiert sie als warm, da ihre Struktur aufgrund des Luftraums, der von der Dachfläche, den Außenwänden und der Decke des Obergeschosses gebildet wird, für Wärmedämmung sorgt. Es schützt das Gebäude vor Kälte, sorgt für Belüftung und Feuchtigkeitsaustausch verschiedener Bauelemente. Außerdem erhöht sein Gerät die Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Hauses erheblich, allerdings steigen die Gesamtbaukosten, da der Dachboden nicht in die Anzahl der Wohnräume eingerechnet wird.
In diesem Fall können Sie einen Dachboden organisieren, bei dem es sich um ein Wohnzimmer direkt unter dem Dach handelt und dessen Wände die Seitenflächen des Daches sind. Der Abstand von der Krone bis zum Boden des Dachzimmers muss mindestens 1,5 m betragen. Somit wird der gesamte Innenraum für die Unterbringung genutzt.
Kaltdächer ohne Dachboden werden in der Regel über unbeheizten Gebäuden, Scheunen und anderen Nebengebäuden errichtet. Zu ihren Funktionen gehört lediglich der direkte Schutz vor Niederschlag.
Klassifizierung nach Form
Dächer können einteilig, giebelig, gebrochen, walmförmig, walmförmig und kreuzförmig sein. Eine Schräge ist eine am Hang liegende Dachebene. Sie kreuzen sich und bilden den Dachfirst. Der Winkel, den die Dach- und Giebelschrägen bilden, wird Kehle genannt.
Sheddächer sind Dächer, die eine geneigte Fläche haben. Sie ruhen auf zwei unterschiedlich hohen Wänden. Der Hang ist meist zur Luvseite ausgerichtet, um das Haus vor Regen und Schnee zu schützen. Darüber hinaus ermöglichen Sheddächer eine maximale Nutzung des Innenraums des Gebäudes.
Satteldächer sind eine klassische Option für kleine Ferienhäuser. Das Dach wird durch zwei gegenläufige Schrägen gebildet.
Beim Bau eines Hauses mit Dachboden entstehen kaputte Dächer. Es sind nicht zwei, sondern vier Hänge, die in einem stumpfen Winkel verbunden sind. Diese Dachart wird häufig im Einzelbau eingesetzt.
Ein Walmdach ist ein Walmdach mit dreieckigen Schrägen an den Stirnseiten.
Walmdächer sind Dächer mit vier Schrägen in Form identischer Dreiecke, die in einem Punkt zusammenlaufen.
Kraftbelastungen und Stöße auf Dächer. Anforderungen an die Dachkonstruktion. Schichten, aus denen das Dach besteht, und ihr Zweck

Reis. 1. Äußere Einflüsse auf die Beschichtung
1-konstante Belastungen (Eigengewicht); 2 - vorübergehende Belastungen (Schnee, betriebliche Belastungen); 3 - Wind - Druck; 4 - Windsog; 5, 9 - Einfluss der Umgebungstemperaturen; 6 – Luftfeuchtigkeit (Niederschlag, Luftfeuchtigkeit); 7 – chemisch aggressive Stoffe in der Luft; 8 - Sonneneinstrahlung; 10 - Feuchtigkeit in der Luft des Dachbodenraums
Strukturelemente von vorgefertigten Stahlbetondächern im Dachgeschoss. Ihre Klassifizierung erfolgt nach der Art der Luftabführung aus der Abluftanlage durch die Dachkonstruktion, je nach Art und Art der Abdichtung des Dachbodenbelags
Dächer aus vorgefertigten Stahlbetonplatten können ungenutzt und genutzt werden, ohne Dachboden und Dachboden. Es gibt sechs Arten von vorgefertigten Stahlbetondächern: 1 – Dachgeschossdächer mit Abdichtung durch Mastix oder Anstrichmassen (Rolldacheindeckung) (Abb. 14, c, d), 2 – Dachgeschossdächer mit Dacheindeckung aus Rollenmaterialien; 3 - dachlos aus einschichtigen Platten aus Leicht- oder Porenbeton; 4 - dachlos aus mehrschichtigen komplexen Platten, bestehend aus zwei Stahlbetonplatten, zwischen denen ein wirksames Wärmedämmmaterial verlegt ist; 5 - dachlos mit tragenden Platten aus schwerem Beton, auf denen Platten aus wirksamen Dämmstoffen verlegt sind; 6 - Nicht-Dachgeschoss-Konstruktionsentwurf eines mehrschichtigen Aufbaus mit Hinterfüllungsdämmung und einem Dachestrich aus Rollenmaterialien.
Organisation der Entwässerung vom Dach. Möglichkeiten zur Erstellung einer Dachschräge für Flachdächer

34. Benutzbare Dachterrassen
Bedienbares Dach Es wird sowohl über Dachbodenbelägen als auch über Nicht-Dachbodenbelägen installiert. Es kann im gesamten Gebäude oder in Teilen davon installiert werden. In modernen mehrstöckigen Wohngebäuden wird das Dach häufig als Plattform für Erholungs- und andere Zwecke genutzt. In diesem Fall wird das genutzte Dach als Dachterrasse bezeichnet. Der Boden von Terrassendächern ist eben oder mit einem Gefälle von höchstens 1,5 % und die darunter liegende Dachfläche mit einem Gefälle von mindestens 3 % auszuführen. Für die Dacheindeckung werden die haltbarsten Materialien verwendet (z. B. Abdichtung). Es wird davon ausgegangen, dass die Anzahl der Lagen gerollter Teppiche um eins höher ist als bei einem ungenutzten Dach. Auf die Oberfläche des Teppichs wird eine Schicht heißen, mit Herbiziden antiseptischen Mastix aufgetragen. Sie schützen den Teppich vor dem Keimen von Pflanzenwurzeln aus Samen und Sporen, die der Wind auf das Dach weht.
Der Dachaufbau von Terrassendächern erfolgt ähnlich wie bei herkömmlichen Rolldächern, jedoch werden darüber zusätzliche Schichten aufgelegt, die als Boden dienen. Der Boden besteht horizontal aus einzelnen Platten, die auf einer Schicht Kies oder grobem Sand liegen. Die Platten können aus Stahlbeton, Naturstein oder Keramik sein. Die Kiesschicht dient dem Schutz des Rollteppichs, der Entwässerung und des Ablaufwassers zu den Entwässerungstrichtern, die in diesem Fall mit einer flachen Gitterabdeckung ausgeführt sind. Der Boden ist monolithisch mit leichtem Gefälle (Asphaltbeton, Mosaik, Zement). Das Wasser wird entlang der Außenfläche des Bodens zum Tal abgeleitet, wo Entwässerungstrichter installiert sind.
35. Klassifizierung von Treppen nach Zweck, Lage, Material, Grundrissform, Anzahl der Treppenläufe und Plattformen, Abmessungen der Bauelemente, Bautechnik
Treppen werden nach ihrem Zweck klassifiziert: Haupt oder Haupt- für den täglichen Gebrauch, Hilfs-- Reserve, Feuer, Notfall, Service, Mitarbeiter für Notevakuierung, Kommunikation mit dem Dachboden oder Keller, für den Zugang zu verschiedenen Geräten usw., Eingang- ein Gebäude für den Eingang, meist in Form einer breiten Eingangsplattform mit Stufen angeordnet. Nach Anzahl der Treppen: 1) einläufig, 2) zweiläufig, 3) dreiläufig. Je nach Herstellungsverfahren: in Form eines volumetrischen Blocks; von Plattformen zusammen mit Märschen; von separaten Plattformen und Märschen; aus kleinformatigen Elementen in Form von Einzelstufen, Wangen, Wangenträgern und Platten. Anhand der Lage im Gebäude werden sie unterschieden: in intern-öffentliche Treppenhäuser, die sich in Treppenhäusern befinden oder in den Eingangsbereichen öffentlicher Gebäude offen sind, wohnungsintern dient dazu, Wohnräume innerhalb einer Wohnung zu verbinden, wenn diese auf mehreren Ebenen liegt, und extern.
In der Praxis des Massenbaus wird die Höhe der Steigleitung üblicherweise mit 140–170 angenommen mm, aber nicht mehr als 180 mm und nicht weniger als 135 mm, und die Breite der Lauffläche wird mit 280-300 angenommen mm, aber nicht weniger als 250 mm. Die Breite der Treppe wird in erster Linie durch die Brandschutzanforderungen sowie durch die Abmessungen der über die Treppe transportierten Gegenstände bestimmt. Die Gesamtbreite der Treppenläufe wird in Abhängigkeit von der Anzahl der Personen auf der am stärksten besiedelten Etage mit mindestens 0,6 angesetzt M pro 100 Personen Die Breite der Podeste darf nicht geringer sein als die Breite des Treppenabsatzes. Für Haupttreppen mit Laufbreite 1,05 M Plattformen müssen mindestens 1,2 breit sein M. Podeste vor Aufzugeingängen mit Drehtüren müssen mindestens 1,6 Liter breit sein.
Zwischen den Treppenläufen wird ein Abstand von mindestens 100 m Breite gelassen. mm, was zum Durchführen eines Feuerwehrschlauchs erforderlich ist.
Anforderungen an die Gestaltung von Treppen
Treppen werden in Übereinstimmung mit den Bauvorschriften und -vorschriften entworfen, um die grundlegenden Anforderungen an Treppen zu gewährleisten: 1) Stärke, Steifigkeit. Durch Berechnung überprüft.2) Bequemlichkeit, Gehsicherheit. Sicherheit und Komfort werden durch eine Reihe von Regeln gewährleistet: a) Gewährleistung eines ermüdungsfreien Hebens, Die Größe der Stufen sorgt dafür, dass Sie Ihre Füße bequem platzieren können. Die Höhe der Steigleitung beträgt 140–170 mm (Standard – 150 mm), jedoch nicht mehr als 180 mm und nicht weniger als 135 mm. Die Profilbreite wird mit 280–300 mm (Standard – 300 mm) angenommen, jedoch nicht weniger als 250 mm; b) alles Die Stufen im Treppenlauf müssen gleich groß sein. c) Nummer es gibt mindestens 3 Aufstiege in einem Flug (bei weniger kann man leicht stolpern) – und nicht mehr als 18. d) natürliche Beleuchtung; Treppenhäuser sollten in der Regel natürliches Licht durch Fenster in den Außenwänden haben. In Treppenhäusern dürfen keine Wirtschaftsräume oder Vorrichtungen angebracht werden, die Durchgänge behindern oder als Brandherd dienen könnten. e) Der Zaun (Geländer) muss eine Höhe von mindestens 0,9 m haben. f) Es empfiehlt sich, die Abzweigung zu gestalten die Treppe nach links (beim Aufstieg die Treppe hinauf.3) Evakuierungssicherheit. a) wird durch die Tragfähigkeit der Treppe in Abhängigkeit von deren Breite und Neigung gewährleistet. b) Die Breite des Podests darf nicht geringer sein als die Breite des Treppenlaufs.) Es muss ein Abstand von mindestens 50 mm zwischen den bestehen Flucht und Treppe zum Durchführen eines Feuerwehrschlauchs; d) Brandschutzsicherheit. Für Treppen in mehrstöckigen Gebäuden gelten zusätzliche Anforderungen. Sie müssen feuerfest sein und eine Feuerwiderstandsdauer von 1,5 Stunden haben.
Fundamentabdichtung
Nullzyklusstrukturen von Zivilgebäuden erfordern Geräte Abdichtung. Die Wahl der Gestaltungsmöglichkeit der Abdichtung hängt davon ab
Die Art des Einflusses der Bodenfeuchtigkeit
Standortmodi
Wasserdichtigkeit der Baumaterialien des unterirdischen Gebäudeteils.
Feuchtigkeit gelangt über den Boden durch Luftfeuchtigkeit oder Pfundwasser in die Fundamentstrukturen. Durch die kapillare Ansaugung von Feuchtigkeit kommt es zu Durchfeuchtung der Keller- und Obergeschosswände. Ein Hindernis für diesen Prozess ist die Installation von horizontalen und vertikalen Abdichtungen. Um die Wände vor kapillarer Feuchtigkeit zu schützen, werden in den Fundamenten Abdichtungen installiert – horizontal und vertikal. Je nach Installationsmethode wird die Abdichtung unterschieden:
Malraum,
Putz (Zement oder Asphalt),
Gussasphalt,
Kleben (aus Rollenmaterialien)
Schale (aus Metall).
Wenn das Gebäude nicht unterkellert ist, wird die horizontale Abdichtung auf der Basisebene über dem Bodenniveau (Nr. 1) und in den Innenwänden auf Höhe der Fundamentkante verlegt. Wenn ein Keller vorhanden ist, wird unter dessen Boden eine zweite Ebene der horizontalen Abdichtung verlegt. Die horizontale Abdichtung besteht aus zwei Schichten Rollenmaterial (Dachpappe auf Mastix, Abdichtungsmaterial, Hydroglas-Isoliermaterial, Isoplast usw.) oder einer Schicht Asphaltbeton, Zement mit Abdichtungszusätzen.
Vertikale Abdichtungen dienen dem Schutz von Kellerwänden. Seine Gestaltung richtet sich nach dem Feuchtigkeitsgrad des Baugrundes. Bei trockenen Böden beschränken sie sich auf eine zweimalige Beschichtung mit Heißbitumen. Tragen Sie bei nassen Böden feuchtigkeitsbeständigen Zementputz mit Abdichtung auf, der mit Rollenmaterialien in zwei Schichten bedeckt ist. Zum Schutz der vertikalen Abdichtung werden Druckwände aus Ziegel- oder Asbestzementplatten installiert.
Optionen für Gestaltungslösungen für Krag- und Balkenplatten für Balkone

48. Arten von Loggien. Konstruktive Lösungen für eingebaute und abgelegene Loggien von Gebäuden aus großformatigen Elementen
Balkone und Loggien sind offene Grundflächen in Wohn- und öffentlichen Gebäuden, die die Innenräume von Betriebsräumen mit der Außenumgebung verbinden. In Notsituationen können sie zur Evakuierung von Personen eingesetzt werden. Loggien sind im Gegensatz zu Balkonen seitlich von Wänden umgeben und können entweder in das Gebäudevolumen oder außen eingebaut werden. Loggien werden weniger lange von der Sonne beleuchtet als Balkone und ihre Konstruktion erfordert eine Vergrößerung der Fläche der Außenwände.
Um die Bildung einer Kältebrücke zu vermeiden, werden die Zwischengeschossdecken der Loggien durch eine Außenwandplatte von den Hauptzwischengeschossdecken getrennt oder der Spalt mit Dämmstoff ausgefüllt, auf den oben eine Fensterbankplatte und unten Glasflügel aufgesetzt werden. Der Boden der Loggia ist wie auf Balkonen mit einer Neigung von 1-2 % nach außen angeordnet und besteht aus Fliesen, die in Zementmörtel über einer Abdichtungsschicht verlegt sind.
Die Bodenplatte von Balkonen und Loggien entlang des Außenumfangs muss über eine Tropfleitung verfügen. Die Umzäunung der Loggien besteht aus einem Metallgitter, dessen Pfosten in die Sockel der Balkonplatte eingelassen sind und an der Wand ein Handlauf und Sichtschutz befestigt ist. Bildschirme können aus Metall, Asbestzementplatten, Glasfaser oder verstärktem Glas bestehen.
Bodenplatten eingebaute Loggien von Plattenbauten ruhen auf tragenden seitlichen inneren Stahlbetonwänden, die zusätzliche Dämmkonstruktionen in Form von separaten Zusatzplatten von Außenwänden oder volumetrischen Elementen erfordern.
Merkmale der Designlösung abgelegene Loggien besteht in der Gefahr einer unterschiedlichen Sedimentverformung zwischen Loggien und Gebäude, insbesondere bei einer großen Geschosszahl, da die Decken solcher Loggien auf befestigten Seitenwandwänden – „Wangen“ – ruhen.
Daher werden in mehrstöckigen Gebäuden Konstruktionen aus hängenden Loggien entworfen, deren „Wangen“ an den Querinnenwänden befestigt werden.
Die Seitenwände von Außenloggien sind nur bei niedrigen und mittleren Gebäuden als tragende Elemente ausgelegt. Um gleichzeitig eine gemeinsame Aufstellung der Loggien und des Gebäudes zu gewährleisten, ruhen die Wände der Loggien auf Abschnitten der Fundamente der Querinnenwände.
In Gebäuden mit Rahmenpaneelen funktionieren die Balkonplatten (Loggien) nach einem Balkenschema und ruhen auf Säulenkonsolen, wodurch eine Lastübertragung auf die Außenwände vermieden wird. Dabei werden die vertikalen und horizontalen Fugen der Außenwandplatten nach dem Prinzip einer entwässerten Fuge gedämmt.
Bei der Gestaltung von Balkonen und Loggien ist auf die Wasserableitung von den Außenwänden zu achten.
Optionen für Designlösungen für Außenwände aus volumetrischen Blöcken. Konstruktionen von Verbindungen, Verbindungen und Teilen
Die konstruktive Lösung hängt vom Schema der Zerlegung dieser Gebäude in ihre Einzelteile ab. Die strukturellen Entwürfe von volumetrischen Blockgebäuden sind komplexer als Ziegel-, Block- und Plattengebäude, da es sich bei volumetrischen Blöcken um räumliche Zellen handelt. Abhängig von der Art der Anwendung von Volumenblöcken und anderen Strukturelementen von Blockbausystemen gibt es: 1) ein homogenes Blocksystem, bei dem das gesamte Gebäude aus tragenden Volumenblöcken zusammengesetzt ist; 2) ein heterogenes Blocksystem, bei dem das Gebäude aus tragenden und nicht tragenden Blöcken zusammengesetzt ist; 3) Rahmenblocksysteme, bei denen nicht tragende Volumenblöcke auf dem tragenden Rahmen des Gebäudes ruhen; 4) ein Blockpaneelsystem, bei dem Gebäude aus tragenden volumetrischen Blöcken und großen Paneelen von Außen- und Innenwänden und -decken zusammengesetzt werden; 5) ein System aus hängenden volumetrischen Blöcken, bei dem tragende volumetrische Blöcke aufgehängt werden tragende Teile des Gebäudes, die die Kerne der Steifigkeit darstellen.
Allgemeine Bestimmungen zur Gestaltung öffentlicher Gebäude (Leistungsklassen, Dauerhaftigkeit, Feuerwiderstandsgrad, grundlegende Brandschutzmaßnahmen)
Basierend auf der Dauerhaftigkeit werden Gebäude in drei Stufen eingeteilt:
1. Grad – Lebensdauer mehr als 100 Jahre;
2. Grad – Lebensdauer von 50 bis 100 Jahren;
3. Grad – Lebensdauer von 20 bis 50 Jahren;
Weniger als 20 Jahre – vorübergehend.
Brandschutz von Gebäuden
Basierend auf der Möglichkeit eines Brandes werden Baumaterialien und Bauwerke unterteilt in:
Brennbar (brennbar), das sich bei Einwirkung von Feuer oder hoher Temperatur entzündet und nach Entfernung der Brandquelle weiter brennt;
Nicht brennbar (nicht brennbar), die sich nicht entzünden, glimmen oder verkohlen, wenn sie Feuer oder hohen Temperaturen ausgesetzt werden;
Schwer brennbar, die unter dem Einfluss einer Feuerquelle oder hoher Temperatur nur schwer brennen oder glimmen, aber wenn die Feuerquelle entfernt wird, hört ihr Brennen oder Schwelen auf. Baukonstruktionen zeichnen sich auch durch Feuerwiderstand aus, d.h. Der Feuerwiderstand in Stunden bis zum Verlust der Festigkeit oder Stabilität oder bis zur Bildung durchgehender Risse oder bis die Temperatur auf der Oberfläche des Bauwerks auf der der Feuereinwirkung gegenüberliegenden Seite auf 140 °C ansteigt. Basierend auf dem Feuerwiderstand sind Gebäude in 5 Grad unterteilt. Bei der Bestimmung des Feuerwiderstands von Gebäuden werden der Feuerwiderstand der Grundmaterialien und -konstruktionen sowie die Brandgefahr der im Gebäude durchgeführten technologischen Prozesse berücksichtigt. Der erste Grad umfasst Gebäude mit dem höchsten Feuerwiderstand und der fünfte Grad umfasst Gebäude mit dem geringsten Feuerwiderstand.
66. Raumplanerische Lösungen für öffentliche Gebäude (Hauptgruppen von Räumlichkeiten, Anforderungen an sie basierend auf der grundlegenden volumetrisch-räumlichen Struktur von Gebäuden)
Öffentliche Gebäude weisen eine große Vielfalt an raumplanerischen Kompositionen auf, die vor allem von ihrer funktionalen Zweckbestimmung und architektonischen Gestaltung abhängen. Dennoch stechen Flure und Säle aus der Vielfalt der Kompositionsformen öffentlicher Gebäude deutlich hervor. Bei den meisten öffentlichen Gebäuden handelt es sich um eine „gemischte Gruppe“, die sich in modernen Dienstleistungen für die Bevölkerung von Städten, Arbeitersiedlungen und ländlichen Gebieten immer weiter verbreitet hat. Gebäude werden nach einem Enfilade-Schema gebaut, bei dem der Personenstrom durch Türen, die auf derselben Achse liegen, von Raum zu Raum geleitet wird. Dieses Layout ist typisch für die Räumlichkeiten von Museen, Kunstgalerien und einigen Arten von Ausstellungen.
Для всех видов общественных зданий присущи основные планировочные элементы: помещения основного функционального назначения (в административных зданиях - рабочие кабинеты, комнаты; в зальных помещениях - залы, в торговых зданиях и зданиях общественного питания - торговые и обеденные залы, в библиотеках - читальные залы и книгохранилища usw.); Eingangseinheit – bestehend aus Vorraum, Vorraum und Garderobe; vertikale Transporteinheit – Treppen, Aufzüge; Räumlichkeiten für die Bewegung und Verteilung menschlicher Ströme in Korridorgebäuden – Korridore und Erholung; in Theatern – Foyers und Lobbys; Sanitäranlagen – Toiletten, Waschbecken, Räume für die persönliche Hygiene.
Die relative Anordnung der Hauptplanungselemente entsprechend dem funktionalen Zweck und die beste Organisation der Menschenströme zeugen von der Qualität der Gebäudeaufteilung.
Anforderungen an die Gestaltung mehrgeschossiger Wohngebäude
An Gebäude werden folgende Grundanforderungen gestellt:
a) Anforderung der funktionalen Compliance, d. h. das Gebäude muss seinem funktionalen Zweck entsprechen;
b) Anforderung der technischen Konformität, d. h. das Gebäude muss stark, stabil und langlebig sein;
c) das Erfordernis architektonischer und künstlerischer Ausdruckskraft, d.h. Das Gebäude muss optisch und innen schön sein und einen positiven Einfluss auf die Menschen haben.
d) das Erfordernis der Wirtschaftlichkeit, d.h. Erzielung der maximal nutzbaren Fläche oder des maximal nutzbaren Volumens des Gebäudes durch den Bau mit minimalem Aufwand an Mitteln, Arbeit und Zeit für den Bau und Betrieb des Gebäudes, jedoch unter zwingender Erfüllung der ersten drei Anforderungen.
Die Eignung eines Gebäudes oder einer Räumlichkeit für eine bestimmte Funktion wird dadurch erreicht, dass in diesem Gebäude oder Räumlichkeit optimale Bedingungen für den Menschen und für die Durchführung funktionaler Prozesse geschaffen werden. Die Bedingungen in einem Gebäude oder Raum werden durch folgende Faktoren charakterisiert: Raum, Klimaanlage, Klangmodus, Lichtmodus sowie Bedingungen der Sicht und visuellen Wahrnehmung.
a) Der Raum wird durch die Fläche und das Volumen des Gebäudes und seiner Räumlichkeiten charakterisiert und durch die Größe und Form des Gebäudes und seiner Räumlichkeiten im Grundriss und in der Höhe bereitgestellt.
b) Der Zustand der Luftumgebung wird durch die Luftzufuhr, ihre Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Bewegungsgeschwindigkeit charakterisiert und durch die Strukturen von Außenzäunen und sanitären Anlagen (Heizung, mechanische Belüftung, Klimaanlage usw.) sichergestellt.
c) Der Schallmodus wird durch die seinem funktionalen Zweck entsprechenden Hörverhältnisse im Raum charakterisiert und durch raumplanerische und gestalterische Lösungen unter Verwendung schallabsorbierender, schallreflektierender und schalldämmender Materialien und Konstruktionen gewährleistet.
d) Das Lichtregime wird durch die Betriebsbedingungen der Sehorgane entsprechend dem funktionalen Zweck des Raumes charakterisiert und durch die Größe der Fensteröffnungen und Laternen für natürliche Beleuchtung, deren Ausrichtung entlang der Horizontseiten und mit sichergestellt mit Hilfe künstlicher Beleuchtung.
e) Sichtbarkeit und visuelle Wahrnehmung sind mit der Notwendigkeit verbunden, flache oder dreidimensionale Objekte in einem Raum zu sehen und werden durch das Lichtregime und die relative Position des Betrachters und des von ihm wahrgenommenen Objekts gewährleistet.
2. Arten von Planungsvorhaben für mehrstöckige Wohngebäude
Sektionale Wohngebäude Ein Abschnitt in einem Wohngebäude umfasst eine vertikale Transporteinheit (Treppen und Aufzüge) und Stockwerk für Stockwerk angrenzende Wohnungen. In mittelgroßen Gebäuden befinden sich auf dem Treppenabsatz jeder Etage 2 bis 4 Wohnungen, in Gebäuden mit 6 oder mehr Etagen mindestens 4 Wohnungen, was eine sparsamere Nutzung von Aufzügen und Müllschluckern gewährleistet. Je nach Standort im Haus gibt es Normal-, End-, Eck- und Drehabschnitte. Gewöhnliche Abschnitte befinden sich im mittleren Teil des Hauses, Endabschnitte befinden sich an den Enden, Eck- und Drehabschnitten, an Stellen, an denen sich Gebäude im Grundriss drehen. In Abschnitten mit uneingeschränkter Ausrichtung sind die Fenster jeder Wohnung zu beiden Längsseiten des Gebäudes ausgerichtet. Solche Abschnitte können in jeder Richtung relativ zu den Seiten des Horizonts liegen, auch parallel zum Breitengrad, und werden als Breitengrad bezeichnet. In begrenzten Orientierungsabschnitten sind die Fenster jeder Wohnung zu einer der Längsseiten des Gebäudes ausgerichtet. Solche Abschnitte können nur parallel zum Meridian liegen und werden als Meridian bezeichnet. In Abschnitten mit teilweise eingeschränkter Ausrichtung verfügt ein Teil der Wohnungen über Fenster auf beiden Längsseiten des Gebäudes, der andere Teil der Wohnungen über Fenster auf einer Seite. Diese Abschnitte sind in Bezug auf die Seiten des Horizonts so positioniert, dass die erforderliche Sonneneinstrahlung von Wohnungen mit einseitigen Fenstern gewährleistet ist, da die Sonneneinstrahlung von Wohnungen mit zweiseitigen Fenstern in jedem Fall gewährleistet ist. Sektionalwohngebäude werden in zwei oder mehr Abschnitten konzipiert. Reihenabschnitte haben meistens eine rechteckige Form, Endabschnitte sind rechteckig oder T-förmig und Rotationsabschnitte haben L-Form oder andere Formen.
Es wird davon ausgegangen, dass sich alle Stützpunkte der Struktur nach dem gleichen Gesetz vorwärts bewegen X 0 = XJ ()
Bei einem Erdbeben beginnen sich die Böden am Sockel des Gebäudes zu bewegen, wie in Abbildung 14 dargestellt.
In diesem Fall unterliegt jede Volumeneinheit der Struktur einer Trägheitskraft, abhängig von den in diesen Volumina konzentrierten Trägheitsparametern – den Massen und Steifigkeitseigenschaften der Struktur. Diese Trägheitskräfte werden seismische Kräfte oder seismische Belastungen genannt und bringen die Struktur in einen Spannungs-Dehnungs-Zustand.
Betrachten wir die wichtigsten Ansätze, mit denen wir so wichtige Parameter wie Steifigkeit, Eigenfrequenz und Schwingungsmodi einer Struktur bestimmen können. Am einfachsten ist es, als Gebäudemodell einen Linearschwinger zu wählen, dessen Wirkung durch horizontale Bewegung des Sockels nach einem vorgegebenen Gesetz modelliert wird X Q = X0(t), und das System hat einen Freiheitsgrad, der durch die horizontale Bewegung der konzentrierten Masse bestimmt wird T(Abb. 15).
Somit ist die Gesamtverschiebung X 0 (0 Masse T zu jedem Zeitpunkt besteht aus der „übertragbaren“ Verschiebung Xj(t) und der durch die Biegung des Stabes verursachten Relativverschiebung X2(t):
![]()
Erstellen wir eine Bewegungsgleichung mit der Verschiebungsmethode, da uns der Wert der Rückstellkraft (Elastizitätskraft) gleich interessiert ![]()

Designdiagramm eines linearen Oszillators
Wo ist die Verschiebung? X t Massen in der Horizontalen
Richtung, die durch die Wirkung einer Einheitskraft verursacht wird - die Steifigkeit des linearen Oszillators.
Die Massengleichgewichtsgleichung lautet
Dann berücksichtigen Sie:

wobei co 2 die Frequenz der Eigenschwingungen des Oszillators ist, erhalten wir eine Bewegungsgleichung, in der der Parameter, der das Schwingsystem definiert, die Frequenz der Eigenschwingungen dieses Systems ist:
Seismische Belastungen können in jede Richtung wirken, daher sind für reale Gebäude und Bauwerke die Gleichungen, die ihre Bewegung unter seismischen Belastungen bestimmen, sehr umständlich, das System zeichnet sich jedoch immer noch durch die gleiche Eigenfrequenz aus.
Wenn wir das Problem des erdbebensicheren Bauens verallgemeinern, dann besteht es aus Sicht der abgeleiteten Gleichungen darin, diejenigen Bauwerke zu identifizieren, die am wenigsten fest und steif sind, und dementsprechend ihre Festigkeit zu erhöhen (seismische Verstärkung) oder die Belastung auf sie zu verringern (seismische Isolierung).
Moderne Regulierungsdokumente legen allgemeine Anforderungen zur Gewährleistung der mechanischen Sicherheit von Gebäuden und Bauwerken fest. Also, in Teil 6 der Kunst. 15 des Bundesgesetzes Nr. 384 „Technische Vorschriften zur Sicherheit von Gebäuden und Bauwerken“ stellt die Anforderungen, dass „während des Baus und Betriebs eines Gebäudes oder Bauwerks seine Baukonstruktionen und sein Fundament hinsichtlich der Festigkeit nicht den Grenzzustand erreichen.“ und Stabilität... unter verschiedenen gleichzeitigen Belastungen und Stößen.“
Als Grenzzustand von Bauwerken und Fundamenten hinsichtlich Festigkeit und Stabilität ist ein Zustand zu verstehen, der gekennzeichnet ist durch:
- Zerstörung jeglicher Art;
- Verlust der Formstabilität;
- Verlust der Positionsstabilität;
- Verletzung der Gebrauchstauglichkeit und andere Phänomene, die mit der Gefahr einer Schädigung des Lebens und der Gesundheit von Menschen, des Eigentums natürlicher oder juristischer Personen, des staatlichen oder kommunalen Eigentums, der Umwelt, des Lebens und der Gesundheit von Tieren und Pflanzen verbunden sind.
Bei der Berechnung von Bauwerken und Fundamenten müssen alle Arten von Belastungen berücksichtigt werden, die dem Funktionszweck und der Gestaltung des Gebäudes oder Bauwerks entsprechen, klimatische und gegebenenfalls technologische Einflüsse sowie Kräfte, die durch Verformung von Bauwerken und Fundamenten verursacht werden.
Ein Gebäude oder Bauwerk in einem Gebiet, in dem gefährliche natürliche Prozesse und Phänomene und (oder) vom Menschen verursachte Einwirkungen auftreten können, muss so entworfen und gebaut werden, dass während des Betriebs des Gebäudes oder Bauwerks gefährliche natürliche Prozesse und Phänomene und (oder) auftreten können ) Vom Menschen verursachte Einwirkungen verursachen keine in Art. genannten Folgen. 7 des Bundesgesetzes Nr. 384 und (oder) andere Ereignisse, die eine Gefahr für das Leben oder die Gesundheit von Menschen, das Eigentum natürlicher oder juristischer Personen, staatliches oder kommunales Eigentum, die Umwelt, das Leben und die Gesundheit von Tieren und Pflanzen darstellen .
Für Elemente von Bauwerken, deren Eigenschaften, die bei der Berechnung der Festigkeit und Stabilität eines Gebäudes oder Bauwerks berücksichtigt werden, sich während des Betriebs unter dem Einfluss klimatischer Faktoren oder aggressiver Faktoren der äußeren und inneren Umgebung, einschließlich unter, ändern können Der Einfluss seismischer Prozesse, die zu Ermüdungserscheinungen im Material der Gebäudestrukturen führen können, muss in der Projektdokumentation zusätzlich Parameter angeben, die die Widerstandsfähigkeit gegenüber solchen Stößen charakterisieren, oder Maßnahmen zum Schutz davor.
Bei der Beurteilung der Folgen eines Erdbebens wird die Klassifizierung von Gebäuden nach der seismischen Skala MMSK - 86 verwendet. Entsprechend dieser Skala werden Gebäude in zwei Gruppen eingeteilt:
- 1) Gebäude und Standardkonstruktionen ohne erdbebensichere Maßnahmen;
- 2) Gebäude und Standardkonstruktionen mit erdbebensicheren Maßnahmen.
Gebäude und Standardkonstruktionen ohne erdbebensichere Maßnahmen werden in Typen unterteilt.
A1 – örtliche Gebäude. Gebäude mit Wänden aus lokalen Baumaterialien: Lehm ohne Rahmen; Lehm- oder Lehmziegel ohne Fundament; aus gerolltem oder zerrissenem Stein mit Lehmmörtel und ohne regelmäßiges Mauerwerk (Ziegel oder Stein in der richtigen Form) in den Ecken usw.
A2 – örtliche Gebäude. Gebäude aus Lehmziegeln oder Lehmziegeln mit Stein-, Ziegel- oder Betonfundamenten; aus zerrissenem Stein auf Kalk-, Zement- oder komplexem Mörtel mit regelmäßigem Mauerwerk in den Ecken; aus Schichtstein mit Kalk, Zement oder komplexem Mörtel; aus Mauerwerk vom Typ Midis; Fachwerkgebäude mit Lehm- oder Lehmfüllung und schweren Lehm- oder Lehmdächern; solide massive Zäune aus Lehm- oder Lehmziegeln usw.
B – lokale Gebäude. Gebäude mit Holzrahmen mit Lehm- oder Lehmkern und Leichtbauböden:
- 1) B1 – Standardgebäude. Gebäude aus gebrannten Ziegeln, Quadern oder Betonblöcken mit Kalk, Zement oder komplexem Mörtel; Holzplattenhäuser;
- 2) B2 – Bauwerke aus gebrannten Ziegeln, Quadern oder Betonblöcken mit Kalk, Zement oder komplexem Mörtel: feste Zäune und Mauern, Transformatorkioske, Silos und Wassertürme.
IN- lokale Gebäude. Holzhäuser, geschnitten in „Lapa“ oder „Oblo“:
- 1) B1 – Standardgebäude. Stahlbeton-, Rahmen-Großtafel- und verstärkte Großblockhäuser;
- 2) B2 – Strukturen. Stahlbetonkonstruktionen: Silos und Wassertürme, Leuchttürme, Stützmauern, Schwimmbäder usw.
Gebäude und Standardkonstruktionen mit erdbebensicheren Maßnahmen werden in folgende Typen unterteilt:
- 1) C 7 – Standardgebäude und Bauwerke aller Art (Ziegel, Blöcke, Platten, Beton, Holz, Platten usw.) mit erdbebensicheren Maßnahmen für eine berechnete Seismizität von 7 Punkten;
- 2) C8 – Standardgebäude und Bauwerke aller Art mit erdbebensicheren Maßnahmen für eine Bemessungsseismizität von 8 Punkten;
- 3) C9 – Standardgebäude und Bauwerke aller Art mit erdbebensicheren Maßnahmen für eine Bemessungsseismizität von 9 Punkten.
Wenn zwei oder drei Typen in einem Gebäude kombiniert werden, sollte das Gebäude als Ganzes als das schwächste davon eingestuft werden.
Bei Erdbeben ist es üblich, fünf Grade der Zerstörung von Gebäuden zu berücksichtigen. Die internationale modifizierte seismische Skala MMSK-86 schlägt die folgende Klassifizierung des Zerstörungsgrads von Gebäuden vor:
- 1) d = 1 – schwacher Schaden. Leichte Schäden an den materiellen und nichttragenden Elementen des Gebäudes: dünne Risse im Putz; Absplittern kleiner Gipsstücke; dünne Risse in den Schnittstellen von Böden zu Wänden und Wandfüllungen mit Rahmenelementen, zwischen Paneelen, in den Aussparungen von Öfen und Türrahmen; dünne Risse in Trennwänden, Gesimsen, Giebeln, Rohren. Es sind keine Schäden an Bauelementen erkennbar. Zur Schadensbeseitigung genügen routinemäßige Reparaturen an Gebäuden;
- 2) D= 2 – mäßiger Schaden. Erhebliche Schäden an materiellen und nichttragenden Elementen des Gebäudes, herabstürzende Putzschichten, durch Risse in Trennwänden, tiefe Risse in Gesimsen und Giebeln, herabfallende Ziegel aus Schornsteinen, herunterfallende einzelne Ziegel. Leichte Schäden an tragenden Strukturen: dünne Risse in tragenden Wänden; geringfügige Verformungen und kleine Beton- oder Mörtelabplatzungen an Rahmen- und Plattenstößen. Um Schäden zu beseitigen, sind größere Reparaturen an Gebäuden notwendig;
- 3) D= 3 - schwerer Schaden. Zerstörung nichttragender Elemente des Gebäudes: Einsturz von Teilen von Trennwänden, Gesimsen, Giebeln, Schornsteinen; erhebliche Schäden an tragenden Strukturen: durch Risse in tragenden Wänden; erhebliche Verformungen des Rahmens; spürbare Verschiebungen der Panels; Abplatzungen von Beton an Rahmenknoten. Eine Renovierung des Gebäudes ist möglich;
- 4) D= 4 - teilweise Zerstörung tragender Strukturen: Brüche und Einstürze in tragenden Wänden; Zusammenbruch von Gelenken und Rahmenbaugruppen; Unterbrechung der Verbindungen zwischen Gebäudeteilen; Einsturz einzelner Bodenplatten; Einsturz großer Gebäudeteile. Das Gebäude wird abgerissen;
- 5) D= 5 - kollabiert. Einsturz tragender Wände und Decken, völliger Einsturz des Gebäudes mit Formverlust.
Bei der Analyse der Folgen von Erdbeben können wir die folgenden Hauptschäden identifizieren, die Gebäude unterschiedlicher Bauart erlitten, wenn die seismischen Auswirkungen die berechneten Werte überstiegen.
Bei Rahmenbauten werden überwiegend Rahmenknoten durch das Auftreten erheblicher Biegemomente und Querkräfte an diesen Stellen zerstört. Besonders stark beschädigt sind die Sockel der Gestelle und die Verbindungen der Querträger mit den Gestellen des Rahmens (Abb. 16a).
In Gebäuden mit großen Platten und großen Blöcken werden am häufigsten Stoßverbindungen von Platten und Blöcken untereinander und mit Böden zerstört. In diesem Fall werden gegenseitige Verschiebungen der Paneele, Öffnung vertikaler Fugen, Abweichungen der Paneele von ihrer ursprünglichen Position und in einigen Fällen ein Zusammenbruch der Paneele beobachtet (Abb. 160).
Die folgenden Schäden sind typisch für Gebäude mit tragenden Wänden aus lokalen Materialien (Lehmziegel, Lehmziegel, Tuffsteinblöcke usw.): das Auftreten von Rissen in den Wänden (Abb. 17); Einsturz der Stirnwände; Verschiebung und manchmal Einsturz von Böden; Einsturz freistehender Regale und insbesondere von Öfen und Schornsteinen.
Die Zerstörung von Gebäuden ist vollständig durch die Gesetze der Zerstörung gekennzeichnet. Unter den Gesetzen der Gebäudezerstörung

Die Zerstörung eines Fachwerkgebäudes während eines Erdbebens in China (a) und die Zerstörung von Plattengebäuden während eines Erdbebens in Rumänien (b) zeigt einen Zusammenhang zwischen der Wahrscheinlichkeit seiner Beschädigung und der Intensität des Erdbebens in Punkten. Die Gesetze der Gebäudezerstörung wurden auf der Grundlage der Analyse statistischer Materialien zur Zerstörung von Wohn-, öffentlichen und Industriegebäuden durch die Auswirkungen von Erdbeben unterschiedlicher Intensität ermittelt.

Typische Schäden an Ziegelwänden unter seismischer Einwirkung
Um eine Kurve zu konstruieren, die die Eintrittswahrscheinlichkeit mindestens eines bestimmten Schadensgrades an Gebäuden annähert, wird das Normalgesetz der Schadensverteilung verwendet. Dabei wird berücksichtigt, dass für ein und dasselbe Gebäude nicht ein, sondern fünf Zerstörungsgrade berücksichtigt werden können, d. h. Nach der Zerstörung tritt eines von fünf inkompatiblen Ereignissen ein. Die Werte der mathematischen Erwartung M mo der Intensität eines Erdbebens an Punkten, die mindestens einen bestimmten Grad der Zerstörung von Gebäuden verursachen, sind in Tabelle 1 angegeben.
Tabelle 1
Mathematische Erwartungen M mo Gesetze der Gebäudezerstörung
|
Gebäudeklassen nach MMSK-86 |
Grad der Gebäudezerstörung |
||||
|
Leicht d = 1 |
Mäßig d = 2 |
Teilweise Zerstörung D = 4 |
|||
|
Mathematische Erwartungen M Gesetze der Zerstörung |
|||||
Mithilfe der Daten in Tabelle 1 können wir die Wahrscheinlichkeit von Schäden an Gebäuden verschiedener Klassen bei einer bestimmten Erdbebenintensität vorhersagen.
Jedes Gebäude oder Bauwerk ist zwangsläufig den Auswirkungen bestimmter Belastungen ausgesetzt. Dieser Umstand zwingt uns als Planer dazu, die Funktion der Struktur aus der Perspektive ihrer ungünstigsten Kombination zu analysieren – damit die Struktur auch dann stark, stabil und langlebig bleibt, wenn sie auftritt.
Für eine Struktur ist die Belastung ein äußerer Faktor, der sie von einem Ruhezustand in einen Spannungs-Dehnungs-Zustand überführt. Das Sammeln von Lasten ist nicht das ultimative Ziel des Ingenieurs – diese Verfahren gehören zur ersten Stufe des Strukturanalysealgorithmus (in diesem Artikel besprochen).
Lastklassifizierung
Zunächst werden Belastungen nach dem Zeitpunkt der Einwirkung auf das Bauwerk klassifiziert:
- Dauerlasten (wirken über den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes)
- temporäre Belastungen (von Zeit zu Zeit, periodisch oder einmalig wirken)
Durch die Segmentierung von Lasten können Sie den Betrieb einer Struktur simulieren und die entsprechenden Berechnungen flexibler durchführen, wobei die Wahrscheinlichkeit des Auftretens der einen oder anderen Last und die Wahrscheinlichkeit ihres gleichzeitigen Auftretens berücksichtigt werden.
Maßeinheiten und gegenseitige Umrechnungen von Lasten
In der Bauindustrie werden konzentrierte Kraftbelastungen typischerweise in Kilonewton (kN) und Momentbelastungen in kNm gemessen. Ich möchte Sie daran erinnern, dass nach dem Internationalen Einheitensystem (SI) die Kraft in Newton (N) und die Länge in Metern (m) gemessen wird.
Über das Volumen verteilte Lasten werden in kN/m3, über die Fläche in kN/m2 und über die Länge in kN/m gemessen.
Abbildung 1. Arten von Lasten:
1 - konzentrierte Kräfte; 2 - konzentrierter Moment; 3 - Ladung pro Volumeneinheit;
4 - über die Fläche verteilte Last; 5 - Last über die Länge verteilt
Jede konzentrierte Last \(F\) kann durch Kenntnis des Volumens des Elements \(V\) und des Volumengewichts seines Materials \(g\) ermittelt werden:
Die über die Fläche des Elements verteilte Last kann durch dessen Volumengewicht und Dicke \(t\) (Größe senkrecht zur Lastebene) ermittelt werden:
In ähnlicher Weise erhält man die über die Länge verteilte Last durch Multiplikation des Volumengewichts des Elements \(g\) mit der Dicke und Breite des Elements (Abmessungen in Richtungen senkrecht zur Lastebene):
wobei \(A\) die Querschnittsfläche des Elements ist, m 2.
Kinematische Einflüsse werden in Metern (Auslenkungen) oder Bogenmaßen (Drehwinkeln) gemessen. Thermische Belastungen werden in Grad Celsius (°C) oder anderen Temperatureinheiten gemessen, können aber auch in Längeneinheiten (m) angegeben werden oder dimensionslos sein (Temperaturdehnungen).