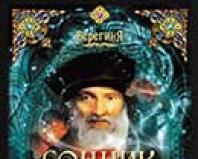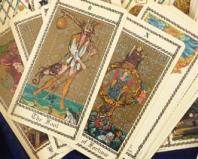Sprache als sich entwickelndes Phänomen. externe und interne Faktoren der Sprachentwicklung. Gesetze der Sprachentwicklung. Interne Gesetze der Sprachentwicklung
In der modernen Linguistik ist der Begriff der Gesetze der Sprachentwicklung nicht klar genug definiert, da viele Sprachveränderungen keine konstante aufsteigende Linie bilden, die mit der Sprachentwicklung verbunden ist. Im allgemeinsten Sinne werden die Gesetze der Sprachentwicklung als ständige und natürliche Trends in der Entwicklung von Sprachen auf dem Weg ihrer Verbesserung definiert. Dabei wird zwischen äußeren Faktoren, die die Entwicklung einer Sprache beeinflussen, und inneren Reizen für ihre Entwicklung, die mit den Eigenschaften des Sprachsystems verbunden sind, unterschieden.
Äußere Gesetze der Sprachentwicklung.Äußere Gesetze der Sprachentwicklung werden durch soziale Faktoren bestimmt, die sowohl die Entwicklung der Sprache als auch die Art ihrer Funktionsweise beeinflussen. Es gibt zwei gesellschaftliche Hauptprozesse, zwei gesellschaftliche Haupttrends in der Sprachentwicklung – Differenzierung (von lat. differentia – Differenz) und Integration (von lat. integratio).< integer- целый). Эти процессы противоположны друг другу. При Differenzierung, andernfalls nennt man es Divergenz (vom lateinischen di-vergere).< diverqens - расходящийся в разные стороны), или Diskrepanz, Es kommt zu einer territorialen und sozialen Verteilung der Sprachsprecher, was zur Entstehung verwandter Sprachen und Dialekte führt. Bei Integration, sie nennen es anders Konvergenz(von lateinisch convergere – sich nähern, konvergieren), oder Vorspur Es kommt zu einer territorialen und sozialen Annäherung der Sprachsprecher, bei der es zur Vereinheitlichung von Sprachen und Dialekten kommt. Differenzierung erhöht die Zahl der Sprachen, Integration hingegen verringert deren Zahl.
Differenzierung und Integration sind soziale sprachliche Prozesse, da die Divergenz und Konvergenz von Sprachen, ihre Vermischung und Kreuzung durch wirtschaftliche, militärische, politische und andere soziale Faktoren erklärt werden. Es sind diese Gründe, die die Einzigartigkeit der Sprachen begründen und als äußere Gesetze ihrer historischen Entwicklung wirken. Durch die Völkerwanderung, ihre Handelskontakte, Kriege, Veränderungen im Sozial- und Wirtschaftssystem kommt es zu Veränderungen in den Funktionen und der Struktur einer bestimmten Sprache.
Ende Seite 280
¯ Seitenanfang 281 ¯
In der Struktur der Sprache offenbart sich die Manifestation äußerer Gesetze am unmittelbarsten im Wortschatz. Somit spiegelte der Wortschatz der englischen Sprache die Prozesse der Kreuzung der Sprache der Angelsachsen und Normannen wider: Wörter Deutscher Herkunft bezeichnen alltägliche Phänomene, Rohstoffe, landwirtschaftliche Begriffe; Wörter französischen Ursprungs beziehen sich auf die Bereiche Recht, Militär, Kunst und Regierung. Diese Aufteilung des Wortschatzes spiegelt die soziale Zersplitterung der damaligen Gesellschaft wider, da die Eroberer die Elite der Gesellschaft bildeten und die indigene Bevölkerung hauptsächlich eine Schicht aus Bauern und Handwerkern bildete. Während der Renaissance entstand die italienische Sprache großer Einfluss auf dem Wortschatz einer Reihe westeuropäischer Sprachen, da Italien in dieser Zeit eine rasche wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung erlebte und sich die Ideen der Renaissance in ganz Europa verbreiteten.
Die Klangstruktur einer Sprache und ihr grammatikalisches System spiegeln, wenn auch in geringerem Maße und nicht so deutlich, den Einfluss äußerer Gesetze auf die Entwicklung einer bestimmten Sprache wider. Beispielsweise existierte der Laut [f] ursprünglich in der russischen Sprache als Merkmal geliehener Wörter: Pharisäer, Februar, Philosoph usw. Im Laufe der Zeit begann dieser Laut als Positionsvariante des Phonems zu fungieren<в>: [F] Tornik, liebe[f"]b usw. Indeklinierbare Substantive bildeten in der russischen Sprache ursprünglich eine besondere Gruppe von Lehnwörtern. Im Laufe der Zeit nahm die Zahl solcher Wörter zu, viele von ihnen wurden in die Sprache übernommen. Infolgedessen entstand in der russischen Sprache eine grammatikalische Gruppe nicht deklinierbarer Substantive.
Man unterscheidet zwischen dem spontanen Einfluss sozialer Faktoren auf die Sprachentwicklung und dem bewussten Einfluss der Gesellschaft auf die Sprache. Zur gezielten Einflussnahme der Gesellschaft auf die Sprache gehört in erster Linie die Sprachpolitik des Staates, die darauf abzielt, das wirksamste Funktionieren der Sprache(n) in verschiedenen Anwendungsbereichen zu fördern. Der Umfang der gesellschaftlichen Eingriffe in die Sprachentwicklung umfasst auch die Schaffung von Schriften und Alphabeten, die Entwicklung von Terminologie, Rechtschreib- und Zeichensetzungsregeln sowie andere Normalisierungsaktivitäten.
Ende Seite 281
¯ Seitenanfang 282 ¯
Daher beeinflussen äußere Bedingungen – spontan oder bewusst – immer die Sprache, und die Sprache reagiert auf diese Anforderungen in der Weise, wie es die intralingualen Fähigkeiten zulassen.
Interne Gesetze der Sprachentwicklung. Betrachtet man die historische Entwicklung nicht der Sprache als Ganzes, sondern ihrer verschiedenen Strukturaspekte, zum Beispiel Phonetik und Grammatik, ihrer einzelnen Einheiten und Kategorien, dann lässt sich nicht immer ein direkter Zusammenhang der Sprachentwicklung erkennen über die Entwicklung der Gesellschaft. Es ist beispielsweise schwierig, den Verlust der Nasenvokale in ostslawischen Sprachen durch direkten Einfluss der Gesellschaft auf die Sprache zu erklären. Es ist nicht möglich, Veränderungen im russischen Sprachsystem aus den Bedingungen wirtschaftlicher, politischer oder politischer Natur abzuleiten Kulturleben Russische Gesellschaft dieser Zeit. Diese spezifischen Entwicklungsmuster von Spracheinheiten und -kategorien werden als interne Gesetze der Sprachentwicklung bezeichnet. Interne Gesetze bestimmen in erster Linie Veränderungen in der Phonetik und der grammatikalischen Struktur der Sprache.
Wie alles in einer Sprache unterliegt auch ihre Klangseite im Laufe der Geschichte Veränderungen. Das klangliche Erscheinungsbild einzelner Wörter und Morpheme sowie deren phonemische Zusammensetzung verändern sich. In der russischen Sprache beispielsweise sind die einst vorhandenen Nasenvokale verschwunden; durch zwei Palatalisierungen haben sich die hinteren lingualen Konsonanten verändert g, k, x unter bestimmten Voraussetzungen in f, h, w Und z, c, s.
Um die Silbenorganisation einer Sprache zu verändern, ist eine lange Entwicklungszeit erforderlich. Solche Veränderungen finden über Jahrhunderte statt. Die frühe Entwicklung der protoslawischen Sprache war mit der Eliminierung geschlossener Silben verbunden, die aus der panindogermanischen Ära stammten. Alle geschlossenen Silben wurden im Laufe einer bestimmten Zeit auf die eine oder andere Weise in offene Silben umgewandelt. Anschließend das Gesetz offene Silbe begann zusammenzubrechen und die geschlossene Silbe ist in modernen slawischen Sprachen wieder vertreten. Die Entwicklung von Stress ist auch mit Veränderungen in der Silbenorganisation in slawischen Sprachen verbunden. Ja, kostenlos Wortbetonung Die übliche slawische Periode in den modernen tschechischen und slowakischen Sprachen wurde durch eine feste Betonung der Anfangssilbe des Wortes ersetzt. Im Polnischen begann man, die Betonung auf die vorletzte Silbe zu legen.
Ende Seite 282
¯ Seitenanfang 283 ¯
In der Geschichte der Sprachen beobachtete Klangveränderungen, Yu.S. Maslov unterteilte in regelmäßige und sporadische. ZU sporadisch er bezog sich auf phonetische Veränderungen, die nur in einzelnen Wörtern oder Morphemen repräsentiert waren. Solche Veränderungen werden durch besondere Bedingungen für die Funktion dieser Wörter oder Morpheme erklärt. So unterliegen Höflichkeitsformeln, Begrüßungen beim Treffen oder Abschied einer starken phonetischen Zerstörung: Sie werden oft schnell und nachlässig ausgesprochen, da ihr Inhalt bereits klar ist. Daher die alte englische Formel für „Auf Wiedersehen“. Sei gut bei dir! - Möge Gott mit dir sein! entwickelte sich zu Auf Wiedersehen - Auf Wiedersehen; Hallo in der amerikanischen Version - in Hey, auf Wiedersehen - V Tschüss. Spanische Ehrenanspracheformel Vuestra Merced – Euer Gnaden infolge sporadischer phonetischer Veränderungen wurde es Usted – Du. Sie schreiben auf Russisch Guten Tag, aber sie sagen Hallo oder auch erwachsen werden.
Regulär Veränderungen treten in einer bestimmten phonologischen Einheit an einer bestimmten phonetischen Position in allen Fällen auf, in denen eine solche Position in der Sprache vorhanden ist, unabhängig von den spezifischen Wörtern und Formen, in denen sie auftritt. Bei einem solchen regelmäßigen Wechsel spricht man meist von einem Klang- oder Lautgesetz. Zum Beispiel das Ersetzen altrussischer Kombinationen Hey Hey Hey moderne Kombinationen Gi, Ki, hee passt zum Konzept des Lautgesetzes, da es fast alle Wörter mit den folgenden Kombinationen berührt: statt Gybnuti, Göttinnen, Kiew, List, Kypeti, Raubtier entstand zugrunde gehen, Göttin, Kiew, List, Kochen, Raubtier usw.
Gesunde Gesetze sind rein historisch und haben nicht den universellen Charakter, der den Gesetzen der Naturwissenschaften innewohnt. Das Lautgesetz gilt zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort und gilt nur für eine bestimmte Sprache oder einen bestimmten Dialekt. Daher unterlagen beispielsweise Wörter, die später in die russische Sprache gelangten, nicht mehr dem oben genannten Lautgesetz: akyn, kyzylbashi, Kyzylkum, kyyak, Hungnam(Stadt und Hafen in Korea), Gydansky(Bucht) usw. Während das Schallgesetz in Kraft ist, ist es lebendig. Ein Beispiel für ein lebendiges Klanggesetz ist das russische und weißrussische „akanie“, also der Ersatz Ö betonte Silbe auf a in einer unbetonten Silbe: Gewässer - Wasser, Beine- Naga.Über den Zeitraum von
Ende Seite 283
¯ Seitenanfang 284 ¯
Im Laufe der Zeit kann das aktuelle phonetische Gesetz historisch werden und seine Folgen in der Sprache hinterlassen: Lautverschiebungen, Phonemwechsel, Lautverlust usw.
Auch die Grammatik einer Sprache unterliegt historischen Veränderungen, die unterschiedlicher Natur sein können. Sie können das gesamte grammatikalische System als Ganzes und nur bestimmte grammatikalische Kategorien und Formen betreffen. In den romanischen Sprachen beispielsweise wich das frühere lateinische System der Deklination und Konjugation analytischen Formen des Ausdrucks grammatikalischer Bedeutungen mithilfe von Funktionswörtern und Wortreihenfolge. In der russischen Sprache im XIV.-XVII. Jahrhundert. Das verbale Zeitsystem wurde umgebaut – von acht alten auf drei neue. In der grammatikalischen Entwicklung finden auch analoge Veränderungen statt, die sich in der Angleichung einiger grammatikalischer Formen an andere äußern. So blieben in der Geschichte der russischen Sprache aufgrund der Wirkung des Analogiegesetzes anstelle der fünf alten Deklinationsarten drei Deklinationen übrig.
Ende Seite 284
LEHRBÜCHER UND TUTORIALS
1. Budagov R. A. Einführung in die Sprachwissenschaft. 2. Aufl. M., 1965.
2. Vendina T.I. Einführung in die Linguistik. M., 2001.
3. Golovin B.N. Einführung in die Linguistik. 4. Aufl. M., 1983.
4. Kodukhov V.I.
5. Maslov Yu.S. Einführung in die Linguistik. 2. Aufl. M., 1987.
6. Norman B.Yu., Pavlenko N.A. Einführung in die Linguistik. Leser. 2. Aufl. Mn., 1984.
7. Pavlenko N.A. Geschichte des Schreibens. 2. Aufl. Mn., 1987.
8. Reformatsky A.A. Einführung in die Linguistik. 5. Aufl. M., 1996.
9. Yakushkin B.V. Hypothesen über den Ursprung der Sprache. M., 1984.
SAMMLUNGEN VON PROBLEMEN UND ÜBUNGEN, METHODISCHE ANWEISUNGEN
1. Zinder L.R. Einführung in die Linguistik. Sammlung von Problemen. M., 1987.
2. Kalabina S.I. Workshop zur Lehrveranstaltung „Einführung in die Linguistik“. 2. Aufl. M, 1985.
3. Kodukhov V.I. Aufgaben für praktische Kurse und Tests zum Thema „Einführung in die Linguistik“. M., 1976.
4. Kondratov N.A., Koposov L.F., Ruposova L.P. Aufgaben- und Übungssammlung zur Einführung in die Linguistik. 2. Aufl. M., 1991.
5. Murat V.P. Einführung in die Linguistik. Methodische Anleitung. 6. Aufl. M., 1988.
6. Norman B.Y. Aufgabensammlung zur Einführung in die Linguistik. Mn., 1989.
7. Panov A.E. Einführung in die Linguistik. Prüfung, Aufgaben und Richtlinien Zu unabhängige Arbeit. M., 1984.
8. Peretruchin V.N. Einführung in die Linguistik. Leitfaden zur Bearbeitung des Kurses. M., 1984.
VERWEISE
1. Akhmanova O.S. Wörterbuch sprachlicher Begriffe. M., 1966.
2. Belarussisch Sprache Enzyklopädie/Pad-Hrsg. UND ICH. Michnewitsch. Mn., 1994.
3. Sprachlich Enzyklopädisches Wörterbuch. M., 1990.
4. Rosenthal D. E., Telenkova M. A. Wörterbuch-Nachschlagewerk sprachlicher Begriffe. 2. Aufl. M., 1976.
5. Russisch Sprache. Enzyklopädie. M., 1979.
Ende Seite 285
¯ Seitenanfang 286 ¯
Interne Gründe für die Sprachentwicklung (Serebrennikov):
1. Anpassung des Sprachmechanismus an physiologische Eigenschaften menschlicher Körper. Zum Beispiel eine Tendenz zur einfacheren Aussprache, eine Tendenz zur Vereinheitlichung grammatikalischer Wortformen, eine Tendenz zur Einsparung sprachlicher Mittel.
2. Die Notwendigkeit, den Sprachmechanismus zu verbessern. Beispielsweise werden im Entwicklungsprozess einer Sprache überflüssige oder ihre Funktion verlorene Ausdrucksmittel eliminiert.
3. Die Notwendigkeit, die Sprache in einem kommunikativen Zustand zu halten.
4. Lösung interner Widersprüche in der Sprache usw.
Aber nicht alle Wissenschaftler sind damit einverstanden, interne Ursachen zu akzeptieren. Denn Sprache ist ein soziales und psychophysiologisches Phänomen. Ohne solche Bedingungen kann es sich nicht entwickeln. Die Sprachentwicklung wird durch externe Faktoren gesteuert.
Externe Faktoren der Sprachentwicklung (Golovin, Berezin):
1. Bezogen auf die Entwicklung der Gesellschaft. Eine große Rolle spielt das Zusammenspiel verschiedener Völker, das durch Migration, Kriege etc. verursacht wird. Das Zusammenspiel von Sprachen und ihren Dialekten ist der wichtigste Impuls für ihre Entwicklung.
Es gibt zwei Arten der Interaktion zwischen Sprachen: Differenzierung und Integration.
Differenzierung– Divergenz von Sprachen und Dialekten aufgrund der Ansiedlung von Völkern über weite Gebiete.
Integration- Konvergenz verschiedener Sprachen. Es gibt drei Arten der Integration: Koexistenz, Vermischung und Kreuzung von Sprachen.
Koexistenz- Hierbei handelt es sich um eine langfristige und stabile gegenseitige Beeinflussung benachbarter Sprachen, wodurch sich in ihrer Struktur einige stabile Gemeinsamkeiten entwickeln.
Mischen- sich zu sprachlichen Gewerkschaften zusammenschließen. Im Gegensatz zur Koexistenz mischen- Dies ist eine Art gegenseitige Beeinflussung, wenn zwei Sprachen auf ihrem historischen Weg kollidieren, einen erheblichen Einfluss aufeinander haben und dann auseinandergehen und unabhängig voneinander weiter existieren.
Es gibt verschiedene Grade der Sprachverwirrung:
Einfacher Mischgrad. Hoch – beobachtet in hybriden Ersatzsprachen.
Unter Kreuzung versteht man die Überlagerung zweier Sprachen, bei der sich eine Sprache in der anderen auflöst. Das heißt, aus zwei Elternsprachen wird eine dritte geboren. Dies ist in der Regel das Ergebnis einer ethnischen Vermischung durch den Träger. Ein Volk absorbiert ein anderes. Dadurch geht der Übergang von einer Sprache zur anderen mit der Zweisprachigkeit einher.
Substrat und Superstrat.
Suspstrat- Elemente der Sprache eines besiegten Volkes in einer Sprache, die durch Kreuzung zweier anderer Sprachen transformiert wurde.
Superstrat– Elemente der Sprache der Gewinner, die in der dritten Sprache gebildet wurden.
Eine Vielzahl von Sprachen entwickelt sich. Sprachentwicklung in ihren verschiedenen Stadien:
1. Phonetisch-phonologische Veränderungen. Sie werden langsamer ausgeführt als die anderen. Die Faktoren werden maßgeblich durch das Sprachsystem bestimmt.
4 Arten von funktionellen Veränderungen: a) Die differenziellen Eigenschaften von Phonemen können sich ändern, wodurch sich die Zusammensetzung der Phoneme ändert (Verlust von Voratmung, Palatalität und Labialisierung – es bleiben 6 Phoneme übrig); b) Änderungen in der Kompatibilität von Phonemen. Beispielsweise ist das Prinzip der Klangsteigerung verschwunden – dadurch sind nun ungewöhnliche Phonemkombinationen möglich; c) Änderung oder Reduzierung von Phonemvarianten. Mit dem Aufkommen der Reduktion begannen beispielsweise Vokale auszufallen; d) individuelle Veränderungen in der spezifischen Sprache; alle Veränderungen ergeben sich aus der individuellen Sprache von Muttersprachlern.
Gründe für phonetische Veränderungen:
1. Systemfaktor – interne Logik der Systementwicklung (Assimilation – Verlust b,b, Schlusssilben usw.).
2. Artikulatorisch-akustische Bedingungen der Sprachaktivität (Nasenkonsonanten sind verschwunden).
3. Sozialer Faktor – hat den geringsten Einfluss, aber Veränderungen hängen auch von der sprechenden Person ab.
2. Änderungen in der Grammatik. Sie werden in größerem Maße nicht durch äußere Gründe, sondern durch den Einfluss systemischer Faktoren verursacht.
1. Eine Änderung der Form ist mit einer Änderung des Inhalts verbunden (viele Formen der Deklination sind verloren gegangen – jetzt ist das Geschlecht wichtig).
2. Analogieprozess ( Arzt– ursprünglich männlich, nun aber möglicherweise weiblich, d. h. die Kompatibilität hat sich geändert).
3. Verteilung der Funktionen zwischen ähnlichen Elementen (früher gab es ein verzweigtes Zeitsystem).
Das waren interne Faktoren.
Externe Faktoren: Durch die Interaktion zwischen Sprechern verschiedener Sprachen kann es zu einer Änderung der Grammatik kommen (durch das Eindringen von Elementen aus einer anderen Sprache). Externe Faktoren in b Ö Einfluss auf den Wortschatz haben.
3. Lexikalische Änderungen werden durch externe Gründe verursacht. Arten lexikalischer Änderungen:
1. Morphemische Ableitung – die Bildung eines neuen Wortes aus verfügbarem morphemischem Material (Computer+isierung).
2. Lexiko-semantische Ableitung:
a) die Bildung einer neuen Bedeutung eines Wortes durch Überdenken der alten;
b) die Entstehung eines neuen Wortes als Ergebnis des Überdenkens des vorherigen Wortes.
3. Lexiko-syntaktische Ableitung – eine Kombination von Wörtern „kreuzt“ sich zu einem (heute, sofort).
4. Komprimierung – Wörter kombinieren mit allgemeine Bedeutung gab es, aber die Bedeutung eines Wortes ging verloren, die Bedeutung der Phrase blieb durch das verbleibende Wort erhalten (Komplex - Minderwertigkeitskomplex).
5. Entlehnung – wenn ein Wort aus einer anderen Sprache entlehnt wird. Eine der Varianten ist das Tracing (morphemische Übersetzung) (Wolkenkratzer – Himmelsgebäude), eine andere Variante ist das semantische Tracing (wir übernehmen die Bedeutung des Wortes) (auf Französisch – Nagel – ein heller Anblick, daher: Höhepunkt des Programms).
6. Verlust eines Lexems – das Wort verlässt die Sprache.
7. Der Prozess der Archaisierung eines Wortes (verließ die Sprache) oder einer Bedeutung (godina).
8. Änderung der stilistischen oder semantischen Kennzeichnung eines Wortes.
9. Der Prozess der Entwicklung der Stabilität einzelner Lexemkombinationen.
10. Entwicklung der Idiomatik einzelner Lexemkombinationen (Bedeutungsintegrität und Nichtableitbarkeit aus den Bedeutungen der Komponenten) (Indian Summer – die warme Jahreszeit im Herbst).
Die Entwicklung der russischen Sprache wird sowohl von äußeren als auch von inneren Faktoren beeinflusst. Externe Faktoren in b Ö in größerem Maße aufgrund von Änderungen im Wortschatz und in geringerem Maße – in Phonetik und Grammatik.
Dabei ist zu beachten, dass es dem menschlichen Körper keineswegs gleichgültig ist, wie der Sprachmechanismus aufgebaut ist. Er versucht, auf alle im sprachlichen Mechanismus auftretenden Phänomene, die bestimmten Phänomenen nicht ausreichend entsprechen, auf eine bestimmte Weise zu reagieren physiologische Eigenschaften Körper. Dadurch entsteht eine ständige Tendenz des sprachlichen Mechanismus, sich an die Eigenschaften des menschlichen Körpers anzupassen, was praktisch in Tendenzen spezifischerer Art zum Ausdruck kommt. Hier finden Sie Beispiele Sprache ändert sich:
1) In der Phonetik: das Auftreten neuer Laute (zum Beispiel gab es in der frühen protoslawischen Sprache keine zischenden Laute: [zh], [h], [sh] – eher späte Laute in allen slawischen Sprachen, die als entstanden sind ein Ergebnis der Abschwächung der Laute [g], [ k], [x|); Verlust einiger Laute (zum Beispiel unterscheiden sich zwei zuvor unterschiedliche Laute nicht mehr: zum Beispiel stimmte der altrussische Laut, der mit dem alten Buchstaben % bezeichnet wird, in der russischen und weißrussischen Sprache mit dem Laut [e] überein, und im Ukrainischen - mit dem Laut [I], vgl. andere .-Russisch a&g, rus, Weißrussisch, Schnee, Ukrainisch сШг).
2) In der Grammatik: Verlust einiger grammatikalischer Bedeutungen und Formen (zum Beispiel hatten in der protoslawischen Sprache alle Namen, Pronomen und Verben außer Singular und Plural, auch Formen der Dualzahl, die verwendet wird, wenn von zwei Objekten gesprochen wird; später ging die Kategorie der Dualzahl in allen slawischen Sprachen außer Slowenisch verloren); Beispiele für den gegenteiligen Prozess: die Bildung (bereits in der geschriebenen Geschichte der slawischen Sprachen) einer speziellen verbalen Form – des Gerundiums; die Aufteilung eines bisher einzigen Namens in zwei Wortarten – Substantive und Adjektive; die Bildung einer relativ neuen Wortart in slawischen Sprachen – der Zahl. Manchmal ändert sich die grammatikalische Form, ohne dass sich die Bedeutung ändert: Früher sagte man „Städte, Schnee“, aber jetzt „Städte, Schnee“.
3) Im Wortschatz: zahlreiche und äußerst unterschiedliche Veränderungen im Wortschatz, in der Phraseologie und in der lexikalischen Semantik. Es genügt zu sagen, dass in der Veröffentlichung „Neue Wörter und Bedeutungen: Ein Wörterbuch-Nachschlagewerk zu Materialien der Presse und Literatur der 70er Jahre / Herausgegeben von N. Z. Kotelova“ SM., 1984. - VOB s), die nur die meisten enthielt Bemerkenswerte Innovationen aus zehn Jahren, etwa 5500 Wörterbucheinträge.
I. Tendenz zur einfacheren Aussprache.
Das Vorhandensein einer bekannten Tendenz zur einfacheren Aussprache in Sprachen wurde von Forschern wiederholt festgestellt. Gleichzeitig gab es Skeptiker, die dem Thema eher keine große Bedeutung beimaßen. Sie begründeten ihre Skepsis damit, dass die Kriterien für Leichtigkeit oder Schwierigkeit der Aussprache zu subjektiv seien, da sie normalerweise durch das Prisma einer bestimmten Sprache betrachtet würden. Was einem Sprecher einer Sprache aufgrund der Wirkung eines systemischen „phonologischen Synthesizers“ schwer auszusprechen erscheint, stellt für einen Sprecher einer anderen Sprache möglicherweise keine Schwierigkeiten dar. Auch Beobachtungen zur Entwicklungsgeschichte der phonetischen Struktur verschiedener Sprachen der Welt zeigen überzeugend, dass es in allen Sprachen relativ schwer auszusprechende Laute und Lautkombinationen gibt, nach denen jede Sprache nach Möglichkeit strebt , sich zu befreien oder sie in leichter auszusprechende Laute und Lautkombinationen umzuwandeln.
II. Tendenz, unterschiedliche Bedeutungen auszudrücken in verschiedenen Formen.
Die Tendenz, unterschiedliche Bedeutungen in unterschiedlichen Formen auszudrücken, wird manchmal als Homonymie-Voreingenommenheit bezeichnet.
Die arabische Sprache hatte in der älteren Ära ihrer Existenz nur zwei Verbformen – die perfekte Zeitform, zum Beispiel katabtu „ich schrieb“ und die unvollkommene aktubu „ich schrieb“. Diese Zeiten hatten zunächst eine besondere Bedeutung, waren jedoch nicht vorübergehend. Was ihre Fähigkeit betrifft, die Beziehung einer Handlung zu einem bestimmten Zeitplan auszudrücken, waren die oben genannten Zeitformen in dieser Hinsicht polysemantisch. So könnte das Imperfekt beispielsweise die Bedeutung von Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit haben. Diese Kommunikationsunannehmlichkeiten erforderten die Schaffung zusätzlicher Mittel. So trug zum Beispiel die Hinzufügung des Partikels qad zu den perfekten Formen zu einer klareren Abgrenzung des Perfekten selbst bei, zum Beispiel qad kataba „Er (hat) geschrieben.“ Das Anhängen des Präfixes sa- an Formen des Imperfekts, zum Beispiel sanaktubu „wir werden schreiben“ oder „wir werden schreiben“, ermöglichte es, die Zukunftsform klarer auszudrücken. Schließlich ermöglichte die Verwendung perfekter Formen des Hilfsverbs kāna „sein“ in Kombination mit unvollkommenen Formen, zum Beispiel kāna jaktubu „er schrieb“, das Präteritum klarer auszudrücken.
III. Die Tendenz, gleiche oder ähnliche Bedeutungen in einer Form auszudrücken.
Diese Tendenz manifestiert sich in einer Reihe weit verbreiteter Phänomene in verschiedenen Sprachen der Welt, die üblicherweise als analoge Ausrichtung von Formen bezeichnet werden. Wir können die beiden typischsten Fälle der Angleichung von Formen durch Analogie feststellen: 1) Angleichung von Formen, die in ihrer Bedeutung absolut identisch sind, sich aber im Aussehen unterscheiden, und 2) Angleichung von Formen, die sich im Aussehen unterscheiden und nur teilweise Ähnlichkeit in den Funktionen aufweisen oder Bedeutungen.
Wörter wie „Tisch“, „Pferd“ und „Sohn“ hatten im Altrussischen spezifische Endungen für den Instrumental-Dativ und den Präpositional-Plural.
D. Tafelpferdsohn
T. tischt Pferdesöhne auf
P. hundert Pferdesöhne
Im modernen Russisch haben sie eine gemeinsame Endung: Tabellen, Tabellen, Tabellen; Pferde, Pferde, Pferde; Söhne, Söhne, Söhne. Diese gemeinsamen Endungen entstanden durch die analoge Übertragung der entsprechenden Kasussendungen von Substantiven, die die alten Stämme in -ā, -jā repräsentieren, wie z. B. Schwester, Erde, vgl. andere Russen Schwestern, Schwestern, Schwestern; Länder, Länder, Länder usw. Für die Nivellierung durch Analogie erwies sich die Ähnlichkeit der Fallfunktionen als völlig ausreichend.
IV. Die Tendenz, klare Grenzen zwischen Morphemen zu schaffen.
Es kann vorkommen, dass die Grenze zwischen Stamm und Suffixen durch die Verschmelzung des Endvokals des Stammes mit dem Anfangsvokal des Suffixes nicht ausreichend deutlich wird. So war beispielsweise ein charakteristisches Merkmal der Deklinationstypen in der indogermanischen Basissprache die Beibehaltung des Basisdeklinationsparadigmas und dessen Besonderheit, d. h. der letzte Vokal des Stammes. Als Vergleichsbeispiel können wir das rekonstruierte Deklinationsparadigma des russischen Wortes Frau im Vergleich zum Deklinationsparadigma dieses Wortes im modernen Russisch anführen. Es werden nur Singularformen angegeben.
I. genā Frau
P. genā-s Ehefrauen
D. genā-i Frau
V. genā-m Frau
M. genā-i Frau
Es ist leicht zu erkennen, dass im Paradigma der Konjugation des Wortes Frau die bisherige Achse des Paradigmas – der Stamm auf -ā – aufgrund ihrer Modifikation in indirekten Fällen dadurch nicht mehr beibehalten wird<244>verschiedene phonetische Veränderungen, die in einigen Fällen zur Verschmelzung des Vokals des Stammes a mit dem Vokal des neu gebildeten Kasussuffixes führten, zum Beispiel genāi > gen > Frau, genām > geno > Frau usw. Um wiederherzustellen Als sich in den Köpfen der Sprecher klare Grenzen zwischen dem Wortstamm und dem Kasussuffix bildeten, kam es zu einer Neuzerlegung der Stämme, und der Laut, der zuvor als Endvokal des Stamms fungierte, wurde zu einem Suffix.
V. Tendenz, Sprachressourcen einzusparen.
Die Tendenz, Sprachressourcen einzusparen, ist eine der stärksten internen Tendenzen, die sich in verschiedenen Sprachen der Welt manifestieren. Das lässt sich a priori feststellen Globus Es gibt keine Sprache, die 150 Phoneme, 50 Zeitformen und 30 verschiedene Pluralendungen hat. Eine solche Sprache, belastet mit einem detaillierten Arsenal an Ausdrucksmitteln, würde die Kommunikation der Menschen nicht erleichtern, sondern im Gegenteil erschweren. Daher hat jede Sprache einen natürlichen Widerstand gegen übermäßige Details. Bei der Nutzung der Sprache als Kommunikationsmittel, oft spontan und unabhängig vom Willen der Sprecher selbst, wird der Grundsatz der möglichst rationalen und sparsamen Auswahl der für die Zwecke der Kommunikation wirklich notwendigen sprachlichen Mittel umgesetzt.
Die Ergebnisse dieses Trends zeigen sich in einer Vielzahl von Sprachbereichen. So kann beispielsweise eine Form des Instrumentalfalls verschiedene Bedeutungen haben: Instrumentalagent, Instrumentaladverbial, Instrumentalziel, Instrumentalbeschränkungen, Instrumentalprädikativ, Instrumentaladjektiv, Instrumentalvergleich usw. Der Genitivfall hat nicht weniger Reichtum an individuellen Bedeutungen: Genitiv quantitativ, Genitiv prädikativ, Genitivzugehörigkeit, Genitivgewicht, Genitivobjekt usw. Wenn jede dieser Bedeutungen in einer separaten Form ausgedrückt würde, würde dies zu einem unglaublich umständlichen Kasussystem führen.
Der Wortschatz der Sprache, der viele Zehntausende Wörter umfasst, wird geöffnet reichlich Möglichkeiten für die Umsetzung einer Vielzahl von Lauten und ihrer verschiedenen Schattierungen in die Sprache. In Wirklichkeit begnügt sich jede Sprache mit einer relativ kleinen Anzahl von Phonemen, die mit einer sinnvollen Funktion ausgestattet sind. Wie diese wenigen Funktionen isoliert sind, wurde nie untersucht. Moderne Phonologen untersuchen die Funktion von Phonemen, nicht jedoch ihre Entstehungsgeschichte. Man kann a priori nur annehmen, dass in diesem Bereich eine Art spontane rationale Selektion stattgefunden hat, die einem bestimmten Prinzip untergeordnet ist. In jeder Sprache gab es offensichtlich eine Auswahl eines Phonemkomplexes, der mit nützlicher Opposition verbunden war, obwohl das Auftreten neuer Laute in der Sprache nicht nur aus diesen Gründen erklärt werden kann. Mit dem Prinzip der Ökonomie scheint die Tendenz zur Bezeichnung verbunden zu sein identische Werte ein Formular.
Eine der auffälligsten Manifestationen der Tendenz zum Sparen ist die Tendenz zur Schaffung einheitlicher Standards. Jede Sprache ist ständig bestrebt, typische Einheitlichkeit zu schaffen.
VI. Tendenz, die Komplexität von Sprachnachrichten einzuschränken.
Neueste Forschungsergebnisse weisen darauf hin, dass es im Prozess der Sprachproduktion psychologische Faktoren gibt, die die Komplexität von Sprachbotschaften begrenzen.
Der Prozess der Spracherzeugung erfolgt aller Wahrscheinlichkeit nach durch die sequentielle Umkodierung von Phonemen in Morpheme, von Morphemen in Wörter und von Wörtern in Sätze. Auf einigen dieser Ebenen erfolgt die Neukodierung nicht im Langzeit-, sondern im menschlichen RAM, dessen Volumen begrenzt ist und 7 ± 2 Nachrichtensymbolen entspricht. Daher ist das maximale Verhältnis der Anzahl der Einheiten zum niedrigsten Sprachniveau, in einer Einheit mehr enthalten hohes Level, sofern der Übergang von der niedrigsten zur höchsten Ebene erfolgt Arbeitsspeicher, darf 9:1 nicht überschreiten.
Die Kapazität des RAM schränkt nicht nur die Tiefe, sondern auch die Länge der Wörter ein. Als Ergebnis einer Reihe sprachpsychologischer Experimente wurde festgestellt, dass bei einer Länge von Wörtern über sieben Silben hinaus eine Verschlechterung der Wahrnehmung der Botschaft zu beobachten ist. Aus diesem Grund nimmt die Wahrscheinlichkeit, dass Wörter in Texten vorkommen, mit zunehmender Länge stark ab. Diese Grenze der Wahrnehmung der Wortlänge wurde in Experimenten mit isolierten Wörtern festgestellt. Der Kontext erleichtert das Verständnis bis zu einem gewissen Grad. Die Obergrenze für die Wahrnehmung von Wörtern im Kontext liegt bei etwa 10 Silben.
Wenn wir die günstige Rolle des Kontexts – Intrawort und Interwort – bei der Worterkennung berücksichtigen, sollten wir damit rechnen, dass das Überschreiten der kritischen Wortlänge von 9 Silben, die durch die Menge des Arbeitsgedächtnisses bestimmt wird, ihre Wahrnehmung erheblich erschwert. Daten aus sprachpsychologischen Experimenten weisen eindeutig darauf hin, dass das Wahrnehmungsvolumen der Länge und Tiefe von Wörtern dem Volumen des menschlichen Arbeitsspeichers entspricht. Und in den Stilen natürlicher Sprachen, die sich auf die mündliche Kommunikation konzentrieren, maximale Länge Wörter dürfen nicht länger als 9 Silben sein und ihre maximale Tiefe beträgt 9 Morpheme.
VII. Die Tendenz, das phonetische Erscheinungsbild eines Wortes zu verändern, wenn es seine lexikalische Bedeutung verliert.
Diese Tendenz findet ihren deutlichsten Ausdruck im Prozess der Umwandlung eines bedeutungsvollen Wortes in ein Suffix. In der Tschuwaschischen Sprache gibt es beispielsweise einen Instrumentalfall, der durch das Suffix -pa, -pe gekennzeichnet ist, vgl. Tschuw. Pencilpa „Bleistift“, văype „Kraft“. Diese Endung entwickelte sich aus der Postposition palan, Schleier „c“
В английской разговорной речи вспомогательный глагол have в формах перфекта, утратив свое лексическое значение, фактически редуцировался до звука "v, а форма had - до звука "d, например, I"v written "Я написал", he"d written "он написал " usw.
Das phonetische Erscheinungsbild eines Wortes verändert sich bei häufig verwendeten Wörtern aufgrund einer Änderung ihrer ursprünglichen Bedeutung. Ein markantes Beispiel kann als nicht-phonetisches Verschwinden des letzten g im russischen Wort „Thanks“ dienen, was auf die Phrase „God save“ zurückgeht. Die häufige Verwendung dieses Wortes und die damit verbundene Veränderung der Bedeutung von Gott schütze > Danke führte zur Zerstörung seiner ursprünglichen phonetischen Erscheinung.
VIII. Die Tendenz besteht darin, Sprachen mit einer einfachen morphologischen Struktur zu schaffen.
In den Sprachen der Welt gibt es eine gewisse Tendenz zur Schaffung eines Sprachtyps, der sich durch die einfachste Art der Verbindung von Morphemen auszeichnet. Es ist merkwürdig, dass in den Sprachen der Welt die absolute Mehrheit Sprachen des agglutinierenden Typs sind. Sprachen mit interner Flexion sind relativ selten.
Diese Tatsache hat ihre eigenen spezifischen Gründe. In agglutinierenden Sprachen werden in der Regel Morpheme bezeichnet und ihre Grenzen im Wort definiert. Dadurch entsteht ein klarer Intra-Wort-Kontext, der es ermöglicht, Morpheme in den längsten Sequenzen zu identifizieren. Auf diesen Vorteil agglutinierender Sprachen hat einst I. N. Baudouin de Courtenay hingewiesen, der dazu folgendes schrieb: „Sprachen, in denen sich die gesamte Aufmerksamkeit in Bezug auf morphologische Exponenten auf die Affixe konzentriert, die dem Hauptmorphem (Wurzel) folgen ) (Ural-Altaische Sprachen, Finno-Ugrisch usw.) sind nüchterner und erfordern viel weniger mentalen Energieaufwand als Sprachen, in denen morphologische Exponenten Ergänzungen am Wortanfang, Ergänzungen am Ende eines Wortes sind und psychophonetische Wechsel innerhalb eines Wortes.“
Das Problem des Sprachwandels und der Sprachentwicklung
Wie jedes Phänomen der Realität steht auch die Sprache nicht still, sondern verändert und entwickelt sich. Veränderung ist eine dauerhafte Eigenschaft der Sprache. D. N. Ushakov bemerkte einmal: „... das Leben der Sprache besteht aus dieser Veränderung.“ Die Sprache verändert und entwickelt sich entsprechend ihrer inneren Logik, die dem Sprecher unbekannt bleibt. Beispielsweise beteiligten sich Sprecher nicht bewusst an der Bildung grammatikalischer Kategorien. All dies wurde gegen ihren Willen geschaffen, um den Bedürfnissen der Kommunikation, der Kenntnis der Realität, der Entwicklung von Sprache und Denken gerecht zu werden.
Jedes Phänomen hat seine eigene Form der Veränderung. Auch die Sprache hat diese Form der Veränderung. Die Art der Veränderung ist so, dass sie den Kommunikationsprozess nicht stört und daher für den Sprecher im Moment der Kommunikation die Sprache unverändert erscheint. Aber gleichzeitig ist es offensichtlich, dass es gerade im Prozess der Kommunikation zu Veränderungen kommen kann. Eine dysfunktionale Sprache ist tot. Es verändert oder entwickelt sich nicht.
Bei der Entwicklung der Sprache können interne und externe Faktoren unterschieden werden. Zu den internen Faktoren zählen Kontinuität und Innovation.
Die Entwicklung sprachlicher Phänomene ist durch Kontinuität gekennzeichnet. Um ein Element zu ersetzen (und in einem sich verändernden System läuft die Veränderung selbst auf den Ersatz eines Elements durch ein anderes hinaus), muss es bis zu einem gewissen Grad dasselbe sein. Aber jede Einheit hat ihre eigene Besonderheit und kann daher nicht mit einer Ersatzeinheit gleichgesetzt werden. Diese beiden Merkmale – Identität und Differenz innerhalb der Identität – erweisen sich für die Entwicklung des Systems als notwendig. Solche Paralleleinheiten können historisch existieren lange Zeit(zum Beispiel in Form von Varianten, Synonymie). Somit ist Veränderung einer der internen Faktoren in der Sprachentwicklung.
Veränderung steht im Gegensatz zu Innovation. Während Veränderung Kontinuität und Divergenz voraussetzt, setzt Innovation diese nicht voraus. Innovation ist individueller Natur (z. B. Neologismen des Autors, individuelle Bildsprache, Schlagworte, ungewöhnliche Wortkombinationen). Innovation kann zu einer sprachlichen Tatsache werden, wenn sie den Bedürfnissen der sprechenden Gemeinschaft und den Trends in der Sprachentwicklung entspricht.
Neben internen Faktoren der Sprachentwicklung, die vor allem durch die sehr kreative Natur der sprachlichen Kommunikation bestimmt werden, gibt es jedoch externe Faktoren des Sprachwandels, die mit der Entwicklung der Gesellschaft selbst verbunden sind.
Frühe Formen moderner Mann entwickelte sich unter den günstigen klimatischen Bedingungen der Erde - im Mittelmeerraum (Auslandasien, Südosteuropa, Nordafrika). Die unbewohnten Gebiete Eurasiens und die niedrige Arbeitsproduktivität erzwingen primitive Menschenüber das Festland verteilt. Der Übergang zu einem anderen Klima, neue Arbeitsbedingungen, neue Lebensmittel, neue Lebensbedingungen spiegelten sich jeweils in den Sprachen wider. So begann die Sprachgeschichte der Menschheit mit einer Vielzahl von Stammesdialekten. Im Laufe der Zeit vereinten und trennten sie sich. In der Entwicklung der Sprachen sind folgende Trends zu beobachten:
· Sprache im Allgemeinen und bestimmte Sprachen entwickeln sich historisch. In ihrer Entwicklung gibt es keine Geburts-, Reifungs-, Blüte- und Niedergangsperioden.
· Entwicklung und Wandel der Sprache erfolgen durch die Fortführung der Existenz der frühen Sprache und ihrer Modifikationen (das Tempo des Wandels in verschiedenen Epochen ist nicht gleich).
· Verschiedene Seiten der Zunge entwickeln sich ungleichmäßig. Die Sprachebenen bestehen aus heterogenen Einheiten, deren Schicksal mit einer Vielzahl von Faktoren zusammenhängt.
Im Prozess der historischen Entwicklung der Sprachen lassen sich zwei Hauptrichtungen unterscheiden: Differenzierung (Teilung) der Zunge Und Integration (Vereinigung) der Sprachen. Differenzierung und Integration sind zwei gegensätzliche Prozesse. Dabei handelt es sich um soziale Prozesse, da sie oft durch wirtschaftliche und politische Gründe erklärt werden.
Differenzierung- Dies ist die territoriale Aufteilung einer Sprache, wodurch verwandte Sprachen und Dialekte entstehen. Durch Differenzierung erhöht sich die Anzahl der Sprachen. Dieser Prozess herrschte unter dem primitiven Kommunalsystem. Die Suche nach Nahrung und Schutz vor Naturgewalten führte zur Wanderung der Stämme und ihrer Ansiedlung entlang von Wäldern, Flüssen und Seen. Die räumliche Trennung der Stämme führte zu Sprachunterschieden. Sprachen, die auf eine gemeinsame Quelle zurückgehen, behalten jedoch gemeinsame Wurzeln, gemeinsame Suffixe und Präfixe sowie gemeinsame phonetische Muster . Präsenz in der Vergangenheit gemeinsame Sprache ist ein Beweis gemeinsamer Ursprung Völker Trotz der territorialen Sprachunterschiede behielten die Stämme bei Treffen der Stammesräte und an Tagen gemeinsamer Feierlichkeiten eine gemeinsame Sprache bei.
Ein wichtiger Bestandteil der Sprachgeschichte der Menschheit ist die Entstehung und Verbreitung Indogermanisch Sprachen. Vom 4. bis 3. Jahrhundert. Chr. Es wurden drei Zonen identifiziert Indogermanische Sprachen: südlich (die Sprache des antiken Italiens und die Sprachen Kleinasiens), zentral (romanische Sprachen, Germanisch, Albanisch, Griechisch und Indoiranisch) und nördlich (slawische Sprachen).
Die nördliche Zone wurde von slawischen Stämmen vertreten. In diesem historischen Moment sprachen sie Gemeinslawisch (Protoslawisch) Sprache. Die gemeinsame slawische Sprache existierte seit der zweiten Hälfte des ersten Jahrtausends v. Chr. bis 7. Jahrhundert n. Chr Es wurde von den Vorfahren der modernen Tschechen, Slowaken, Polen, Bulgaren, Jugoslawen, Russen, Ukrainer und Weißrussen gesprochen. Kontinuierliche Kommunikation zwischen den Völkern unterstützt Gemeinsamkeiten in der Sprache, aber im 6. – 7. Jahrhundert. Slawische Stämme besiedelten weite Gebiete: vom Ilmensee im Norden bis nach Griechenland im Süden, von der Oka im Osten bis zur Elbe im Westen. Diese Ansiedlung der Slawen führte zur Entstehung drei Gruppen Slawische Sprachen: Osten, Westen und Süden. Zu den Ostslawen gehörten die Vorfahren der modernen Russen, Ukrainer und Weißrussen. Die Westslawen sind die Vorfahren der modernen Tschechen, Slowaken und Polen. Die Südslawen sind die Vorfahren der modernen Bulgaren und Jugoslawen.
Vom 9. – 10. Jahrhundert. die dritte – Hauptetappe in der Geschichte der Sprachen beginnt – Bildung Landessprachen. Die Sprachen der Nationalitäten wurden während der Sklavenzeit gebildet, als die Vereinigung der Menschen nicht stattfand Familienbande, sondern indem sie im selben Gebiet leben. Im Jahr 882 Fürst Oleg von Nowgorod eroberte Kiew und machte es zur Hauptstadt der Kiewer Rus. Die Kiewer Rus trug zur Umwandlung der ostslawischen Stämme in ein einziges Volk bei – das altrussische Volk mit eigener Sprache.
So entstand auf der Grundlage der Vereinigung der ostslawischen Stämme das altrussische Volk.
Die altrussische Sprache wies jedoch dialektale Unterschiede auf, die aus der gemeinsamen slawischen Ära stammten. Mit dem Fall Kiews und der Entwicklung feudaler Beziehungen nehmen die Dialektunterschiede zu und es bilden sich drei Nationalitäten: Ukrainisch, Weißrussisch und Großrussisch – mit eigenen Sprachen.
Wenn im Kapitalismus eine wirtschaftliche Konsolidierung von Territorien stattfindet und ein Binnenmarkt entsteht, verwandelt sich eine Nationalität in eine Nation. Die Sprachen der Nationalitäten werden zu eigenständigen Nationalsprachen. Es gibt keine grundsätzlichen Unterschiede zwischen der Struktur der Sprache einer Nationalität und der Sprache einer Nation. Nationalsprachen verfügen über einen umfangreicheren Wortschatz und eine fortgeschrittenere grammatikalische Struktur. Während der nationalen Periode führt die wirtschaftliche Vereinigung der Gebiete zur weiten Verbreitung einer gemeinsamen Sprache und zur Beseitigung von Dialektunterschieden. Das Hauptmerkmal der Landessprache besteht darin, dass sie eine schriftliche und literarische Form voraussetzt, die der Umgangssprache nahe kommt. Auch die Sprache des Volkes hatte eine schriftliche Form, allerdings hauptsächlich zu Verwaltungszwecken. Eine Landessprache erfordert nicht nur eine schriftliche Form, sondern auch ihre weite Verbreitung.
Integration kommt es auf die soziale Interaktion zwischen verschiedenen Staaten an, die Sprachkontakte erweitert und vertieft. Zu den Sprachkontakten (Integration) gehören:
· Kreuzung Sprachen, in denen sich einer als Sieger und der andere als Besiegter herausstellt. Kreuzungen fanden in den frühen Stadien der menschlichen Entwicklung statt, als einige Völker andere eroberten. Darüber hinaus ist die Natur der Sprache oder der Vorteil ihrer bildlichen Bedeutung Ausdrucksmittel. Da es nicht wirklich Sprachen sind, die miteinander in Kontakt stehen, sondern Menschen, siegt die Sprache der Menschen, die politisch und kulturell vorherrscht.
Basierend auf der Rolle, die Sprachen bei solchen Kontakten spielen, ist es üblich, zu unterscheiden: Substrat- Spuren der Sprache der indigenen Bevölkerung, die durch den Kontakt mit der Sprache der Außerirdischen zerstört wurde, aber einige ihrer Elemente in ihrem System beließ. So verschwindet eine der Kontaktsprachen vollständig, die andere entwickelt sich und absorbiert Elemente der Sprache der verschwundenen Sprache.
Superstrat- das sind Spuren der fremden Sprache, die die Sprache der lokalen Bevölkerung beeinflusste, ihr System aber nicht zerstörte, sondern nur bereicherte. Auf dem Territorium des modernen Frankreichs lebte beispielsweise eine indigene Bevölkerung – die Gallier. Bei der Eroberung Galliens durch die Römer kam es zu einer Kreuzung der gallischen Sprache mit der lateinischen Sprache. Das Ergebnis dieser Kreuzung war die moderne französische Sprache. Spuren der gallischen Sprache im Französischen gelten als Substratum, Spuren Lateinische Sprache auf Französisch - Superstrat. Auf die gleiche Weise wurde Latein in den ehemaligen römischen Provinzen Iberia und Dacia eingeführt.
Fälle von Sprachkreuzungen sind von Entlehnungen aus anderen Sprachen zu unterscheiden. Bei der Entlehnung ändern sich die grammatische Struktur der Sprache und der Grundwortschatz nicht. Bei der Kreuzung von Sprachen kommt es zunächst zu einer Veränderung der Phonetik und Grammatik der Sprache.
· Auf den Grenzgebieten von Staaten ist eine Beobachtung möglich adstratieren Hierbei handelt es sich um eine Art Sprachkontakt, bei dem Elemente zweier benachbarter Sprachen einander durchdringen. Das Adstrate-Phänomen tritt bei langfristiger Zweisprachigkeit in Grenzgebieten auf. Zum Beispiel Elemente Polnische Sprache auf Weißrussisch (und umgekehrt) an der weißrussisch-polnischen Grenze; Elemente der türkischen Adstrat in Balkansprachen.
Adstrat ist eine neutrale Art der sprachlichen Interaktion. Sprachen lösen sich nicht ineinander auf, sondern bilden eine Schicht untereinander.
· Im Prozess der Sprachkontakte, Sprachgewerkschaften. Dabei handelt es sich um eine Vereinigung sowohl verwandter als auch nicht verwandter Sprachen, die nicht aufgrund von Verwandtschaft, sondern aufgrund der territorialen Isolation der Völker und infolgedessen einer historischen, wirtschaftlichen und kulturellen Gemeinschaft entstanden ist. Eine Sprachunion ist eine Gruppe von Sprachen mit Ähnlichkeiten vor allem in der grammatikalischen Struktur (Morphologie und Syntax), mit einem gemeinsamen Fundus an „kulturellen“ Wörtern, die jedoch nicht durch ein System von Lautkorrespondenzen verbunden sind, und mit Ähnlichkeiten im elementaren Wortschatz. IN moderne Welt wohlbekannt Balkan-Sprachunion. Es umfasst verwandte Sprachen: Bulgarisch, Mazedonisch – und nicht verwandte Sprachen: Albanisch, Rumänisch und Neugriechisch. Diese Sprachen haben gemeinsame grammatikalische Merkmale, die nichts mit ihrer Verwandtschaft zu tun haben.
1. Ursachen und Mechanismen interne Veränderungen in der Sprache
2. Erklärende Theorien interner historischer Sprachveränderungen
a) Systemdrucktheorie
b) Theorie der probabilistischen Sprachentwicklung
c) Innovationstheorie
d) Theorie der Widersprüche (Antinomien).
Rubert I.B. Analytische Tendenz in der Sprachentwicklung // Philologische Wissenschaften. 2003, Nr. 1, S. 54–62.
Tumanyan G. Zur Natur sprachlicher Veränderungen // Fragen der Linguistik. 1999, Nr. 5.
Nikolaeva T.M. Diachronie oder Evolution? Zu einem Trend in der Sprachentwicklung // Fragen der Linguistik. 1991, Nr. 2, S. 12–26.
Kasatkin L.L. Einer der Trends in der Entwicklung der Phonetik der russischen Sprache // Fragen der Linguistik. 1989, Nr. 6.
Die Theorie der Sprachentwicklung wird unter Berücksichtigung der folgenden Konzepte diskutiert: Dynamik, Veränderung, Entwicklung, Evolution, die die Aufmerksamkeit auf verschiedene Aspekte (Details) des Sprachwandels im Laufe der Zeit lenken.
Dynamik scheint einer davon zu sein wichtige Eigenschaften Sprachsystem. Dieses Merkmal der Sprache zeigt sich in ihrer Fähigkeit, sich zu entwickeln und zu verbessern.
Das Sprachsystem ist ein selbstorganisierendes System, dessen Transformationsquelle meist im System selbst liegt.
Opposition – minimale Organisation eines paradigmatischen Schnitts, Systems (Beispiel: Wind – Hurrikan (seine Elemente stehen in Wahlbeziehungen)).
(Paradigmatik) Wind: Hurrikan ( Epidigmatik) Hurrikan, ( Syntagmatik) Hurrikanwind
Hurrikan = Orkanwind
Es gibt Elemente, die Redundanz erzeugen (Dublettformen).
Der Wunsch nach Motivation und der Wunsch, Semantik durch die Struktur des Wortes aufzudecken.
Welche internen Faktoren bestimmen die Entwicklung des Sprachsystems:
1. organische Verbindung der Sprache mit dem Denken;
2. die Struktur des Sprachsystems, die ein sehr reichhaltiges Potenzial für die Aktualisierung von Sprachwerkzeugen bietet.
Dies liegt daran, dass sprachliche Einheiten kombinatorischer Natur sind und die kombinatorischen Fähigkeiten der Sprache nur teilweise ausgeschöpft werden. Daher ist die Bildung neuer Wörter ein elementarer Vorgang, der vom Sprachsystem selbst erzeugt wird (aus einfacheren Einheiten entstehen komplexere).
(Paradigmatik) Regen: Regen regnet wie ein Regenguss Regenschauer
Dusche
Sprachanreicherung erfolgt im Prozess der Variation sprachlicher Einheiten, die ebenfalls eine organische Eigenschaft des Sprachsystems sind.
Äußere und innere Faktoren in der Sprachentwicklung offenbaren die Dialektik von Notwendigkeit und Möglichkeit. Äußere Faktoren erfordern Veränderungen in der Sprache und eine Anreicherung der Mittel, und innere Faktoren bestimmen, wie diese Mittel aussehen werden.
Daher gibt es im mit der Raumfahrt verbundenen Vokabular folgende Einheiten:
A. Das Ergebnis der Kombination von Morphemen (Mond)
B. Das Ergebnis der Kombination von Nominativphrasen ( Raumschiff)
C. Das Ergebnis semantischer Variation (sanfte Landung).
Bei der Betrachtung des Themas (Problems) der Sprachentwicklung stellt sich die Frage, warum Entwicklung stattfindet, welches Gesetz der Sprachentwicklung zugrunde liegt.
Widerspruch ist die Hauptquelle der Entwicklung.
Sprache entwickelt sich durch die Überwindung einer Reihe von Widersprüchen:
1. Widerspruch im Verhältnis von Sprache und Gesellschaft;
2. Widerspruch in der Sprachaktivität;
3. Widersprüche innerhalb des Systems;
4. Widersprüche innerhalb einer Person als Muttersprachler.
Es werden Widersprüche genannt, die nicht endgültig überwunden werden können Antinomien .
Nachdem sie in einem bestimmten Stadium der Systementwicklung gelöst wurden, treten sie sofort wieder auf.
Die Theorie der Antinomien wurde erfolgreich auf die Analyse von Veränderungen im russischen Wortschatz angewendet (Monographie „Russische Sprache und sowjetische Gesellschaft: Wortschatz der modernen russischen Sprache“ von 1968).
Widersprüche im Verhältnis von Sprache und Gesellschaft werden durch 4 Antinomien realisiert:
1. Aktuelle Innovation als Ergebnis der Anforderung einer Norm, die die Sprache in Schach hält und nicht zulässt, dass sie sich entwickelt.
2. Ausdruckskraft und Ausdruckskraft, sie stehen im Gegensatz zur Standardisierung der Sprache.
3. Die Sprache muss stilistisch vielfältig sein, dem steht die Einheitlichkeit des Vokabulars zwischen den Stilen gegenüber.
4. Sparsamkeit (Streben nach Sparsamkeit), aber gleichzeitig mäßige Entlassung
Die Entwicklung der Sprache wird durch den Wunsch der Sprecher bestimmt, den Gebrauch sprachlicher Einheiten zu stabilisieren, und durch die Unfähigkeit, dies zu tun. Die Norm schränkt den Gebrauch von Sprache und deren Kombination ein. Und die lebendigen Bedürfnisse der Kommunikation überwinden die normativen Beschränkungen der Sprache und nutzen ihr Potenzial. In diesem Zusammenhang werden die normativen Formulierungen „Sinn haben“, „eine Rolle spielen“ frei transformiert.
Sprache und Denken
Bei der Betrachtung dieses schwierigen Problems, der Beziehung zwischen Sprache und Denken, werden drei Ansätze umgesetzt:
- erkenntnistheoretisch,
- psychologisch,
- neurophysiologisch.
Erkenntnistheoretischer Ansatz wird im Rahmen der Beziehung logischer Einheiten zu sprachlichen Einheiten betrachtet (diese Einheiten sind unterschiedlich, aber korreliert), wie Wort und Begriff, Satz und Urteil.
Psychologischer Ansatz enthüllt das Zusammenspiel von Sprache und Denken im Prozess der Sprachaktivität von Personen, die eine bestimmte Sprache sprechen. In diesem Zusammenhang sind Beobachtungen der Sprachentwicklung eines Kindes und Beobachtungen der sprachlichen Denkaktivität eines Zweisprachigen wertvoll. Die Beobachtung der Sprache des Kindes führte zu wertvollen theoretischen Ergebnissen:
1. Die kognitiven Fähigkeiten des Kindes sind ihm voraus Sprachentwicklung;
2. Es gibt nonverbale Denkweisen;
3. Es besteht kein zwingender Zusammenhang zwischen kognitiver Aktivität und ihr Sprachaktivität;
4. Der Prozess der Sprachbildung durchläuft bestimmte Phasen;
5. Die Sprache, die ein Kind als System seiner Konzepte beherrscht, entsteht im Prozess der intellektuellen Entwicklung als Ergebnis der Handlungen des Kindes Umfeld;
6. Die Intelligenz eines Kindes beginnt mit der Tat.
Für das Verständnis, wie Sprache im menschlichen Gehirn existiert, sind zwei Aspekte des Spracherwerbs relevant:
- frühzeitiger Erwerb einer anderen Sprache durch eine Person,
- wenn ein Kind im Alter von 11 bis 19 Jahren eine zweite Sprache erlernt.
Durch den Einsatz von Geräten wurde entdeckt, dass das Sprachzentrum bei frühen Zweisprachigen im selben Teil, im Broca-Bereich, fixiert ist.
Neurophysiologischer Ansatz sucht nach Wegen, Sprache und Denken auf physiologischer Basis zu identifizieren.
1. Die Neurolinguistik beschäftigt sich mit der Entdeckung funktioneller Gebilde des Gehirns, die den Erwerb und die Nutzung von Spracheinheiten gewährleisten. Bei diesem Ansatz werden die Funktionen beider Hemisphären bestimmt. Es wurden Unterschiede in der Entwicklung dieser Hemisphären bei Männern und Frauen festgestellt.
2. Die Neurolinguistik versucht zu verstehen, wie abstraktes Denken entsteht.
3. Die Neurolinguistik interessiert sich dafür, wie Spracheinheiten im Gehirn gespeichert werden.
Bei der Verwendung von Vokalen und Konsonanten sind unterschiedliche Mechanismen beteiligt, was deutlich macht, dass Konsonanten später erscheinen als Vokale.
Das wichtigste und schwierigste Problem beim Studium der Sprache und des Denkens ist die Antwort auf die Frage: Ist alles menschliche Denken mit der Sprache verbunden? Wie hilft Sprache beim Denken, und wenn es diese Hilfe gibt, welche Wirkung tritt dann bei diesem auf Sprache basierenden Prozess auf?
Bei der Klärung dieser Frage wird ein Zusammenhang zwischen hergestellt verschiedene Formen Denken und die Beteiligung der Sprache an diesem Prozess.
Praktisches Denken wird wortlos ausgedrückt, kann aber einen sprachlichen Ausdruck haben.
Der Mensch denkt nicht in einer Landessprache, sondern anhand eines universellen Subjektcodes.
Es gibt kein außersprachliches Denken, jedes Denken erfolgt auf der Grundlage der Sprache, aber es gibt wortloses Denken.
Innere Rede
Das wichtigste Element des Denk-Sprachsystems ist die innere Sprache, in der Denken und Sprache zu einem integralen Komplex zusammengefasst werden, der als Sprachmechanismus des Denkens fungiert.
· Im inneren Sprechen entsteht die Bedeutung durch die Einheit von Wort und Gedanke.
· Innere Sprache hat eine besondere Struktur und Qualität und unterscheidet sich von äußerer Sprache.
· Innere Sprache ist Sprache, die hauptsächlich aus Prädikaten besteht.
· Die innere Sprache ist verdichtet, sie ist grammatikalisch.