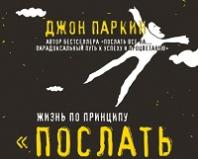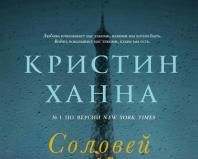Sp natürliche und künstliche Beleuchtung. Anforderungen an die Beleuchtung von Industriegebäuden
Bevor Sie eine elektronische Beschwerde an das russische Bauministerium senden, lesen Sie bitte die unten aufgeführten Betriebsregeln für diesen interaktiven Dienst.
1. Elektronische Bewerbungen im Zuständigkeitsbereich des russischen Bauministeriums, die gemäß dem beigefügten Formular ausgefüllt werden, werden zur Prüfung angenommen.
2. Eine elektronische Beschwerde kann eine Stellungnahme, eine Beschwerde, einen Vorschlag oder eine Anfrage enthalten.
3. Elektronische Beschwerden, die über das offizielle Internetportal des russischen Bauministeriums gesendet werden, werden der Abteilung für die Bearbeitung von Bürgerbeschwerden zur Prüfung vorgelegt. Das Ministerium gewährleistet eine objektive, umfassende und zeitnahe Prüfung der Anträge. Die Prüfung elektronischer Einsprüche ist kostenlos.
4. In Übereinstimmung mit dem Bundesgesetz vom 2. Mai 2006 N 59-FZ „Über das Verfahren zur Prüfung von Bürgerbeschwerden“. Russische Föderation„Elektronische Einsprüche werden innerhalb von drei Tagen registriert und je nach Inhalt versandt.“ Struktureinheiten Ministerien. Der Einspruch wird innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum der Registrierung geprüft. Elektronischer Einspruch, das Fragen enthält, deren Lösung nicht in die Zuständigkeit des russischen Bauministeriums fällt, wird innerhalb von sieben Tagen ab dem Datum der Registrierung an die zuständige Stelle oder den zuständigen Beamten gesendet, zu dessen Zuständigkeit die Lösung der in der Beschwerde aufgeworfenen Fragen gehört Benachrichtigung darüber an den Bürger, der die Beschwerde eingereicht hat.
5. Eine elektronische Beschwerde wird nicht berücksichtigt, wenn:
- Fehlen des Vor- und Nachnamens des Antragstellers;
- Angabe einer unvollständigen oder unzuverlässigen Postanschrift;
- das Vorhandensein obszöner oder beleidigender Ausdrücke im Text;
- das Vorhandensein einer Bedrohung für das Leben, die Gesundheit und das Eigentum eines Beamten sowie seiner Familienangehörigen im Text;
- beim Tippen ein nicht-kyrillisches Tastaturlayout oder nur Großbuchstaben verwenden;
- Fehlen von Satzzeichen im Text, Vorhandensein unverständlicher Abkürzungen;
- das Vorhandensein einer Frage im Text, auf die der Antragsteller im Zusammenhang mit zuvor eingereichten Beschwerden bereits schriftlich in der Sache beantwortet wurde.
6. Die Antwort an den Antragsteller wird an die beim Ausfüllen des Formulars angegebene Postadresse gesendet.
7. Bei der Prüfung einer Berufung ist die Offenlegung der in der Berufung enthaltenen Informationen sowie von Informationen über das Privatleben eines Bürgers ohne dessen Zustimmung nicht gestattet. Informationen über personenbezogene Daten von Bewerbern werden in Übereinstimmung mit den Anforderungen der russischen Gesetzgebung zu personenbezogenen Daten gespeichert und verarbeitet.
8. Über die Website eingegangene Einsprüche werden zusammengefasst und der Leitung des Ministeriums zur Information vorgelegt. Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen werden regelmäßig in den Rubriken „für Bewohner“ und „für Spezialisten“ veröffentlicht.
Moskau
Nach Genehmigung von SP 52.13330 „SNiP 23-05-95*
Natürlich und künstliches Licht»
In Übereinstimmung mit den Regeln für die Entwicklung, Genehmigung, Veröffentlichung, Änderung und Aufhebung von Regelwerken, genehmigt durch das Dekret der Regierung der Russischen Föderation vom 1. Juli 2016 Nr. 624, Unterabsatz 5.2.9 von Absatz 5 der Verordnungen über das Ministerium für Bauwesen, Wohnungswesen und kommunale Dienstleistungen der Russischen Föderation, genehmigt durch den Beschluss der Regierung der Russischen Föderation vom 18. November 2013 Nr. 1038, Abschnitt 42 des Plans für die Entwicklung und Genehmigung von Regelwerken und deren Aktualisierung zuvor genehmigte Regelwerke, Bauvorschriften und Regeln für 2015 und den Planungszeitraum bis 2017, genehmigt durch Beschluss des Ministeriums für Bau- und Wohnungswesen und kommunale Dienstleistungen der Russischen Föderation vom 30. Juni 2015 Nr. 470/pr, geändert durch Beschluss des Ministeriums für Bau- und Wohnungswesen und Kommunaldienstleistungen der Russischen Föderation vom 14. September 2015 Nr. 659/pr, ich bestelle:
1. Genehmigen und in Kraft setzen 6 Monate ab dem Datum der Veröffentlichung dieser Verordnung SP 52.13330 „SNiP 23-05-95* Natürliche und künstliche Beleuchtung“, gemäß Anhang.
2. Ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens von SP 52.13330 „SNiP 23-05-95* Natürliche und künstliche Beleuchtung“, SP 52.13330.2011 „SNiP 23-05-95* Natürliche und künstliche Beleuchtung“, genehmigt auf Anordnung des Ministeriums der Regionalentwicklung der Russischen Föderation wird als nicht antragspflichtig anerkannt. Föderation vom 27. Dezember 2010 Nr. 783.
3. Das Ministerium für Stadtplanung und Architektur sendet innerhalb von 15 Tagen nach Erteilung der Bestellung das genehmigte SP 52.13330 „SNiP 23-05-95* Natürliche und künstliche Beleuchtung“ zur Registrierung beim nationalen Normungsgremium der Russischen Föderation Föderation.
4. Die Abteilung für Stadtplanung und Architektur sorgt für die Veröffentlichung des Textes des genehmigten SP 52.13330 „SNiP 23-05-95* Natürliche und künstliche Beleuchtung“ auf der offiziellen Website des russischen Bauministeriums im Internet-Informations- und Telekommunikationsnetz ” in elektronischer digitaler Form innerhalb von 10 Tagen ab dem Datum der Registrierung eines Regelwerks durch das nationale Normungsgremium der Russischen Föderation.
5. Die Kontrolle über die Umsetzung dieser Verordnung liegt beim stellvertretenden Minister für Bauwesen, Wohnungswesen und kommunale Dienstleistungen der Russischen Föderation Kh.D. Mavliyarova.
| Und über. Minister | E.O. Sierra |
| MINISTERIUM FÜR BAU |
|
| REGELWERK | SP 52.13330.2016 |
NATÜRLICH UND KÜNSTLICH
BELEUCHTUNG
Aktualisierte Ausgabe
SNiP 23-05-95*
Moskau 2016
Details zum Regelwerk
1 DURCHFÜHRER - Landeshaushaltseinrichtung „Forschungsinstitut für Bauphysik“ Russische Akademie Architektur- und Bauwissenschaften“ (NIISF RAASN) und Gesellschaft mit beschränkter Haftung „CERERA-EXPERT“ (LLC „CERES-EXPERT“)
2 EINGEFÜHRT vom Technischen Komitee für Normung TC 465 „Konstruktion“
3 VORBEREITET zur Genehmigung durch die Abteilung für Stadtentwicklung und Architektur des Ministeriums für Bauwesen, Wohnungswesen und kommunale Dienstleistungen der Russischen Föderation (Ministerium für Bauwesen Russlands)
4 GENEHMIGT durch Beschluss des Ministeriums für Bauwesen, Wohnungswesen und kommunale Dienstleistungen der Russischen Föderation vom 7. November 2016 Nr. 777/pr und in Kraft gesetzt am 8. Mai 2017.
5 REGISTRIERT Bundesbehördeüber technische Regulierung und Messtechnik (Rosstandart). Überarbeitung von SP 52.13330.2011 „SNiP 23-05-95* Natürliche und künstliche Beleuchtung“
Im Falle einer Überarbeitung (Ersetzung) oder Aufhebung dieses Regelwerks wird die entsprechende Bekanntmachung in der vorgeschriebenen Weise veröffentlicht. Auch relevante Informationen, Hinweise und Texte werden im Informationssystem eingestellt allgemeiner Gebrauch- auf der offiziellen Website des Entwicklers (Bauministerium Russlands) im Internet.
Dieses Regulierungsdokument darf ohne Genehmigung des russischen Bauministeriums weder ganz noch teilweise reproduziert, vervielfältigt und als offizielle Veröffentlichung auf dem Territorium der Russischen Föderation verbreitet werden
Einführung
Dieses Regelwerk enthält Anforderungen, die den Zielen des Bundesgesetzes Nr. 384-FZ vom 30. Dezember 2009 entsprechen. Technische Vorschriftenüber die Sicherheit von Gebäuden und Bauwerken“ und unterliegen der zwingenden Einhaltung unter Berücksichtigung von Teil 1 von Artikel 46 des Bundesgesetzes vom 27. Dezember 2002 Nr. 184-FZ „Über technische Vorschriften“, Bundesgesetz vom 23. November 2009 Nr. 261-FZ „Über Energieeinsparung und Steigerung der Energieeffizienz sowie über die Einführung von Änderungen an bestimmten Rechtsakten der Russischen Föderation.“
Das Regelwerk legt Standards für die natürliche, künstliche und kombinierte Beleuchtung von Gebäuden und Bauwerken sowie Standards für die künstliche Beleuchtung von Wohngebieten, Betriebsgeländen und Arbeitsstätten außerhalb von Gebäuden fest.
Die Aktualisierung wurde von einem Autorenteam durchgeführt: der staatlichen Haushaltsinstitution „Forschungsinstitut für Bauphysik der Russischen Akademie für Architektur und Bauwissenschaften“ (Ph.D. I.A. Schmarow, Ph.D. Technik. Wissenschaften V.A. Semzow, Ing. V.V. Semzow, Ing. L.V. Brazhnikova, Ph.D. Technik. Wissenschaften E.V. Korkina); LLC „CERERA-EXPERT“ (dt. E.A. Litwinskaja) unter Beteiligung des nach ihm benannten LLC All-Russian Research, Design and Engineering Lighting Institute. S.I. Vavilov“ (dt. Asche. Tschernjak, Ph.D. Technik. Wissenschaften A.A. Korobko); Russische Medizinische Akademie für postgraduale Ausbildung des Gesundheitsministeriums Russlands ( Dr. med. Wissenschaften DIESE. Bobkowa); Föderale staatliche autonome Einrichtung „Wissenschaftliches Zentrum für Kindergesundheit“ des Gesundheitsministeriums Russlands (Ph.D. in Biologie) L.M. Teksheva); Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (dt. ALS. Schewtschenko), JSC „Svetlana-Optoelectronics“ (Kandidatin der technischen Wissenschaften) A.A. Bogdanow) JSC NIPI „TYAZHPROM-ELECTROPROEKT“ (dt. Z.K. Gobacheva).
REGELWERK
| NATÜRLICHE UND KÜNSTLICHE BELEUCHTUNG Tageslicht und künstliche Beleuchtung |
Datum der Einführung: 08.05.2017
1.1 Dieses Regelwerk gilt für die Gestaltung von Gebäuden und Bauwerken für verschiedene Zwecke, Arbeitsplätze außerhalb von Gebäuden, Standorte von Industrie- und Landwirtschaftsbetrieben, Bahngleise von Unternehmensstandorten, Außenbeleuchtung von Städten und ländlichen Gebieten Siedlungen, Straßentransporttunnel.
1.2 Dieses Regelwerk gilt auch für die Gestaltung örtlicher Beleuchtungseinrichtungen, die komplett mit Maschinen, Maschinen und Industriemöbeln geliefert werden.
1.3 Dieses Regelwerk gilt nicht für die Beleuchtung von Untertagebergwerken, See- und Flusshäfen, Flugplätzen, Bahnhöfen und deren Gleisen, Sportanlagen, Räumlichkeiten zur Lagerung landwirtschaftlicher Produkte, zur Unterbringung von Pflanzen, Tieren, Vögeln sowie zur Gestaltung spezieller technologischer und Sicherheitsbeleuchtung beim Einsatz technischer Sicherheitsmittel.
Dieses Regelwerk verwendet regulatorische Verweise auf die folgenden Dokumente:
GOST 21.607-2014-System Projektdokumentation für den Bau. Regeln für die Umsetzung der Arbeitsdokumentation für elektrische Außenbeleuchtung
GOST 21.608-2014 System der Entwurfsdokumentation für den Bau. Regeln für die Umsetzung der Arbeitsdokumentation für die elektrische Innenbeleuchtung
GOST 111-2014 Farbloses Flachglas. Technische Bedingungen
GOST 5406-84 Emails NTs-25. Technische Bedingungen
GOST 9754-76 Emails ML-12. Technische Bedingungen
GOST 10982-75 Weiße EP-148-Emaille für Kühlschränke und andere Elektrogeräte. Technische Bedingungen
GOST 14254-96 (IEC 529-89) Schutzgrade durch Gehäuse (IP-Code)
GOST 26824-2010 Gebäude und Bauwerke. Methoden zur Helligkeitsmessung
GOST 27900-88 (IEC 598-2-22) Lampen für Notbeleuchtung. Technische Anforderungen
GOST 30826-2014 Mehrschichtiges Glas. Technische Bedingungen
GOST 31364-2014 Glas mit niedrigem Emissionsgrad weiche Beschichtung. Technische Bedingungen
GOST 32997-2014 In der Masse gefärbtes Flachglas. Allgemeine technische Bedingungen
GOST 33017-2014 Glas mit Sonnenschutz- oder dekorativer Hartbeschichtung. Technische Bedingungen
GOST 33086-2014 Glas mit Sonnenschutz oder dekorativer Weichbeschichtung. Technische Bedingungen
GOST 33392-2015 Gebäude und Bauwerke. Methode zur Bestimmung des Unbehaglichkeitsindex bei künstlicher Beleuchtung von Räumlichkeiten
GOST 33393-2015 Gebäude und Bauwerke. Methoden zur Messung des Lichtpulsationskoeffizienten
GOST EN 410-2014 Glas und daraus hergestellte Produkte. Methoden zur Bestimmung optischer Eigenschaften. Bestimmung von Licht- und Solareigenschaften
GOST IEC 60598-2-22-2012 Lampen. Teil 2-22. Private Anforderungen. Notbeleuchtungskörper
GOST R 12.4.026-2001 System der Arbeitssicherheitsstandards. Signalfarben, Sicherheitszeichen und Signalmarkierungen. Zweck und Nutzungsregeln. Sind üblich technische Anforderungen und Eigenschaften. Testmethoden
GOST R 54350-2015 Beleuchtungsgeräte. Beleuchtungsanforderungen und Prüfmethoden
GOST R 54815-2011/IEC/PAS 62612:2009 LED-Lampen mit eingebautem Steuergerät für Allgemeinbeleuchtung für Spannungen über 50 V. Betriebsanforderungen
GOST R 54944-2012 Gebäude und Bauwerke. Lichtmessmethoden
GOST R 55708-2013 Externe Nutzbeleuchtung. Methoden zur Berechnung standardisierter Parameter
GOST R IEC 60598-1-2011 Lampen. Teil 1. Allgemeine Anforderungen und Prüfmethoden
SP 98.13330.2012 „SNiP 2.05.09-90 Straßenbahn- und Trolleybuslinien“
SP 131.13330.2012 „SNiP 23-01-99* Bauklimatologie“ (mit Änderung Nr. 2)
SanPiN 2.2.1/2.1.1.1076-01 Hygienische Anforderungen zur Einstrahlung und zum Sonnenschutz von Wohn- und Öffentliche Gebäude und Territorien
SanPiN 2.2.1/2.1.1.1278-03 Hygienische Anforderungen an natürliche, künstliche und kombinierte Beleuchtung von Wohn- und öffentlichen Gebäuden
SanPiN 2.2.4.3359-16 Hygiene- und epidemiologische Anforderungen an physikalische Faktoren am Arbeitsplatz
Notiz - Bei der Verwendung dieses Regelwerks empfiehlt es sich, die Gültigkeit der Referenzdokumente im öffentlichen Informationssystem zu überprüfen – auf der offiziellen Website des Bundesvollzugsorgans im Bereich Normung im Internet oder anhand des jährlichen Informationsindex „ Nationale Standards„, das zum 1. Januar des laufenden Jahres veröffentlicht wurde, und nach Ausgaben des monatlichen Informationsindex „National Standards“ für dieses Jahr. Falls ersetzt Referenzdokument, auf die undatiert verwiesen wird, wird empfohlen, die aktuelle Version dieses Dokuments zu verwenden und alle an dieser Version vorgenommenen Änderungen zu berücksichtigen. Wird ein Referenzdokument ersetzt, auf das ein datierter Verweis gegeben ist, empfiehlt es sich, die Version dieses Dokuments mit dem oben angegebenen Jahr der Genehmigung (Annahme) zu verwenden. Sollte es nach der Genehmigung dieses Regelwerks zu einer Änderung des referenzierten Dokuments kommen, auf das datiert verwiesen wird und die sich auf die Bestimmung auswirkt, auf die verwiesen wird, wird empfohlen, diese Bestimmung unbeschadet anzuwenden dieser Wandel. Wird das Referenzdokument ersatzlos gelöscht, so empfiehlt es sich, in dem Teil, der diesen Verweis nicht berührt, die Bestimmung anzuwenden, in der darauf verwiesen wird. Es empfiehlt sich, Informationen über die Funktionsweise von Regelwerken im Federal Information Fund of Standards zu prüfen.
In diesem Regelwerk werden folgende Begriffe mit entsprechenden Definitionen verwendet:
3.1 Notfallbeleuchtung: Beleuchtung bei Ausfall der Arbeitslichtversorgung vorhanden.
3.2 Straßentunnel: Teil der Reisestraße Straßentransport, mit einer Überlappung über Fahrbahn, was die natürliche Ausleuchtung der Fahrbahnoberfläche verhindert und dadurch die Sicht des Fahrers auf die Straßensituation verschlechtert.
Anmerkungen
1 Der Tunnelbegriff gilt auch für Sonnenschutzanlagen neben den Tunnelportalen.
2 Das Konzept eines Tunnels umfasst nicht eine Galerie, die als Teil einer Straße definiert ist, deren gesamte Länge eine oder beide durchscheinende Wände aufweist.
3.3 Akzentbeleuchtung: Bringt Licht, um einzelne Details vor einem weniger beleuchteten Hintergrund hervorzuheben.
3.4 Anti-Panik-Beleuchtung: Eine Art Evakuierungsbeleuchtung zur Vermeidung von Panik und zur sicheren Annäherung an Fluchtwege.
3.5 seitliche natürliche Beleuchtung: Natürliche Beleuchtung des Raumes durch Lichtöffnungen in den Außenwänden.
3.6 natürliche Beleuchtung über dem Kopf: Natürliche Beleuchtung des Raumes durch Laternen, Lichtöffnungen in den Wänden an Stellen mit unterschiedlicher Gebäudehöhe.
3.7 inneren Tunnelbereich: Ein Abschnitt des Tunnels, der an die Übergangszone angrenzt und am Anfang der Ausgangszone und, falls diese nicht vorhanden ist, am Ausgangsportal endet.
3.8 Ausgangstunnelbereich: Ein Tunnelabschnitt mit einer Länge, die dem angrenzenden Sicherheitsbremsweg entspricht interne Zone und endet am Ausgangsportal.
3.9 Tunnelausgangsportal: Teil des Tunnelbauwerks, das den Tunnelausgang umrahmt.
3.10 Tunneleingangsbereich: Ein Abschnitt eines Tunnels, der die Schwellen- und Übergangszonen umfasst.
3.11 Tunneleingangsportal: Teil des Tunnelbauwerks, das den Eingang zum Tunnel umrahmt.
Notiz - Sofern ein Sonnenschutz vorhanden ist, entspricht das Einfahrtsportal dem durch einen solchen Sonnenschutz versperrten Beginn der Fahrbahn.
3.12 geometrischer Tageslichtkoeffizient ε , %: Das Verhältnis der natürlichen Beleuchtung, die am betrachteten Punkt einer gegebenen Ebene in Innenräumen durch Licht erzeugt wird, das durch eine ungefüllte Lichtöffnung fällt und direkt von einem gleichmäßig hellen Himmel ausgeht, zum gleichzeitig gemessenen Wert der äußeren horizontalen Beleuchtung unter einem völlig offenen Himmel, unter Beteiligung direkter Sonnenlicht bei der Erstellung der einen oder anderen Beleuchtung ist ausgeschlossen.
3.13 Zweiseitige, seitliche natürliche Beleuchtung: Natürliche Beleuchtung des Raumes durch Lichtöffnungen in unterschiedlichen Ebenen zweier Wände.
3.14 Notfallbeleuchtung: Beleuchtung außerhalb der Arbeitszeiten.
3.15 Tunnellänge, m: Abstand zwischen Ein- und Ausgangsportalen, entlang gemessen Mittellinie Fahrbahn.
3.16 langer Tunnel : Ein Tunnel, der entweder eine Länge von mehr als 125 m hat oder bei dessen Annäherung der Fahrer, der sich im sicheren Bremsabstand vor dem Einfahrtsportal befindet, weniger als 20 % der Fläche des Rahmens des Ausfahrtsportals sieht oder sieht es überhaupt nicht.
3.17 Straße (in der Stadt): Eine Autobahn, die integraler Bestandteil des städtischen Straßen- und Straßennetzes ist oder die Stadt mit funktional zusammenhängenden Objekten verbindet, aber im Gegensatz zu Straßen durch unbebaute Gebiete verläuft.
3.18 zusätzliche künstliche Beleuchtung: Künstliche Beleuchtung in einem kombinierten Beleuchtungssystem, das während des Arbeitstages in Bereichen mit unzureichendem natürlichem Licht eingesetzt wird.
3.19 Tageslicht: Beleuchtung von Räumen mit Oberlicht (direkt oder reflektiert), das durch Lichtöffnungen in äußeren Umfassungskonstruktionen sowie durch Lichtleiter dringt.
3.20 Flutlicht: Allgemeine (gleichmäßige oder ungleichmäßige) Beleuchtung der gesamten Fassade eines Gebäudes oder Bauwerks oder eines wesentlichen Teils davon mit Beleuchtungsgeräten.
3.21 Sicherheitsschild: Ein Schild, das Sicherheitsinformationen (das Verbot, die Durchsetzung oder die Zulassung bestimmter Aktivitäten) durch eine Kombination aus Farbe, Form und grafischen Symbolen oder Text vermittelt.
3.22 Sicherheitsschild mit Außenbeleuchtung: Von außen beleuchtetes Sicherheitsschild.
3.23 Sicherheitsschild mit Innenbeleuchtung: Von innen beleuchtetes Sicherheitsschild.
Notiz - Das Sicherheitszeichen mit Innenbeleuchtung ist eine Leuchtanzeige.
3.24 Farbwiedergabeindex: Ein Maß für die Übereinstimmung zwischen der visuellen Wahrnehmung eines durch den Test beleuchteten farbigen Objekts und Standardlichtquellen unter den gleichen Betrachtungsbedingungen.
3.25 Verkehrsintensität, Einheiten pro Stunde: Nummer Fahrzeug pro Zeiteinheit beim Durchqueren des Straßenquerschnitts während der Hauptverkehrszeit in beide Richtungen.
3.26 kombinierte künstliche Beleuchtung: Künstliche Beleuchtung, bei der lokale Beleuchtung zur allgemeinen künstlichen Beleuchtung hinzugefügt wird.
3.27 kombinierte natürliche Beleuchtung: Kombination aus natürlichem Licht von oben und von der Seite,
3.28 Tageslichtfaktor (KEO) e , %: Das Verhältnis der natürlichen Beleuchtung, die am berechneten Punkt einer bestimmten Ebene in Innenräumen durch Himmelslicht (direkt oder nach Reflexionen) erzeugt wird, zum gleichzeitig gemessenen Wert der externen horizontalen Beleuchtung, die durch das Licht eines völlig offenen Himmels erzeugt wird; in diesem Fall ist die Beteiligung von direktem Sonnenlicht an der Entstehung der einen oder anderen Beleuchtung ausgeschlossen.
3.29 Kontrast des Unterscheidungsobjekts mit dem Hintergrund K, relative Einheiten: Bestimmt durch das Verhältnis des Absolutwerts der Differenz zwischen der Helligkeit des Objekts und des Hintergrunds zur Helligkeit des Hintergrunds. Dabei wird der Kontrast des Diskriminierungsgegenstandes zum Hintergrund berücksichtigt:
Groß - bei K mehr als 0,5 (Objekt und Hintergrund unterscheiden sich stark in der Helligkeit);
Durchschnittlich - bei K von 0,2 bis 0,5 (Objekt und Hintergrund unterscheiden sich deutlich in der Helligkeit);
Klein - bei K kleiner als 0,2 (Objekt und Hintergrund unterscheiden sich kaum in der Helligkeit).
3.30 kurzer Tunnel: Ein Tunnel, der eine Länge von nicht mehr als 125 m hat und bei dessen Annäherung der Fahrer, der sich innerhalb eines sicheren Bremsabstands vor dem Einfahrtsportal befindet, mindestens 20 % der Fläche des Rahmens des Ausfahrtsportals sehen kann.
3.31 Ungleichmäßigkeitskoeffizient der Himmelshelligkeit Q(γ ) : Ein Koeffizient, der die ungleichmäßige Helligkeitsverteilung am Himmel berücksichtigt und durch die Formel bestimmt wird
Wo E max und E min - maximale bzw. minimale Beleuchtungswerte für den Zeitraum ihrer Schwankung, Lux;
E av – durchschnittlicher Beleuchtungswert für den gleichen Zeitraum, Lux.
Notiz - Der Bberücksichtigt die Pulsation des Lichtstroms bis zu 300 Hz. Beleuchtungspulsationen über 300 Hz haben keinen Einfluss auf die allgemeine und visuelle Leistung.
Durch die Einhaltung der Normen des Lichtpulsationskoeffizienten können Sie den negativen Einfluss von Flimmern und Stroboskopeffekten verhindern und die visuelle und allgemeine Ermüdung des Menschen verringern.
3.33 Lichtklimakoeffizient CN, relative Einheiten: Koeffizient unter Berücksichtigung der Eigenschaften des Lichtklimas des Baugebiets, N- Nummer der Kreisgruppe.
3.34 Blendfaktor R G, relative Einheiten: Koeffizient, der die direkte Blendung von Lampen in einer Beleuchtungsanlage an Orten charakterisiert, an denen außerhalb von Gebäuden gearbeitet wird, berechnet nach der Formel
Hier E-Auge- Beleuchtung der Pupille des Beobachters in einer Ebene senkrecht zur Sichtlinie (2° unter der Horizontalen, cm, Abbildung), Lux;
θ - der Winkel zwischen der Blickrichtung des Beobachters und der Richtung des Lichteinfalls auf die Pupille des Beobachters, Grad;
Ich habe- Äquivalente Schleierhelligkeit des Hintergrunds (Umgebung), cd/m2.
Unter der Annahme, dass die Hintergrundreflexion hauptsächlich diffus ist, wird die äquivalente verschleiernde Hintergrundleuchtdichte mithilfe der Formel berechnet
| Ich habe = 0,035∙ρ ∙E g/π, |
Wo E g - durchschnittliche horizontale Beleuchtung der Oberfläche;
ρ - durchschnittlicher Reflexionsgrad der umgebenden Oberflächen; in Fällen, in denen es unbekannt ist, wird es gleich 0,15 angenommen.
1 - Sichtlinie; 2 - Augenebene des Betrachters
Abbildung 3.1
3.35 Betriebsfaktor (für natürliches Licht) M.F., relative Einheiten s: Ein Koeffizient, der dem Verhältnis des KEO-Werts an einem bestimmten Punkt, der durch natürliches Licht am Ende der festgelegten Lebensdauer erzeugt wird, zum KEO-Wert am gleichen Punkt zu Beginn des Betriebs entspricht.
Der Koeffizient berücksichtigt die Abnahme des CEC während des Betriebs aufgrund von Verschmutzung und Alterung durchscheinender Füllungen in Lichtöffnungen sowie eine Abnahme der Reflexionseigenschaften von Raumoberflächen:
| M.F. = M.F. z ∙ M.F. P, |
Wo M.F. z ist ein Koeffizient, der die Abnahme des CEC während des Betriebs aufgrund von Verschmutzung und Alterung durchscheinender Füllungen in Lichtöffnungen berücksichtigt;
M.F. n ist ein Koeffizient, der die Abnahme des KEO während des Betriebs aufgrund einer Abnahme der Reflexionseigenschaften von Raumoberflächen berücksichtigt.
Notiz - Betriebsfaktor – der Kehrwert des zuvor verwendeten SicherheitsfaktorsK H für natürliches Licht ( M.F. = 1/ K H).
3.36 Servicefaktor (für künstliche Beleuchtung) M.F., relative Einheiten: Ein Koeffizient, der dem Verhältnis der Beleuchtungsstärke oder Helligkeit an einem bestimmten Punkt, die eine Beleuchtungsanlage am Ende ihrer festgelegten Lebensdauer erzeugt, zur Beleuchtungsstärke oder Helligkeit am selben Punkt zu Beginn des Betriebs entspricht.
Der Koeffizient berücksichtigt auch die Abnahme der Beleuchtungsstärke oder Helligkeit während des Betriebs der Beleuchtungsanlage aufgrund einer Abnahme des Lichtstroms, des Ausfalls von Lichtquellen und nicht behebbarer Änderungen der Reflexions- und Transmissionseigenschaften der optischen Elemente von Beleuchtungsgeräten als Verschmutzung der Raumoberflächen, der Außenwände eines Gebäudes oder Bauwerks, der Fahrbahn oder des Gehwegs:
| M.F. = M.F. sp∙ M.F. in und M.F. op ∙ M.F. P, |
Wo M.F. cn ist ein Koeffizient, der den Rückgang des Lichtstroms von Lichtquellen berücksichtigt;
M.F. vi - Koeffizient unter Berücksichtigung des Ausfalls von Lichtquellen;
M.F. op ist ein Koeffizient, der Verschmutzung und nicht wiederherstellbare Änderungen der Reflexions- und Transmissionseigenschaften optischer Elemente von Beleuchtungsgeräten berücksichtigt;
M.F. n ist ein Koeffizient, der die Verschmutzung reflektierender Oberflächen eines Raums oder einer Struktur berücksichtigt.
Notiz - Der Betriebsfaktor ist umgekehrt proportional zum SicherheitsfaktorK z : ( M.F. = 1/ K H).
3.37 lokale Architekturbeleuchtung: Beleuchtung von Teilen eines Gebäudes oder Bauwerks sowie von Einzelpersonen architektonische Elemente ohne Flutlicht.
3.38 Medienfassade: Eine lichtdurchlässige Werbestruktur, die direkt auf der Oberfläche der Wände von Gebäuden, Bauwerken und Bauwerken oder auf einem Metallrahmen angebracht wird, der die Kunststoffwand nachbildet (im Falle der Platzierung einer Medienfassade auf der vorhandenen Verglasung eines Gebäudes, Bauwerks, Struktur), die die Anzeige von Informationsmaterialien ermöglicht. Die Größe des Informationsfeldes der Medienfassade wird durch die Größe des angezeigten Bildes bestimmt.
3.39 lokale Beleuchtung: Beleuchtung, zusätzlich zur allgemeinen Beleuchtung, erzeugt durch Lampen, die den Lichtstrom direkt auf den Arbeitsplatz konzentrieren.
3.40 bewölkter Himmel MCO: Ein vollständig von Wolken bedeckter Himmel, dessen Helligkeitsverteilung durch den Standard der International Commission on Illumination (CIE) bestimmt wird. Himmelshelligkeitsverhältnis in der Höhe γ über dem Horizont bis zur Helligkeit im Zenit wird durch die Formel bestimmt
3.41 allgemeine Gleichmäßigkeit der Verteilung der Helligkeit der Straßenoberfläche U 0 : Verhältnis des minimalen Helligkeitswerts der Straßenoberfläche zum Durchschnitt:
| U 0 = L Mindest/ L Heiraten |
3.42 allgemeine gleichmäßige künstliche Beleuchtung der Räumlichkeiten: Beleuchtung, bei der Leuchten im oberen Bereich des Raumes platziert werden und eine gleichmäßige Lichtverteilung an den Arbeitsbereichen erzeugen.
3.43 allgemeine lokale künstliche Beleuchtung von Räumlichkeiten: Beleuchtung, bei der Leuchten im oberen Bereich des Raumes direkt über den Geräten platziert werden.
3.44 kombinierter Unbehagen-Index UGR, relative Einheiten: Kriterium zur Beurteilung unangenehmer Helligkeit, die bei ungleichmäßiger Helligkeitsverteilung im Sichtfeld unangenehme Empfindungen hervorruft, bestimmt durch die Formel
Wo L ich- Helligkeit der brillanten Quelle, cd/m2;
ωi- Winkelgröße der hellen Quelle, Steradianten;
p ich- Index der Position der hellen Quelle relativ zur Sichtlinie;
L a- Anpassung der Helligkeit, cd/m2.
3.45 Objekt der Unterscheidung: Der betreffende Artikel, sein Einzelteil oder Fehler, der während des Arbeitsprozesses unterschieden werden muss.
3.46 Beleuchtung von Hochrisikobereichen: Eine Art Notbeleuchtung für den sicheren Abschluss eines potenziell gefährlichen Arbeitsprozesses.
3.47 Beleuchtung von Fluchtwegen: Eine Art Notbeleuchtung zur sicheren Identifizierung und sichere Verwendung Fluchtwege.
3.48 Erleuchtung E, OK: Lichtstromverhältnis dФ Einfall auf ein Flächenelement, das den betreffenden Punkt enthält, auf die Fläche dA dieses Element:
| E = dФ/dA. |
3.49 relative Fläche der Lichtöffnungen S F/ S P, SÖ/ S N,%: Das Verhältnis der Fläche von Laternen oder Fenstern zur beleuchteten Grundfläche des Raumes.
3.50 reflektierter Glanz: Charakteristisch für die Reflexion des Lichtstroms von der Arbeitsfläche in Richtung der Augen des Arbeiters, die die Verschlechterung der Sichtbarkeit aufgrund einer übermäßigen Erhöhung der Helligkeit der Arbeitsfläche und des Schleiereffekts bestimmt, wodurch der Kontrast zwischen dem Objekt und dem Objekt verringert wird der Hintergrund.
3.51 relative spezifische Leistung der Straßenbeleuchtung Dp, W/(m 2 ∙lux): Ein Indikator für die Energieeffizienz der Beleuchtung eines Straßenabschnitts, bestimmt durch das Verhältnis der Leistung der installierten Beleuchtungsgeräte zur Fläche des Abschnitts und der durchschnittlichen Beleuchtung.
Notiz - Methodik zur Berechnung des Indikators Dp ist im Anhang angegeben.
3.52 Kreuzung: Transportknoten, bei dem sich zwei oder mehr Straßen oder Wege auf gleicher Höhe verbinden oder kreuzen.
3.53 Fensterbereich S o, m 2: Die Gesamtfläche der Lichtöffnungen (im Licht), die sich in den Außenwänden des beleuchteten Raums befinden.
3.54 Laternenbereich S f, m 2: Die Gesamtfläche der Lichtöffnungen (in Licht) aller Lampen, die sich in der Beschichtung über dem beleuchteten Raum oder Flur befinden.
3.55 Tunnelzugangsbereich: Ein Straßenabschnitt außerhalb des Tunnels mit einer Länge, die dem Sicherheitsbremsweg entspricht, neben dem Eingangsportal.
3.56 halbzylindrische Beleuchtung E Punkte, lx: Das Verhältnis des auf die Außenfläche eines unendlich kleinen Halbzylinders mit Mittelpunkt in einem bestimmten Punkt einfallenden Lichtstroms zur Fläche der zylindrischen Oberfläche dieses Halbzylinders.
Anmerkungen
1 Sofern nicht anders angegeben, muss die Achse des Halbzylinders senkrecht stehen.
2 In Bezug auf die zweckmäßige Außenbeleuchtung wird die halbzylindrische Beleuchtung als Kriterium für die Beurteilung der Unterscheidung von Gesichtern entgegenkommender Fußgänger verwendet und als bestimmt durchschnittliche Dichte Lichtstrom auf der zylindrischen Oberfläche eines unendlich kleinen Halbzylinders, der senkrecht auf der Längslinie der Straße in einer Höhe von 1,5 m liegt und mit der Außennormalen zur ebenen Seitenfläche des Halbzylinders in Richtung des Hauptfußgängers ausgerichtet ist Bewegung.
3.57 Raum ohne Tageslicht: Ein Raum, in dem der natürliche Lichtfaktor unter 0,1 % liegt.
3.58 ein Raum mit unzureichendem Tageslicht: Ein Raum, in dem der natürliche Beleuchtungskoeffizient niedriger als normal ist.
3.59 dauerhaft bewohnte Räumlichkeiten: Ein Raum, in dem sich Menschen aufhalten am meisten(mehr als 50 %) ihrer Arbeitszeit tagsüber oder mehr als 2 Stunden ununterbrochen.
3.60 Tunnelschwellenzone: Ein Tunnelabschnitt mit einer Länge, die dem Sicherheitsbremsweg neben dem Eingangsportal entspricht.
3.61 Schwellenwert der Helligkeitserhöhung T.I., %: Ein Kriterium, das die Blendwirkung von Beleuchtungsanlagenleuchten im Sichtfeld des Fahrers eines Fahrzeugs regelt. Bezeichnet die Zunahme des Kontrasts zwischen einem Objekt und seinem Hintergrund, bei der die Sichtbarkeit des Objekts in Gegenwart einer hellen Lichtquelle dieselbe wäre wie in deren Abwesenheit. Bestimmt durch die Formel
Wo L av – durchschnittliche Helligkeit der Straßenoberfläche, cd/m2;
k- Multiplikator gleich 950 bei L cp > 5 cd/m2 und 650 at L cp ≤ 5 cd/m2;
Ev,i- vertikale Ausleuchtung des Fahrerauges ich die Lampe, Lux;
θ ich- Winkel zwischen der Richtung ich- Lampe und Sichtlinie, Hagel;
N- die Anzahl der Lampen, die innerhalb des Winkelintervalls in das Sichtfeld des Fahrers fallen θ (2°< θ < 20°).
3.62 extreme Gleichmäßigkeit der Beleuchtungs-(Helligkeits-)verteilung UD : Verhältnis von minimaler Beleuchtung (Helligkeit) zu maximalem:
3.64 reisen: Ein Bereich, der sowohl für den Verkehr von Fahrzeugen als auch für Fußgänger vorgesehen ist.
3.65 Fluchtwege: Weg, über den Personen den Gefahrenbereich verlassen können Notfallsituation. Es beginnt an dem Ort, an dem sich Menschen aufhalten, und endet in der sicheren Zone.
3.66 Arbeitsfläche: Die Oberfläche, auf der gearbeitet wird, ist genormt und die Beleuchtung wird gemessen.
3.67 Arbeitsbeleuchtung: Beleuchtung, die in Räumen und an Arbeitsorten außerhalb von Gebäuden für einheitliche Lichtverhältnisse (Beleuchtungsstärke, Lichtqualität) sorgt.
3.68 Gleichmäßigkeit des natürlichen Lichts: Das Verhältnis des Minimalwerts zum Durchschnittswert von KEO innerhalb des charakteristischen Raumabschnitts.
3.69 gleichmäßige Verteilung der Beleuchtung (Helligkeit) Uo : Verhältnis des minimalen Beleuchtungsstärke-(Helligkeits-)Wertes zum durchschnittlichen Beleuchtungsstärke-(Helligkeits-)Wert:
| Uo = E Mindest/ E vgl. ( Uo = L Mindest/ L Heiraten). |
3.70 Auflösung: Kreuzung von Straßen auf verschiedenen Ebenen mit Rampen, damit Fahrzeuge von einer Straße zur anderen gelangen können.
3.71 sicherer Bremsweg (RBD), m: Mindestabstand erforderlich, um ein Fahrzeug, das sich mit der vorgesehenen Geschwindigkeit bewegt, zuverlässig und vollständig zum Stillstand zu bringen.
Notiz - Bestimmt werden Gesamtzeit die Reaktion des Fahrers auf ein scheinbares Hindernis, um eine Entscheidung zu treffen und das Fahrzeug abzubremsen.
3.72 Entwurfsgeschwindigkeit: Die Höchstgeschwindigkeit eines einzelnen Fahrzeugs, die bei der Gestaltung der Straße berücksichtigt wurde.
3.73 berechneter Wert von KEO e p, % : Durch Berechnung ermittelter Wert bei der Bewertung der natürlichen oder kombinierten Beleuchtung von Räumlichkeiten:
a) mit Seitenbeleuchtung gemäß der Formel
c) mit kombinierter Beleuchtung (oben und seitlich) gemäß der Formel
Wo L- die Anzahl der Himmelsbereiche, die vom berechneten Punkt aus durch die Lichtöffnung sichtbar sind;
ε b i- geometrisches KEO am Designpunkt mit seitlicher Beleuchtung unter Berücksichtigung des direkten Lichteinfalls von ich-ter Teil des Himmels;
C N- Lichtklimakoeffizient, entnommen aus der Tabelle;
q ich- Helligkeitsungleichmäßigkeitskoeffizient ich- Bereich des bewölkten Himmels MCO;
M- die Anzahl der Fassadenabschnitte von Gebäuden mit entgegengesetzter Bebauung, die vom Planungspunkt aus durch die Lichtöffnung sichtbar sind;
ε Gebäude J – geometrisches KEO am Designpunkt mit Seitenbeleuchtung, unter Berücksichtigung des reflektierten Lichts J- Abschnitt der Fassaden von Gebäuden mit entgegengesetzter Bebauung;
B F J- durchschnittliche relative Helligkeit J-ter Abschnitt der Fassaden von Gebäuden mit entgegengesetzter Bebauung;
R 0 – Koeffizient, der den Anstieg des KEO bei seitlicher Beleuchtung aufgrund des von den Oberflächen des Raums und der darunter liegenden Schicht neben dem Gebäude reflektierten Lichts berücksichtigt;
k Gebäude J- Koeffizient, der Änderungen der internen reflektierten Komponente des KEO in einem Raum bei Vorhandensein gegenüberliegender Gebäude berücksichtigt, bestimmt durch die Formel
Wo τ 1 - Lichtdurchlässigkeit des Materials;
τ 2 - Koeffizient unter Berücksichtigung des Lichtverlusts in den Rahmen der Lichtöffnung. Die Maße der Lichtöffnung sind gleich den Maßen des Bindekastens entsprechend dem Außenmaß;
τ 3 - Koeffizient unter Berücksichtigung des Lichtverlusts in tragende Strukturen(mit Seitenbeleuchtung τ 3 = 1);
τ 4 - Koeffizient unter Berücksichtigung des Lichtverlusts in Sonnenschutzvorrichtungen;
τ 5 - Koeffizient unter Berücksichtigung des Lichtverlusts im unter den Lampen installierten Schutzgitter, angenommen gleich 0,9;
M.F.- aus der Tabelle ermittelter Betriebskoeffizient;
T- Anzahl der Lichtöffnungen in der Beschichtung;
ε V ich- geometrisches KEO am Designpunkt mit Deckenbeleuchtung von ich Eröffnung;
ε av - der aus dem Verhältnis ermittelte Durchschnittswert des geometrischen KEO bei Deckenbeleuchtung an der Schnittlinie der bedingten Arbeitsfläche und der Ebene des charakteristischen Vertikalschnitts des Raumes
Hier N- Anzahl der Designpunkte;
R 2 – Koeffizient, der den Anstieg des KEO bei Deckenbeleuchtung aufgrund des von den Raumoberflächen reflektierten Lichts berücksichtigt;
k f - Koeffizient unter Berücksichtigung des Laternentyps.
3.74 Backup-Beleuchtung: Eine Art Notbeleuchtung, um die Arbeit fortzusetzen, wenn die Arbeitsbeleuchtung ausgeschaltet ist.
3.75 leichtes Klima: Die Gesamtheit der natürlichen Lichtverhältnisse in einem bestimmten Bereich (Beleuchtung und Beleuchtungsstärke auf horizontalen und vertikalen Flächen, die an den Seiten des Horizonts unterschiedlich ausgerichtet sind und durch diffuses Licht vom Himmel und direktes Licht der Sonne erzeugt werden, Sonnenscheindauer und Albedo des Untergrundes) für einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren.
3.76 natürliche Lichtfaser: Führungsgerät natürliches Licht im Gebäude.
3.77 Lichtzeiger: Sicherheitsschild mit Innenbeleuchtung.
3.78 Leuchtdiode: Eine Lichtquelle, die auf der Emission inkohärenter Strahlung im sichtbaren Wellenlängenbereich basiert, wenn ein elektrischer Strom durch eine Halbleiterdiode geleitet wird.
3.79 Wohngebiet: Als Unterkunft vorgesehener Bereich Wohnbestand, öffentliche Gebäude und Bauwerke sowie einzelne kommunale und industrielle Einrichtungen, die keine Errichtung von Sanitärschutzzonen erfordern, für den Bau von Überlandkommunikationswegen, Straßen, Plätzen, Parks, Gärten, Boulevards und anderen öffentlichen Plätzen.
3.80 Tunnel-Thekenbeleuchtungssystem: Tunnelbeleuchtung, bei der das Licht überwiegend in Richtung des Verkehrsflusses auf Objekte fällt.
Notiz - Für eine Thekenbeleuchtung werden Lampen verwendet, deren Lichtstärkeverteilung asymmetrisch zu einer Ebene senkrecht zur Bewegungsrichtung des Verkehrsflusses ist, wobei die maximale Lichtstärke in Richtung der Bewegung des Verkehrsflusses gerichtet ist.
3.81 symmetrisches Tunnelbeleuchtungssystem: Tunnelbeleuchtung, bei der das Licht sowohl entlang als auch in Richtung des Verkehrsflusses gleichmäßig auf Objekte fällt.
Notiz - Für ein symmetrisches Beleuchtungssystem werden Lampen verwendet, deren Lichtstärkeverteilung symmetrisch zu einer Ebene senkrecht zur Verkehrsflussrichtung ist.
3.82 Fluchtweganzeigesystem: Ein System, das eine ausreichende Anzahl von Sicherheitszeichen bereitstellt, damit Personen im Falle einer Gefahr entlang festgelegter Fluchtwege einen Ort evakuieren können.
3.83 kombinierte Beleuchtung: Beleuchtung, bei der für einen ganzen Arbeitstag das natürliche Licht, das standardmäßig nicht ausreicht, durch künstliches Licht ergänzt wird.
3.84 durchschnittlicher KEO-Wert e Durchschnitt %: Mit Decken- oder kombinierter Beleuchtung, bestimmt durch die Formel
Wo e 1 und e N- KEO-Werte mit Decken- oder kombinierter Beleuchtung am ersten und letzten Punkt des charakteristischen Raumabschnitts, siehe Formeln () und ();
e i- KEO-Werte an anderen Stellen des charakteristischen Raumabschnitts ( ich = 2, 3,…, N - 1).
3.85 durchschnittliche Ausleuchtung der Fahrbahnoberfläche E cp, lx: Beleuchtung auf der Straßenoberfläche, gewichteter Durchschnitt über die Fläche eines bestimmten Gebiets.
3.86 durchschnittliche Helligkeit der Straßenoberfläche L Durchschnitt, cd/m²: Die Helligkeit einer trockenen Straßenoberfläche in Richtung des Auges eines Beobachters, der sich unter Standardbeobachtungsbedingungen auf der Achse einer Fahrspur befindet, gewichteter Durchschnitt über die Fahrbahnfläche eines bestimmten Abschnitts.
3.87 durchschnittliche Helligkeit der Fahrbahnoberfläche im Tunnelübergangsbereich L tr, cd/m²: Die durchschnittliche Helligkeit der trockenen Fahrbahnoberfläche über den Bereich der Fahrbahn in Richtung des Auges des Beobachters, der sich auf der Achse der Fahrbahn im Übergangsbereich des Tunnels befindet.
3.88 durchschnittliche Helligkeit der Tunnelschwellenzone LeutnantH, cd/m²: Durchschnittliche Helligkeit der Fahrbahnoberfläche in der ersten Hälfte der Tunnelschwellenzone.
3.89 Standardbeobachtungsbedingungen in der Straßenbeleuchtung: Bei der Berechnung der Helligkeit der Fahrbahnoberfläche werden die Bedingungen der Beobachtung durch den Fahrer des Fahrzeugs geregelt, bei denen sich das Auge des Beobachters in einer Höhe von 1,5 m über der Fahrbahnoberfläche befindet und vom berechneten Punkt in einem Abstand von entfernt ist bei dem die Sichtlinie in einem Winkel (1,0 ± 0,5)° zur Straßenebene auf den berechneten Punkt gerichtet ist.
3.90 stroboskopischer Effekt: Die visuelle Wahrnehmung einer scheinbaren Veränderung, eines Aufhörens der Rotationsbewegung oder einer periodischen Schwingung eines Objekts, das durch Licht beleuchtet wird, das mit einer ähnlichen, zusammenfallenden oder mehreren Frequenzen variiert.
3.91 Transportzone des Tunnels: Teil des Tunnelbaukomplexes mit der eigentlichen Fahrbahn, eingeschlossen zwischen Ein- und Ausfahrtportal.
3.92 Bürgersteig: Fußgängerbereich der Straße.
3.93 Leistungsdichte ω , W/m 2: Installierte Leistung der künstlichen Beleuchtung in einem Raum, geteilt durch die Nutzfläche.
3.94 Straße: Ein Raum, der auf einer oder beiden Seiten ganz oder teilweise von Gebäuden begrenzt wird und über eine Fahrbahn für Fahrzeuge, Fußgängerwege und gegebenenfalls Fahrradwege verfügt.
3.95 herkömmliche Arbeitsfläche: Bedingt horizontale Fläche, befindet sich in einer Höhe von 0,8 m über dem Boden.
3.96 Geschwindigkeit einstellen Bewegung: Maximale bauartbedingte Verkehrsgeschwindigkeit.
3.97 Nützliche Außenbeleuchtung: Feste Beleuchtung, die eine sichere und komfortable Bewegung von Fahrzeugen und Fußgängern gewährleisten soll.
3.98 Straßenabschnitt mit normaler Fahrbahngeometrie: Ein Straßenabschnitt oder eine Straße, deren Fahrbahn eine ebene rechteckige Fläche ist, deren Länge durch Standardbeobachtungsbedingungen bestimmt wird.
Notiz - Für Abschnitte mit einheitlicher Fahrbahngeometrie sind sowohl die Helligkeit als auch die Ausleuchtung der Fahrbahnoberfläche standardisiert.
3.99 Straßenabschnitt mit nicht standardmäßiger Fahrbahngeometrie: Ein Abschnitt einer Straße oder Straße, der Abweichungen von der Standardgeometrie aufweist, zum Beispiel Kurven, Gabelungen, Ein- und Ausfahrten von Überführungen, gekrümmte Abschnitte (im Grundriss und Profil) usw.
Notiz - Für Bereiche mit abweichender Fahrbahngeometrie ist lediglich die Ausleuchtung der Fahrbahnoberfläche normiert.
3.100 flackern: Subjektive Wahrnehmung von Schwankungen des Lichtstroms künstlicher Lichtquellen in Betrag und Zeit.
3.101 Flimmereffekt (und Tunnelbeleuchtung): Monotoner Flackereffekt helle Teile Lampen und deren Blendung durch die Fahrzeugkarosserie, was bei bestimmten Frequenzintervallen und Dauer des Flackerns zu Irritationen beim Fahrer führt.
3.102 Hintergrund: Die Oberfläche, die unmittelbar an das Diskriminierungsobjekt angrenzt, auf dem es betrachtet wird.
Als Hintergrund gilt: Licht – wenn der Oberflächenreflexionsgrad mehr als 0,4 beträgt; Durchschnitt - gleich, von 0,2 bis 0,4; dunkel - das gleiche, weniger als 0,2.
3.103 charakteristischer Teil des Raumes: Ein Querschnitt in der Raummitte, dessen Ebene senkrecht zur Ebene der Verglasung der Lichtöffnungen (bei seitlicher Beleuchtung) bzw. der Längsachse der Raumspannweiten liegt. Der charakteristische Raumabschnitt sollte Bereiche mit umfassen die größte Zahl Arbeitsplätze sowie Punkte Arbeitsbereich, am weitesten von den Lichtöffnungen entfernt.
3.104 Bunte Temperatur Tu, ZU: Die Temperatur eines Planck-Strahlers (schwarzer Körper), bei der seine Strahlung die gleiche Farbart wie die des betreffenden Objekts aufweist.
3.105 Farbwiedergabe: Ein allgemeines Konzept, das den Einfluss der spektralen Zusammensetzung einer Lichtquelle auf die visuelle Wahrnehmung farbiger Objekte charakterisiert, bewusst oder unbewusst im Vergleich zur Wahrnehmung derselben Objekte, die von einer Standardlichtquelle beleuchtet werden.
3.106 zylindrische Beleuchtung E ts, lx: Verhältnis des einfallenden Lichtstroms Seitenfläche ein infinitesimaler Zylinder mit einem Mittelpunkt an einem bestimmten Punkt, zur Mantelfläche dieses Zylinders.
Anmerkungen
1 Sofern nicht anders angegeben, muss die Zylinderachse vertikal sein.
2 In Bezug auf die Innenbeleuchtung wird die zylindrische Beleuchtung als Kriterium zur Beurteilung der Sättigung eines Raumes mit Licht herangezogen.
3.107 Evakuierungsbeleuchtung: Eine Art Notbeleuchtung zur Evakuierung von Personen oder zum Abschluss eines potenziell gefährlichen Vorgangs.
3.108 Notausgang: Ein Ausgang zur Evakuierung von Personen im Notfall zu einem Fluchtweg, der direkt nach draußen oder in einen sicheren Bereich führt.
3.109 äquivalente Größe des Diskriminierungsobjekts: Die Größe eines gleich hellen Kreises auf einem gleich hellen Hintergrund, der bei gegebener Hintergrundhelligkeit den gleichen Schwellenkontrast wie das Unterscheidungsobjekt aufweist.
Energieeffizienz: Merkmale, die das Verhältnis der positiven Wirkung der Nutzung von Energieressourcen zu den Kosten der Energieressourcen widerspiegeln, die zur Erzielung einer solchen Wirkung erzeugt werden, in Bezug auf Produkte, technologische Prozesse, juristische Person, Einzelunternehmer.
4.4 Bei der Gestaltung natürlicher, künstlicher und kombinierter Beleuchtung sollte ein Betriebskoeffizient eingeführt werden, um den Rückgang der Beleuchtung während des Betriebs auszugleichen M.F., entnommen gemäß der Tabelle.
4.5 Anforderungen an die Einstrahlung und den Sonnenschutz der Räumlichkeiten werden gemäß SanPiN 2.2.1/2.1.1.1076 erfüllt.
4.6 Messungen der Beleuchtung, Helligkeit und des Beleiner Beleuchtungsanlage werden während der Inbetriebnahme und Überwachung des Beleuchtungszustands während des Betriebs gemäß GOST R 54944, GOST 26824, GOST 33393 durchgeführt. Die Bestimmung des kombinierten Indikators Die Unbequemlichkeit wird in der Entwurfsphase der Beleuchtungsanlage gemäß GOST 33392 durchgeführt.
4.7 Bei der Gestaltung künstlicher und kombinierter Beleuchtung sind Angaben zur Vorbeugung zu berücksichtigen ultraviolette Bestrahlung entsprechend .
Dieses Regelwerk enthält Anforderungen, die den Zielen der „Technischen Regeln für die Sicherheit von Gebäuden und Bauwerken“ vom 30.12.2009 N 384-FZ entsprechen und der zwingenden Einhaltung unter Berücksichtigung des Bundesgesetzes vom 27.12.2002 N 184 unterliegen. Bundesgesetz „Über technische Vorschriften“ vom 23. November 2009 N 261-FZ „Über Energieeinsparung und Steigerung der Energieeffizienz sowie über die Einführung von Änderungen bestimmter Rechtsakte der Russischen Föderation.“
Das Regelwerk legt Standards für die natürliche, künstliche und kombinierte Beleuchtung von Gebäuden und Bauwerken sowie Standards für die künstliche Beleuchtung von Wohngebieten, Betriebsgeländen und Arbeitsstätten außerhalb von Gebäuden fest.
Die Aktualisierung wurde von einem Autorenteam durchgeführt: Landeshaushaltsinstitution „Forschungsinstitut für Bauphysik der Russischen Akademie für Architektur und Bauwissenschaften“ (Kandidat der technischen Wissenschaften I.A. Shmarov, Kandidat der technischen Wissenschaften V.A. Zemtsov, Ingenieur V.V. Zemtsov, Ingenieurin L.V. Brazhnikova, Kandidatin der technischen Wissenschaften E.V. Korkina); LLC „CERERA-EXPERT“ (Ingenieur E.A. Litvinskaya) unter Beteiligung der LLC „Allrussisches Institut für Forschung, Design und Ingenieurwesen, benannt nach S.I. Vavilov“ (Ingenieur A.Sh. Chernyak, Ph.D. Wissenschaften A.A. Korobko); Russische Medizinische Akademie für postgraduale Ausbildung des Gesundheitsministeriums Russlands (Doktor der medizinischen Wissenschaften T.E. Bobkova); Föderale staatliche autonome Einrichtung „Wissenschaftliches Zentrum für Kindergesundheit“ des Gesundheitsministeriums Russlands (Kandidat der Biowissenschaften L.M. Teksheva); UN-Entwicklungsprogramm (dt. A.S. Shevchenko), CJSC „Svetlana-Optoelectronics“ (Kandidat der technischen Wissenschaften A.A. Bogdanov) OJSC NIPI „TYAZHPROM-ELECTROPROJECT“ (Ingenieur Z.K. Gobacheva).
1.1 Dieses Regelwerk gilt für die Gestaltung von Gebäuden und Bauwerken für verschiedene Zwecke, Arbeitsplätze außerhalb von Gebäuden, Standorte von Industrie- und Landwirtschaftsbetrieben, Bahngleise von Betriebsstandorten, Außenbeleuchtung von Städten und ländlichen Siedlungen, Straßentunnel.
1.2 Dieses Regelwerk gilt auch für die Gestaltung örtlicher Beleuchtungseinrichtungen, die komplett mit Maschinen, Maschinen und Industriemöbeln geliefert werden.
1.3 Dieses Regelwerk gilt nicht für die Beleuchtung von Untertagebergwerken, See- und Flusshäfen, Flugplätzen, Bahnhöfen und deren Gleisen, Sportanlagen, Räumlichkeiten zur Lagerung landwirtschaftlicher Produkte, Platzierung von Pflanzen, Tieren, Vögeln sowie für die Entwurf spezieller Technologie- und Sicherheitsbeleuchtung für den Einsatz technischer Sicherheitsmittel.
System der Arbeitssicherheitsstandards. Signalfarben, Sicherheitszeichen und Signalmarkierungen. Zweck und Nutzungsregeln. Allgemeine technische Anforderungen und Eigenschaften. Testmethoden
GOST R 54815-2011/IEC/PAS 62612:2009 LED-Lampen mit eingebautem Steuergerät für Allgemeinbeleuchtung für Spannungen über 50 V. Betriebsanforderungen
Hinweis – Bei der Nutzung dieses Regelwerks empfiehlt es sich, die Gültigkeit der Referenzdokumente im öffentlichen Informationssystem zu prüfen – auf der offiziellen Website des Bundesvollzugsorgans im Bereich Normung im Internet oder anhand des jährlichen Informationsindex „Nationale Normen“, die ab dem 1. Januar des laufenden Jahres erschienen sind, und über Ausgaben des monatlichen Informationsindex „Nationale Normen“ für das laufende Jahr. Wenn ein referenziertes Dokument, auf das ein undatierter Verweis erfolgt, ersetzt wird, wird empfohlen, die aktuelle Version dieses Dokuments zu verwenden und dabei alle an dieser Version vorgenommenen Änderungen zu berücksichtigen. Wird ein Referenzdokument ersetzt, auf das ein datierter Verweis gegeben ist, empfiehlt es sich, die Version dieses Dokuments mit dem oben angegebenen Jahr der Genehmigung (Annahme) zu verwenden. Kommt es nach der Genehmigung dieses Regelwerks zu einer Änderung des referenzierten Dokuments, auf das datiert verwiesen wird und die sich auf die Bestimmung auswirkt, auf die verwiesen wird, so wird empfohlen, diese Bestimmung ohne Berücksichtigung anzuwenden dieser Wandel. Wird das Referenzdokument ersatzlos gelöscht, so empfiehlt es sich, in dem Teil, der diesen Verweis nicht berührt, die Bestimmung anzuwenden, in der darauf verwiesen wird. Es empfiehlt sich, Informationen über die Funktionsweise von Regelwerken im Federal Information Fund of Standards zu prüfen.
- SP 4.13130.2013 Brandschutzsysteme. Begrenzung der Brandausbreitung an Schutzeinrichtungen. Anforderungen an raumplanerische und gestalterische Lösungen
- SP 6.13130.2013 Brandschutzsysteme. Elektrische Ausrüstung. Brandschutzanforderungen
- SP 7.13130.2013 Heizung, Lüftung und Klimaanlage. Brandschutzanforderungen
- SP 165.1325800.2014 Ingenieurtechnische und technische Maßnahmen für den Zivilschutz. Aktualisierte Version von SNiP 2.01.51-90 (mit Änderung Nr. 1)
- SP 223.1326000.2014 Eisenbahn-Telekommunikationsregeln für die Nutzung der Bahnhofsfunkkommunikation und der bidirektionalen Parkkommunikation
- SP 224.1326000.2014 Bahnstromversorgung für Eisenbahnen
- SP 225.1326000.2014 Bahnhofsgebäude, Bauwerke und Geräte
- SP 226.1326000.2014 Stromversorgung von Nicht-Traktionsverbrauchern Regeln für Planung, Bau und Umbau
- Änderung Nr. 1 SP 108.13330.2012 Unternehmen, Gebäude und Strukturen zur Getreidelagerung und -verarbeitung Aktualisierte Version von SNiP 2.10.05-85
- Änderung Nr. 1 SP 109.13330.2012 Kühlschränke Aktualisierte Ausgabe von SNiP 2.11.02-87
- Änderung Nr. 1 SP 113.13330.2012 Parkplätze Aktualisierte Version von SNiP 21.02.99*
- Änderung Nr. 1 SP 13.13130.2009 Kernkraftwerke Brandschutzanforderungen
- Änderung Nr. 1 SP 14.13330.2014 Bau in seismischen Gebieten Aktualisierte Version von SNiP II-7-81*
- Änderung Nr. 1 SP 141.13330.2012 Sozialdiensteinrichtungen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität Regeln für die Berechnung und Platzierung
- Änderung Nr. 1 SP 142.13330.2012 Gebäude von Resozialisierungszentren Gestaltungsregeln Aktualisierte Version von SP 35-107-2003
- Änderung Nr. 1 SP 143.13330.2012 Räumlichkeiten für Freizeit- und Körperkultur sowie Erholungsaktivitäten von Menschen mit eingeschränkter Mobilität Gestaltungsregeln
- Änderung Nr. 1 SP 144.13330.2012 Zentren und Abteilungen der Altenpflege Gestaltungsregeln
- Änderung Nr. 1 SP 145.13330.2012 Gestaltungsregeln für Pensionen
- Änderung Nr. 1 SP 146.13330.2012 Gerontologische Zentren, Pflegeheime, Hospize Gestaltungsregeln
- Änderung Nr. 1 SP 147.13330.2012 Gebäude für soziale Einrichtungen, Regeln für den Wiederaufbau
- Änderung Nr. 1 SP 148.13330.2012 Räumlichkeiten in sozialen und medizinischen Einrichtungen Gestaltungsregeln
- Änderung Nr. 1 SP 149.13330.2012 Rehabilitationszentren für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen Gestaltungsregeln
- Änderung Nr. 1 SP 150.13330.2012 Wohnheime für behinderte Kinder Gestaltungsregeln
- Änderung Nr. 1 SP 19.13330.2011 Masterpläne landwirtschaftlicher Betriebe Aktualisierte Version von SNiP II-97-76*
- Änderung Nr. 1 SP 28.13330.2012 Schutz von Gebäudestrukturen vor Korrosion Aktualisierte Version von SNiP 2.03.11-85
- Änderung Nr. 1 SP 31.13330.2012 Wasserversorgung Externe Netzwerke und Strukturen Aktualisierte Version von SNiP 2.04.02-84
- Änderung Nr. 1 SP 59.13330.2012 Zugänglichkeit von Gebäuden und Bauwerken für Personen mit eingeschränkter Mobilität Aktualisierte Version von SNiP 35.01.2001
- Änderung Nr. 1 SP 63.13330.2012 Beton- und Stahlbetonkonstruktionen. Grundlegende Bestimmungen Aktualisierte Ausgabe von SNiP 52-01-2003
- Änderung Nr. 1 SP 90.13330.2012 Wärmekraftwerke Aktualisierte Version von SNiP II-58-75
- Änderung Nr. 1 SP 92.13330.2012 Lager für trockene Mineraldünger und chemische Pflanzenschutzmittel Aktualisierte Version von SNiP II-108-78
- Änderung Nr. 2 SP 31.13330.2012 Wasserversorgung Externe Netzwerke und Strukturen Aktualisierte Version von SNiP 2.04.02-84
- Änderung Nr. 2 SP 63.13330.2012 Beton- und Stahlbetonkonstruktionen Grundbestimmungen Aktualisierte Ausgabe von SNiP 52-01-2003
- SP 230.1325800.2015 Gebäudeumschließungskonstruktionen Eigenschaften thermischer Inhomogenitäten
- SP 231.1311500.2015 Bau von Öl- und Gasfeldern Brandschutzanforderungen
- SP 232.1311500.2015 Brandschutz von Unternehmen Allgemeine Anforderungen
- SP 233.1326000.2015 Schienenverkehrsinfrastruktur Hochpräzises Koordinatensystem
- SP 234.1326000.2015 Eisenbahnautomatisierung und Telemechanik Regeln für Bau und Installation
- SP 235.1326000.2015 Eisenbahnautomatisierung und Telemechanik Designregeln
- SP 236.1326000.2015 Abnahme und Inbetriebnahme von Eisenbahninfrastrukturanlagen
- SP 237.1326000.2015 Eisenbahnverkehrsinfrastruktur Allgemeine Anforderungen
- SP 238.1326000.2015 Eisenbahngleis
- SP 239.1326000.2015 Fahrgastinformationssysteme, Warnungen für Gleisarbeiter und Parkkommunikation im Schienenverkehr
- SP 240.1311500.2015 Flüssigerdgasspeicheranlagen Brandschutzanforderungen
- SP 241.1311500.2015 Brandschutzsysteme Automatische Wasserfeuerlöschsysteme für Hochregallager Designstandards und -regeln
- SP 242.1325800.2015 Gebäude der Gebietskörperschaften des Pensionsfonds der Russischen Föderation Gestaltungsregeln
- SP 243.1326000.2015 Planung und Bau von verkehrsberuhigten Straßen
- SP 244.1326000.2015 Kabeltrassen von Eisenbahninfrastrukturanlagen
- SP 245.1325800.2015 Korrosionsschutz linearer Objekte und Strukturen im Öl- und Gaskomplex Regeln für die Produktion und Abnahme von Arbeiten
- SP 20.13330.2016 Belastungen und Stöße. Aktualisierte Version von SNiP 2.01.07-85* (mit Änderung Nr. 1)
- SP 22.13330.2016 Fundamente von Gebäuden und Bauwerken. Aktualisierte Version von SNiP 2.02.01-83*
- SP 246.1325800.2016 Vorschriften über die Aufsicht des Planers über den Bau von Gebäuden und Bauwerken
- SP 264.1325800.2016 Leichte Tarnung von besiedelten Gebieten und nationalen Wirtschaftseinrichtungen. Aktualisierte Version von SNiP 2.01.53-84
- SP 30.13330.2016 Interne Wasserversorgung und Kanalisation von Gebäuden. Aktualisierte Version von SNiP 2.04.01-85* (mit Änderung)
- SP 42.13330.2016 Stadtplanung. Planung und Entwicklung städtischer und ländlicher Siedlungen. Aktualisierte Version von SNiP 2.07.01-89*
- SP 47.13330.2016 Ingenieurgutachten für den Bau. Grundbestimmungen. Aktualisierte Version von SNiP 11-02-96
- SP 60.13330.2016 Heizung, Lüftung und Klimaanlage. Aktualisierte Version von SNiP 41-01-2003
- SP 72.13330.2016 Schutz von Gebäudestrukturen und Bauwerken vor Korrosion. Aktualisierte Version von SNiP 3.04.03-85
- SP 73.13330.2016 Interne Sanitärsysteme von Gebäuden Aktualisierte Version von SNiP 3.05.01-85
- SP 76.13330.2016 Elektrische Geräte. Aktualisierte Version von SNiP 3.05.06-85
- SP 93.13330.2016 Schutzkonstruktionen für den Zivilschutz in unterirdischen Bergwerken. Aktualisierte Version von SNiP 2.01.54-84
- SP 94.13330.2016 Anpassung kommunaler Einrichtungen für die sanitäre Behandlung von Menschen, Sonderbehandlung von Kleidung und rollenden Fahrzeugen. Aktualisierte Version von SNiP 2.01.57-85
- SP 95.13330.2016 Beton- und Stahlbetonkonstruktionen aus dichtem Silikatbeton. Aktualisierte Version von SNiP 2.03.02-86
- SP 96.13330.2016 „SNiP 2.03.03-85 Bewehrte Zementkonstruktionen“
- SP 127.13330.2017 Deponien zur Neutralisierung und Entsorgung giftiger Industrieabfälle. Grundlegende Bestimmungen zur Gestaltung. SNiP 2.01.28-85
- SP 16.13330.2017 „Stahlkonstruktionen. Aktualisierte Ausgabe von SNiP II-23-81*“ (mit Ergänzung, mit Änderung Nr. 1)
- SP 17.13330.2017 Dächer. Aktualisierte Ausgabe von SNiP II-26-76
- SP 382.1325800.2017 Verleimte Holzkonstruktionen auf verleimten Stäben. Berechnungsmethoden
- SP 71.13330.2017 Isolier- und Endbeschichtungen. Aktualisierte Ausgabe von SNiP 3.04.01-87 (mit Änderung Nr. 1)
- SP 32.13330.2018 Kanalisation. Externe Netzwerke und Strukturen. SNiP 2.04.03-85
- SP 383.1325800.2018 Sport- und Erholungskomplexe. Designregeln
- SP 384.1325800.2018 Zeltkonstruktionen. Designregeln
- SP 385.1325800.2018 Schutz von Gebäuden und Bauwerken vor fortschreitendem Einsturz. Designregeln. Grundbestimmungen
- SP 386.1325800.2018 Durchscheinende Polycarbonatstrukturen. Designregeln
- SP 388.1311500.2018 Objekte des kulturellen Erbes für religiöse Zwecke. Brandschutzanforderungen
- SP 390.1325800.2018 Gebäude und Strukturen adaptiver Sportschulen und adaptiver Sportzentren. Designregeln
- SP 392.1325800.2018 Haupt- und Feldpipelines für Öl und Gas. Bestandsdokumentation für den Bau. Formulare und Anforderungen für Wartung und Registrierung
- SP 407.1325800.2018 Erdarbeiten. Regeln für die Produktion mittels Hydromechanisierung
- SP 408.1325800.2018 Detaillierte seismische Zoneneinteilung und seismische Mikrozonierung für die Raumplanung
- SNiPs
- Abschnitt 1. Organisatorische und methodische normative Dokumente
- 01. System der Regulierungsdokumente im Bauwesen
- SNiP 1.01.01-82* System der Regulierungsdokumente im Bauwesen Grundbestimmungen (mit Änderungen Nr. 1, 2)
- 02. Organisation, Methodik und Ökonomie von Design- und Ingenieurstudien
- SNiP 1.02.01-85 Anweisungen zur Zusammenstellung, zum Verfahren zur Entwicklung, Koordinierung und Genehmigung von Entwurfs- und Kostenvoranschlagsunterlagen für den Bau von Unternehmen, Gebäuden und Bauwerken (mit Änderungen Nr. 1, 2, 3)
- SNiP 1.02.03-83 Anleitung zur Gestaltung von Anlagen für den Bau im Ausland
- SNiP 1.02.07-87 Ingenieurvermessungen für den Bau
- 03. Organisation des Baus. Bauleitung
- 04. Standards für Entwurf und Baudauer
- SNiP 1.04.03-85 Standards für Baudauer und Rückstand beim Bau von Unternehmensgebäuden und -strukturen Teil 1-1
- SNiP 1.04.03-85 Standards für Baudauer und Rückstand beim Bau von Unternehmensgebäuden und -strukturen Teil 1-2
- SNiP 1.04.03-85 Standards für Baudauer und Rückstand beim Bau von Unternehmensgebäuden und -strukturen, Teil 2
- 05. Bauökonomie
- SNiP 1.05.03-87 Rückstandsstandards im Wohnungsbau unter Berücksichtigung komplexer Entwicklungen
- 06. Regelungen zu Organisationen und Amtsträgern
- SNiP 1.06.04-85 Regelungen zum Chefingenieur (Chefarchitekten) des Projekts
- SNiP 1.06.05-85 Vorschriften über die Aufsicht des Planers über Planungsorganisationen beim Bau von Unternehmen, Gebäuden und Bauwerken (in der jeweils gültigen Fassung)
- 10. Standardisierung, Regulierung, Zertifizierung
- SNiP 10.01.2003 System der Regulierungsdokumente im Bauwesen Grundbestimmungen
- SNiP 10-01-94 System der Regulierungsdokumente im Bauwesen Grundbestimmungen (mit Änderungen Nr. 1, 2)
- 11. Ingenieurgutachten für Konstruktion und Design
- SNiP 11-01-95 Anweisungen zum Verfahren zur Entwicklung, Koordination, Genehmigung und Erstellung von Entwurfsunterlagen für den Bau von Unternehmen, Gebäuden und Bauwerken
- SNiP 11-02-96 Ingenieurvermessungen für den Bau Grundbestimmungen
- SNiP 11-03-2001 Standard-Designdokumentation
- SNiP 11.04.2003 Hinweise zum Verfahren zur Entwicklung, Koordinierung, Prüfung und Genehmigung städtebaulicher Unterlagen
- 12. Produktion
- SNiP 01.12.2004 Organisation des Baus
- SNiP 12.03.2001 Arbeitssicherheit im Baugewerbe. Teil 1. Allgemeine Anforderungen
- SNiP 12.03.99 Arbeitssicherheit im Baugewerbe. Teil 1. Allgemeine Anforderungen (mit Änderung Nr. 1)
- SNiP 12.04.2002 Arbeitssicherheit im Baugewerbe. Teil 2. Bauproduktion
- 13. Betrieb
- 14. Stadtplanungskataster
- SNiP 14.01.96 Grundbestimmungen für die Erstellung und Pflege des staatlichen Stadtplanungskatasters der Russischen Föderation
- 15. Architektur- und Stadtplanungstätigkeiten
- SNiP I-2 Konstruktionsterminologie
- 01. System der Regulierungsdokumente im Bauwesen
- Abschnitt 2. Allgemeine technische Regulierungsdokumente
- 01. Allgemeine Designstandards
- SNiP 2.01.01-82 Bauklimatologie und Geophysik
- SNiP 2.01.02-85* Brandschutznormen
- SNiP 2.01.07-85* Belastungen und Stöße (mit Änderungen Nr. 1, 2)
- SNiP 2.01.09-91 Gebäude und Bauwerke in verminten Gebieten und Pflanzböden
- SNiP 2.01.14-83 Bestimmung der hydrologischen Entwurfseigenschaften
- SNiP 2.01.15-90 Ingenieurtechnischer Schutz der Gebiete von Gebäuden und Bauwerken vor gefährlichen geologischen Prozessen. Grundprinzipien des Designs.
- SNiP 2.01.28-85 Deponien zur Neutralisierung und Entsorgung giftiger Industrieabfälle Grundlegende Gestaltungsbestimmungen
- SNiP 2.01.51-90 Ingenieurtechnische und technische Maßnahmen des Zivilschutzes
- SNiP 2.01.53-84 Leichte Tarnung von besiedelten Gebieten und nationalen Wirtschaftseinrichtungen
- SNiP 2.01.54-84 Schutzkonstruktionen für den Zivilschutz in unterirdischen Bergwerken
- SNiP 2.01.55-85 Volkswirtschaftliche Einrichtungen in Untertagebergwerken
- SNiP 2.01.57-85 Anpassung kommunaler Einrichtungen für die sanitäre Behandlung von Menschen, Sonderbehandlung von Fahrzeugen
- 02. Stiftungen und Fundamente
- SNiP 2.02.01-83* Fundamente von Gebäuden und Bauwerken
- SNiP 2.02.02-85* Fundamente von Wasserbauwerken (mit Änderung Nr. 1)
- SNiP 2.02.03-85 Pfahlgründungen
- SNiP 2.02.04-88 Fundamente und Fundamente auf Permafrostböden
- SNiP 2.02.05-87 Fundamente von Maschinen mit dynamischen Belastungen
- 03. Gebäudestrukturen
- SNiP 2.03.01-84* Beton- und Stahlbetonkonstruktionen (mit Änderungen Nr. 1, 2)
- SNiP 2.03.02-86 Beton- und Stahlbetonkonstruktionen aus dichtem Silikatbeton
- SNiP 2.03.03-85 Verstärkte Zementkonstruktionen
- SNiP 2.03.04-84 Beton- und Stahlbetonkonstruktionen, die für den Betrieb unter Bedingungen erhöhter und hoher Temperaturen bestimmt sind
- SNiP 2.03.06-85 Aluminiumkonstruktionen
- SNiP 2.03.09-85 Asbestzementkonstruktionen
- SNiP 2.03.11-85 Schutz von Gebäudestrukturen vor Korrosion
- SNiP 2.03.13-88 Etagen
- 04. Technische Ausrüstung von Gebäuden und Bauwerken. Externe Netzwerke
- SNiP 2.04.01-85* Interne Wasserversorgung und Kanalisation von Gebäuden
- SNiP 2.04.02-84 (in der Fassung vom 1.1986, Änderung 2000) Wasserversorgung. Externe Netzwerke und Strukturen
- SNiP 2.04.03-85 Kanalisation. Externe Netzwerke und Strukturen (mit Änderung Nr. 1)
- SNiP 2.04.05-91 Heizung, Lüftung und Klimaanlage (mit Änderungen Nr. 1, 2, 3)
- SNiP 2.04.07-86 Wärmenetze
- SNiP 2.04.08-87* Gasversorgung (mit Änderungen 1, 2, 3, 4)
- SNiP 2.04.09-84 (in der Fassung vom 1. 1997) Brandautomatik von Gebäuden und Bauwerken
- SNiP 2.04.12-86 Festigkeitsberechnung von Stahlrohrleitungen
- SNiP 2.04.14-88 Wärmedämmung von Geräten und Rohrleitungen
- 05. Transportstrukturen
- SNiP 2.05.02-85 Autobahnen
- SNiP 2.05.03-84* Brücken und Rohre.
- SNiP 2.05.06-85 (2000) Hauptpipelines
- SNiP 2.05.07-91 (1996, geändert am 1.1996) Industrietransport
- SNiP 2.05.09-90 Straßenbahn- und Trolleybuslinien
- SNiP 2.05.11-83 (1984) Feldwege in Kollektivwirtschaften, Staatswirtschaften und anderen landwirtschaftlichen Betrieben und Organisationen.
- SNiP 2.05.13-90 In Städten und anderen besiedelten Gebieten verlegte Ölproduktpipelines
- 06. Wasser- und Energiebauwerke, Rekultivierungssysteme und Bauwerke
- SNiP 2.06.01-86 (1988) Wasserbauwerke. Design-Grundlagen
- SNiP 2.06.03-85 Rekultivierungssysteme und -strukturen.
- SNiP 2.06.04-82* Belastungen und Stöße auf Wasserbauwerke (Welle, Eis und von Schiffen).
- SNiP 2.06.05-84* Dämme aus Bodenmaterialien.
- SNiP 2.06.06-85 (1987) Staudämme aus Beton und Stahlbeton.
- SNiP 2.06.07-87 Stützmauern, Schiffsschleusen, Fischpassagen und Fischschutzbauwerke.
- SNiP 2.06.08-87 Beton- und Stahlbetonkonstruktionen von Wasserbauwerken.
- SNiP 2.06.09-84 Hydrauliktunnel (ersetzt SN 238-73)
- SNiP 2.06.14-85 (1989) Schutz von Minenanlagen vor Grund- und Oberflächenwasser
- SNiP 2.06.15-85 Technischer Schutz des Territoriums vor Überschwemmungen und Überschwemmungen
- 07. Planung und Entwicklung von Siedlungen
- SNiP 2.07.01-89* Stadtplanung. Planung und Entwicklung städtischer und ländlicher Siedlungen
- 08. Wohn- und öffentliche Gebäude
- SNiP 2.08.01-89 Wohngebäude
- SNiP 2.08.02-89 Öffentliche Gebäude und Bauwerke
- 09. Industriebetriebe, Industriegebäude und -konstruktionen, Nebengebäude. Inventargebäude
- SNiP 2.09.02-85 Industriegebäude
- SNiP 2.09.03-85 Bau von Industrieunternehmen.
- SNiP 2.09.04-87 (2000) Verwaltungs- und Wohngebäude
- 10. Landwirtschaftliche Betriebe, Gebäude und Bauwerke
- SNiP 2.10.02-84 (in der Fassung vom 1.2000) Gebäude und Räumlichkeiten für die Verarbeitung und Lagerung landwirtschaftlicher Produkte
- SNiP 2.10.03-84 (in der Fassung von 1.2000) Gebäude und Räumlichkeiten für die Geflügel- und Pelztierhaltung
- SNiP 2.10.04-85 (in der Fassung von 1 2000) Gewächshäuser und Gewächshäuser
- SNiP 2.10.05-85 (1988, geändert 1 2000) Unternehmen, Gebäude und Strukturen für die Lagerung und Verarbeitung von Getreide.
- 11. Lager
- SNiP 2.11.01-85* Lagergebäude
- SNiP 2.11.02-87 (in der Fassung von 1 2000) Kühlschränke
- SNiP 2.11.03-93 Öl- und Erdölproduktlager. Brandschutzbestimmungen
- SNiP 2.11.04-85 Unterirdische Lageranlagen für Öl, Erdölprodukte und Flüssiggase
- SNiP 2.11.06-91 Lager für Waldmaterialien. Brandschutz-Designnormen (ersetzt SN 473-75)
- 12. Landzuteilungsnormen
- 20. Grundlegende Bestimmungen für die Zuverlässigkeit von Bauwerken
- 21. Brandschutz
- SNiP 21-01-97* Brandschutz von Gebäuden und Bauwerken (mit Änderungen Nr. 1, 2)
- SNiP 21-02-99 Parkplätze
- SNiP 21.03.2003 Lagerhäuser für Waldmaterialien. Brandschutzbestimmungen
- 22. Schutz vor gefährlichen geophysikalischen Einflüssen
- SNiP 22-01-95 Geophysik gefährlicher natürlicher Einflüsse
- SNiP 22.02.2003 Ingenieurtechnischer Schutz von Territorien, Gebäuden und Bauwerken vor gefährlichen geologischen Prozessen. Grundbestimmungen
- 23. Raumklima und Schutz vor schädlichen Einflüssen
- SNiP 23-01-99* Bauklimatologie (mit Änderung Nr. 1)
- SNiP 23.02.2003 Wärmeschutz von Gebäuden
- SNiP 23.03.2003 Lärmschutz
- SNiP 23-05-95 Natürliche und künstliche Beleuchtung (mit Änderung Nr. 1)
- 24. Größenaustauschbarkeit und Kompatibilität
- SNiP II-108-78 Lager für trockene Mineraldünger und chemische Pflanzenschutzmittel
- SNiP II-11-77* Schutzbauten für den Zivilschutz
- SNiP II-12-77 Lärmschutz
- SNiP II-22-81 (1995) Stein- und verstärkte Mauerwerkskonstruktionen
- SNiP II-23-81* Stahlkonstruktionen (in der jeweils gültigen Fassung)
- SNiP II-25-80 (1988) Holzkonstruktionen
- SNiP II-26-76 Dächer (in der geänderten Fassung)
- SNiP II-3-79* Bauheizungstechnik (mit Änderungen Nr. 1-4)
- SNiP II-35-76* Kesselinstallationen
- SNiP II-44-78 Eisenbahn- und Straßentunnel
- SNiP II-58-75 Wärmekraftwerke
- SNiP II-7-81* Bau in seismischen Gebieten
- SNiP II-89-80* Allgemeine Pläne für Industrieunternehmen
- SNiP II-90-81 Industriegebäude von Industrieunternehmen
- SNiP II-94-80 Unterirdische Minenanlagen
- SNiP II-97-76 Allgemeine Pläne für landwirtschaftliche Betriebe
- SNiP II-A.3-62 Klassifizierung von Gebäuden und Bauwerken. Design-Grundlagen
- SNiP II-V.8-71 Etagen. Designstandards
- SNiP II-K.2-62 Planung und Entwicklung besiedelter Gebiete. Designstandards
- 01. Allgemeine Designstandards
- Abschnitt 3. Regulierungsdokumente zu Stadtplanung, Gebäuden und Bauwerken
- 01. Allgemeine Regeln der Bauproduktion
- SNiP 3.01.01-85* Organisation der Bauproduktion (mit Änderungen Nr. 1, 2)
- SNiP 3.01.03-84 Geodätische Arbeiten im Bauwesen
- SNiP 3.01.04-87 Inbetriebnahme fertiggestellter Bauanlagen
- SNiP 3.01.09-84 Inbetriebnahme fertiggestellter Schutzbauten und deren Instandhaltung in Friedenszeiten (anstelle von SN 464-74)
- 02. Stiftungen und Fundamente
- SNiP 3.02.01-87 Erdarbeiten, Fundamente und Fundamente
- SNiP 3.02.03-84 Unterirdische Minenanlagen
- 03. Gebäudestrukturen
- SNiP 3.03.01-87 Tragende und umschließende Konstruktionen
- 04. Schutz-, Isolier- und Endbeschichtungen
- SNiP 3.04.01-87 Isolier- und Endbeschichtungen
- SNiP 3.04.03-85 Schutz von Gebäudestrukturen und Bauwerken vor Korrosion
- 05. Ingenieurtechnische und technologische Ausrüstung und Netzwerke
- SNiP 3.05.01-85 Interne Sanitärsysteme (mit Änderung Nr. 1)
- SNiP 3.05.02-88* Gasversorgung (mit Änderungen 1 und 2)
- SNiP 3.05.03-85 Wärmenetze
- SNiP 3.05.04-85* Externe Netzwerke sowie Wasserversorgungs- und Abwasserstrukturen
- SNiP 3.05.05-84 Prozessausrüstung und Prozessleitungen
- SNiP 3.05.06-85 Elektrische Geräte
- SNiP 3.05.07-85 (in der Fassung vom 1. 1990) Automatisierungssysteme
- 06. Transportstrukturen
- SNiP 3.06.03-85 Autobahnen
- SNiP 3.06.04-91 Brücken und Rohre
- SNiP 3.06.07-86 Brücken und Rohre Regeln für Inspektion und Prüfung
- 07. Wasser- und Energiebauwerke, Rekultivierungssysteme und Bauwerke
- SNiP 3.07.01-85 Flusswasserbauwerke
- SNiP 3.07.02-87 Hydraulische See- und Flusstransportstrukturen
- SNiP 3.07.03-85 (in der Fassung vom 1. 1991) Rekultivierungssysteme und -strukturen
- 08. Mechanisierung der Bauproduktion
- SNiP 3.08.01-85 Mechanisierung der Bauproduktion. Schienen für Turmdrehkrane
- 09. Herstellung von Baukonstruktionen, Produkten und Materialien
- SNiP 3.09.01-85 (in der Fassung vom 1. 1988, 2. 1994) Herstellung von vorgefertigten Stahlbetonkonstruktionen und -produkten
- 30. Stadtplanung
- SNiP 30-02-97* Planung und Entwicklung von Territorien für Gartenbau-Datscha-Vereinigungen von Bürgern, Gebäuden und Bauwerken (mit Änderung Nr. 1)
- 31. Wohn-, öffentliche und industrielle Gebäude und Bauwerke
- SNiP 31.01.2003 Wohn-Mehrfamilienhäuser
- SNiP 31.02.2001 Einfamilienhäuser
- SNiP 31.03.2001 Industriegebäude
- SNiP 31.04.2001 Lagergebäude
- SNiP 31.05.2003 Öffentliche Gebäude für Verwaltungszwecke
- SNiP 31.06.2009 Öffentliche Gebäude und Bauwerke
- 32. Transportstrukturen
- SNiP 32-01-95 Eisenbahnen mit einer Spurweite von 1520 mm
- SNiP 32.02.2003 U-Bahnen
- SNiP 32-03-96 Flugplätze
- SNiP 32-04-97 Eisenbahn- und Straßentunnel
- 33. Wasser- und Rekultivierungsbauwerke
- SNiP 33.01.2003 Wasserbauwerke. Grundbestimmungen
- 34. Haupt- und Feldleitungen
- SNiP 34-02-99 Unterirdische Speicheranlagen für Gas, Öl und deren Produkte
- 35. Gewährleistung eines barrierefreien Lebensumfelds für Menschen mit Behinderungen und andere Bevölkerungsgruppen mit eingeschränkter Mobilität
- SNiP 35-01-2001 Zugänglichkeit von Gebäuden und Bauwerken für Menschen mit eingeschränkter Mobilität
- SNiP III-10-75 Landschaftsbau
- SNiP III-18-75 (in der Fassung von 1978, 1985, 1995) Metallkonstruktionen
- SNiP III-24-75 Industrieöfen und Ziegelrohre
- SNiP III-39-76 Straßenbahngleise
- SNiP III-4-80* Sicherheitsvorkehrungen im Bauwesen (mit Änderungen 1-5)
- SNiP III-41-76 Kontaktnetze für den elektrifizierten Verkehr
- SNiP III-42-80 (in der Fassung von 1983, 1987, 1997) Hauptpipelines
- SNiP III-44-77 (in der Fassung von 1981) Eisenbahn-, Straßen- und hydraulische Tunnel. U-Bahnen
- SNiP III-46-79 Flugplätze
- SNiP III-V.5-62* Metallkonstruktionen. Regeln für Herstellung, Installation und Abnahme
- 01. Allgemeine Regeln der Bauproduktion
- Abschnitt 4. Regulierungsdokumente für die technische Ausrüstung von Gebäuden und Bauwerken sowie externen Netzwerken
- 40. Wasserversorgung und Kanalisation
- 41. Wärmeversorgung, Heizung, Lüftung und Klimatisierung
- SNiP 41-01-2003 Heizung, Lüftung und Klimaanlage
- SNiP 41-02-2003 Wärmenetze
- SNiP 41-03-2003 Wärmedämmung von Geräten und Rohrleitungen. (ersetzt SNiP 2.04.14-88 (1998))
- 42. Gasversorgung
- SNiP 42-01-2002 Gasverteilungssysteme
- SNiP 4.02-91 Grundlegende Schätzungsstandards und Preise. Sammlungen von Schätzstandards und Preisen für Bauleistungen
- SNiP 4.03-91 Sammlung geschätzter Standards und Preise für den Betrieb von Baumaschinen
- SNiP 4.04-91 Sammlung geschätzter Preise für Materialien, Produkte und Strukturen
- SNiP 4.05-91 Allgemeine Bestimmungen für die Anwendung von Schätzstandards und Preisen für Bauarbeiten
- SNiP 4.06-91 Preissammlungen für die Geräteinstallation
- SNiP 4.07-91 Sammlung geschätzter Standards für Mehrkosten bei Bau- und Installationsarbeiten im Winter
- SNiP 4.09-91 Sammlung geschätzter Kostenstandards für den Bau von temporären Gebäuden und Bauwerken
- SNiP IV-13-84 Sammlungen geschätzter Kostenstandards für Ausrüstung und Inventar öffentlicher und Verwaltungsgebäude
- SNiP IV-2-82 Sammlung elementarer Schätzungsstandards für Baustrukturen und Arbeiten
- Abschnitt 5. Regulierungsdokumente für Baukonstruktionen und Produkte
- 01. Materialverbrauchsstandards
- SNiP 5.01.01-82 Verbrauchsstandards für Materialien, Produkte und Rohre pro 1 Million Rubel. geschätzte Kosten für Bau- und Installationsarbeiten. Kommunalbau. Verbraucherdienstleistungen für die Bevölkerung
- SNiP 5.01.02-83 Verbrauchsstandards für Materialien, Produkte und Rohre pro 1 Million Rubel. geschätzte Kosten für Bau- und Installationsarbeiten. Mikrobiologische Industrie. Medizinische Industrie. Geologie und Untergrunderkundung. Filmindustrie (statt SN 501-77, SN 520-79,
- SNiP 5.01.03-85 Verbrauchsstandards für Materialien, Produkte und Rohre pro 1 Million Rubel. geschätzte Kosten für Bau- und Installationsarbeiten an Anlagen der Gasindustrie (anstelle von SN 505-78, SN 526-80 in Bezug auf den Rohrverbrauch)
- SNiP 5.01.04-84 Verbrauchsstandards für Materialien, Produkte und Rohre pro 1 Million Rubel. geschätzte Kosten für Bau- und Installationsarbeiten. Chemische Industrie. Petrochemische Industrie (anstelle von SN 424-78, SN 526-80)
- SNiP 5.01.05-85 Verbrauchsstandards für Materialien, Produkte und Rohre pro 1 Million Rubel. geschätzte Kosten für Bau- und Installationsarbeiten bei wasserwirtschaftlichen Bauprojekten
- SNiP 5.01.06-86 Verbrauchsstandards für Materialien, Produkte und Rohre pro 1 Million Rubel. geschätzte Kosten für Bau- und Installationsarbeiten an Elektrizitätsanlagen
- SNiP 5.01.07-84 Verbrauchsstandards für Materialien, Produkte und Rohre pro 1 Million Rubel. geschätzte Kosten für Bau- und Installationsarbeiten für Anlagen zur Ölförderung, Ölraffinierung und zum Transport von Öl und Erdölprodukten (anstelle von SN 504-78, SN-505-78, SN 526).
- SNiP 5.01.08-84 Verbrauchsstandards für Materialien, Produkte und Rohre pro 1 Million Rubel. geschätzte Kosten für Bau- und Installationsarbeiten. Baustoffindustrie, Baugewerbe, Baukonstruktionen und Teileindustrie
- SNiP 5.01.09-84 Verbrauchsstandards für Materialien, Produkte und Rohre pro 1 Million Rubel. geschätzte Kosten für Bau- und Installationsarbeiten. Handel und Gastronomie. Druckindustrie. Flusstransport. Fleisch- und Milchindustrie. Mehl und Getreide
- SNiP 5.01.10-84 Verbrauchsstandards für Materialien, Produkte und Rohre pro 1 Million Rubel. geschätzte Kosten für Bau- und Installationsarbeiten an Forst- und Holzverarbeitungs-, Zellstoff- und Papierindustrie- und Forstanlagen (anstelle von SN 501-77, SN 415-78, SN 526-80).
- SNiP 5.01.11-85 Verbrauchsstandards für Materialien, Produkte und Rohre pro 1 Million Rubel. geschätzte Kosten für Bau- und Installationsarbeiten an Eisenmetallurgieanlagen
- SNiP 5.01.12-85 Verbrauchsstandards für Materialien, Produkte und Rohre pro 1 Million Rubel. geschätzte Kosten für Bau- und Installationsarbeiten bei Maschinenbauprojekten
- SNiP 5.01.13-85 Verbrauchsstandards für Materialien, Produkte und Rohre pro 1 Million Rubel. geschätzte Kosten für Bau- und Installationsarbeiten für die Leicht-, Lebensmittel- und Fischereiindustrie
- SNiP 5.01.14-85 Verbrauchsstandards für Materialien, Produkte und Rohre pro 1 Million Rubel. geschätzte Kosten für Bau- und Installationsarbeiten für die Nichteisenmetallurgie-, Kohle-, Torf- und Schieferindustrie
- SNiP 5.01.16-85 Verbrauchsstandards für Materialien, Produkte und Rohre pro 1 Million Rubel. geschätzte Kosten für Bau- und Installationsarbeiten bei landwirtschaftlichen Bauprojekten
- SNiP 5.01.17-85 Verbrauchsstandards für Materialien, Produkte und Rohre pro 1 Million Rubel. geschätzte Kosten für Bau- und Installationsarbeiten an Eisenbahn-, Luft-, See-, Straßentransport-, Autobahn- und U-Bahn-Bauanlagen
- SNiP 5.01.18-86 Vorschriften zur Produktionsregulierung des Materialverbrauchs im Bauwesen
- SNiP 5.01.23-83 Standardnormen für den Zementverbrauch für die Herstellung von Beton, vorgefertigtem und monolithischem Beton, Stahlbetonprodukten und -konstruktionen
- 02. Standards für den Bedarf an Baumaschinen, Werkzeugen und Mechanismen
- SNiP 5.02.02-86 Standards für den Bedarf an Bauwerkzeugen
- 03. Rationierung und Bezahlung von Entwurfs- und Vermessungsarbeiten
- 04. Rationierung und Entlohnung der Arbeitskräfte im Baugewerbe
- 50. Fundamente und Fundamente von Gebäuden und Bauwerken
- 51. Stein- und verstärkte Steinkonstruktionen
- 52. Stahlbeton und Betonkonstruktionen
- SNiP 52-01-2003 Beton- und Stahlbetonkonstruktionen. Grundbestimmungen
- 53. Metallkonstruktionen
- 54. Holzkonstruktionen
- 55. Konstruktionen aus anderen Materialien
- 56. Fenster, Türen, Tore und Beschläge dafür
- 01. Materialverbrauchsstandards
- Abschnitt 8. Regulierungsdokumente zur Wirtschaft
- 82. Material-, Kraftstoff- und Energieressourcen
- SNiP 82-01-95 Entwicklung und Anwendung von Normen und Standards für den Verbrauch materieller Ressourcen im Bauwesen. Grundbestimmungen
- SNiP 82-02-95 Bundes-(Standard-)Elementarnormen für den Zementverbrauch bei der Herstellung von Beton- und Stahlbetonprodukten und -konstruktionen
- 82. Material-, Kraftstoff- und Energieressourcen
- Abschnitt 1. Organisatorische und methodische normative Dokumente
SP 52.13330.2016 Natürliche und künstliche Beleuchtung. Aktualisierte Version von SNiP 23.05.95*
REGELWERK
SP 52.13330.2016 Natürliche und künstliche Beleuchtung
Tageslicht und künstliche Beleuchtung
Aktualisierte Ausgabe
Datum der Einführung: 08.05.2017
Status: aktiv
VORWORT
1 AUFTRAGNEHMER – Landeshaushaltsinstitution „Forschungsinstitut für Bauphysik der Russischen Akademie für Architektur und Bauwissenschaften“ (NIISF RAASN) und Gesellschaft mit beschränkter Haftung „CERES-EXPERT“ (LLC „CERES-EXPERT“)
2 EINGEFÜHRT vom Technischen Komitee für Normung TC 465 „Konstruktion“
3 VORBEREITET zur Genehmigung durch die Abteilung für Stadtentwicklung und Architektur des Ministeriums für Bauwesen, Wohnungswesen und kommunale Dienstleistungen der Russischen Föderation (Ministerium für Bauwesen Russlands)
4 GENEHMIGT durch Beschluss des Ministeriums für Bauwesen, Wohnungswesen und kommunale Dienstleistungen der Russischen Föderation vom 7. November 2016 N 777/pr und in Kraft gesetzt am 8. Mai 2017.
5 REGISTRIERT von der Bundesagentur für technische Regulierung und Metrologie (Rosstandart). Überarbeitung von SP 52.13330.2011 „SNiP 23-05-95* Natürliche und künstliche Beleuchtung“
Im Falle einer Überarbeitung (Ersetzung) oder Aufhebung dieses Regelwerks wird die entsprechende Bekanntmachung in der vorgeschriebenen Weise veröffentlicht. Relevante Informationen, Hinweise und Texte werden auch im öffentlichen Informationssystem veröffentlicht – auf der offiziellen Website des Entwicklers (Russisches Bauministerium) im Internet.
wobei E r die durchschnittliche horizontale Beleuchtung der Oberfläche ist;
ρ – durchschnittlicher Reflexionsgrad der umgebenden Oberflächen; in Fällen, in denen es unbekannt ist, wird es gleich 0,15 angenommen.
Abbildung 3.1. Beleuchtung der Pupille des Betrachters in einer Ebene senkrecht zur Blickrichtung
3,35 Betriebsfaktor (Länge des natürlichen Lichts) MF, relative Einheiten: Ein Koeffizient, der dem Verhältnis des KEO-Wertes an einem bestimmten Punkt, der durch natürliches Licht am Ende der festgelegten Lebensdauer erzeugt wird, zum KEO-Wert am gleichen Punkt zu Beginn des Betriebs entspricht.
Der Koeffizient berücksichtigt die Abnahme des CEC während des Betriebs aufgrund von Verschmutzung und Alterung durchscheinender Füllungen in Lichtöffnungen sowie eine Abnahme der Reflexionseigenschaften von Raumoberflächen:
|
|
wobei MF з ein Koeffizient ist, der die Abnahme des CEC während des Betriebs aufgrund von Verschmutzung und Alterung durchscheinender Füllungen in Lichtöffnungen berücksichtigt;
MF p ist ein Koeffizient, der die Abnahme des KEO während des Betriebs aufgrund einer Abnahme der Reflexionseigenschaften von Raumoberflächen berücksichtigt.
Notiz.
Der Betriebsfaktor ist der Kehrwert des bisher verwendeten Sicherheitsfaktors K z für natürliche Beleuchtung (MF = 1/K z).
3,36 Betriebsfaktor (für künstliche Beleuchtung) MF, relative Einheiten: Ein Koeffizient, der dem Verhältnis der von einer Beleuchtungsanlage am Ende ihrer spezifizierten Lebensdauer erzeugten Beleuchtung oder Helligkeit an einem bestimmten Punkt zur Beleuchtung oder Helligkeit am gleichen Punkt zu Beginn des Betriebs entspricht.
Der Koeffizient berücksichtigt auch die Abnahme der Beleuchtungsstärke oder Helligkeit während des Betriebs der Beleuchtungsanlage aufgrund einer Abnahme des Lichtstroms, des Ausfalls von Lichtquellen und nicht behebbarer Änderungen der Reflexions- und Transmissionseigenschaften der optischen Elemente von Beleuchtungsgeräten als Verschmutzung der Raumoberflächen, der Außenwände eines Gebäudes oder Bauwerks, der Fahrbahn oder des Gehwegs:
wobei MF sp ein Koeffizient ist, der den Rückgang des Lichtstroms von Lichtquellen berücksichtigt;
MF vi - Koeffizient unter Berücksichtigung des Ausfalls von Lichtquellen;
MF op ist ein Koeffizient, der Verschmutzung und nicht wiederherstellbare Änderungen der Reflexions- und Transmissionseigenschaften optischer Elemente von Beleuchtungsgeräten berücksichtigt;
MF p ist ein Koeffizient, der die Verschmutzung reflektierender Oberflächen eines Raumes oder einer Struktur berücksichtigt.
Notiz.
Der Betriebsfaktor ist umgekehrt proportional zum Sicherheitsfaktor K z: (MF = 1/K z).
3.37 lokale Architekturbeleuchtung: Beleuchtung eines Teils eines Gebäudes oder Bauwerks sowie einzelner architektonischer Elemente ohne Flutlicht.
3.38 Medienfassade: Eine lichtdurchlässige Werbestruktur, die direkt auf der Oberfläche der Wände von Gebäuden, Bauwerken und Bauwerken oder auf einem Metallrahmen platziert wird, der die Kunststoffwand nachbildet (im Falle der Platzierung einer Medienfassade auf der vorhandenen Verglasung eines Gebäudes, Bauwerks, Bauwerks). ), die die Anzeige von Informationsmaterialien ermöglicht. Die Größe des Informationsfeldes der Medienfassade wird durch die Größe des angezeigten Bildes bestimmt.
3.39 lokale Beleuchtung: Zusätzliche Beleuchtung zur allgemeinen Beleuchtung durch Lampen, die den Lichtstrom direkt auf den Arbeitsplatz konzentrieren.
3.40 bewölkter Himmel CIE: Ein vollständig von Wolken bedeckter Himmel, dessen Helligkeitsverteilung durch den Standard der International Commission on Illumination (CIE) bestimmt wird. Das Verhältnis der Helligkeit des Himmels in einer Höhe γ über dem Horizont zur Helligkeit im Zenit wird durch die Formel bestimmt
|
|
L a(0°) = 1 (am Horizont).
3.41 Allgemeine Gleichmäßigkeit der Verteilung der Helligkeit der Straßenoberfläche U 0: Das Verhältnis des Mindestwerts der Straßenoberflächenhelligkeit zum Durchschnitt:
![]() .
.
3.42 Allgemeine gleichmäßige künstliche Beleuchtung von Räumlichkeiten: Beleuchtung, bei der Lampen im oberen Bereich des Raumes platziert werden und eine gleichmäßige Lichtverteilung an den Arbeitsplätzen erzeugen.
3.43 Allgemeine lokale künstliche Beleuchtung von Räumlichkeiten: Beleuchtung, bei der Lampen im oberen Bereich des Raumes direkt über den Geräten platziert werden.
3,44 kombinierter Unbehagen-Index UGR, relative Einheiten: Ein Kriterium zur Beurteilung unangenehmer Helligkeit, das bei ungleichmäßiger Helligkeitsverteilung im Sichtfeld unangenehme Empfindungen hervorruft, bestimmt durch die Formel
|
|
Wo L ich- Helligkeit der brillanten Quelle, cd/m2;
ω i – Winkelgröße der hellen Quelle, Steradianten;
p ich- Index der Position der hellen Quelle relativ zur Sichtlinie;
L a- Anpassung der Helligkeit, cd/m2.
3.45 Gegenstand der Auszeichnung: Der betreffende Artikel, sein Einzelteil oder der Fehler, der während des Arbeitsprozesses unterschieden werden muss.
3.46 Beleuchtung von Hochrisikobereichen: Eine Art Notbeleuchtung für den sicheren Abschluss eines potenziell gefährlichen Arbeitsprozesses.
3.47 Beleuchtung von Fluchtwegen: Eine Art Evakuierungsbeleuchtung zur zuverlässigen Identifizierung und sicheren Nutzung von Fluchtwegen.
3,48 Beleuchtung E, Lux: Das Verhältnis des auf ein Flächenelement, das den betrachteten Punkt enthält, einfallenden Lichtstroms dФ zur Fläche dA dieses Elements:
3,49 relative Fläche der Lichtöffnungen S f /S p, S o /S p, %: Das Verhältnis der Fläche von Laternen oder Fenstern zur beleuchteten Grundfläche des Raumes.
3,50 aufgeladener Glanz: Die Eigenschaft der Reflexion des Lichtstroms von der Arbeitsfläche in Richtung der Augen des Arbeiters, die die Verschlechterung der Sichtbarkeit aufgrund einer übermäßigen Erhöhung der Helligkeit der Arbeitsfläche und des Schleiereffekts bestimmt, wodurch der Kontrast zwischen dem Objekt verringert wird und der Hintergrund.
3,51 relative spezifische Leistung der Straßenbeleuchtung Dp, W/(m 2 Lux): Ein Indikator für die Energieeffizienz der Beleuchtung eines Straßenabschnitts, bestimmt durch das Verhältnis der Leistung der installierten Beleuchtungsgeräte zur Fläche des Abschnitts und der durchschnittlichen Beleuchtung.
3,52 Kreuzung: Ein Verkehrsknotenpunkt, an dem zwei oder mehr Straßen oder Wege auf gleicher Höhe miteinander verbunden sind oder sich kreuzen.
3,53 Fensterfläche S0, m2: Die Gesamtfläche der Lichtöffnungen (im Licht), die sich in den Außenwänden des beleuchteten Raumes befinden.
3,54 Laternenfläche S f, m 2: Die Gesamtfläche der Lichtöffnungen (in Licht) aller Lampen, die sich in der Beschichtung über dem beleuchteten Raum oder Erker befinden.
3,55 Tunnelzufahrtsbereich: Ein Straßenabschnitt außerhalb des Tunnels mit einer Länge, die dem Sicherheitsbremsweg entspricht, neben dem Eingangsportal.
3,56 halbzylindrische Beleuchtung E pc, Lux: Das Verhältnis des auf die Außenfläche eines unendlich kleinen Halbzylinders mit Mittelpunkt an einem bestimmten Punkt einfallenden Lichtstroms zur Fläche der Zylinderfläche dieses Halbzylinders
Anmerkungen:
- Sofern nicht anders angegeben, sollte die Achse des Halbzylinders vertikal liegen.
- In Bezug auf die zweckmäßige Außenbeleuchtung wird die halbzylindrische Beleuchtung als Kriterium für die Beurteilung der Gesichtsunterscheidung entgegenkommender Fußgänger verwendet und ist definiert als die durchschnittliche Lichtstromdichte auf der zylindrischen Oberfläche eines unendlich kleinen Halbzylinders, der vertikal auf der Längsseite angeordnet ist Straßenlinie in 1,5 m Höhe und mit der Außennormalen zu einem ebenen Seitenflächenhalbzylinder in Richtung des primären Fußgängerverkehrs ausgerichtet.
3.57 Raum ohne Tageslicht: Ein Raum, in dem der natürliche Lichtfaktor unter 0,1 % liegt.
3.58 Raum mit unzureichendem Tageslicht: Ein Raum, in dem der natürliche Beleuchtungskoeffizient niedriger als normal ist.
3.59 Räumlichkeiten mit Dauerbelegung: Ein Raum, in dem Menschen den Großteil (mehr als 50 %) ihrer Arbeitszeit tagsüber oder länger als 2 Stunden ununterbrochen verbringen.
3,60 Tunnelschwellenzone: Ein Tunnelabschnitt mit einer Länge gleich dem Sicherheitsbremsweg neben dem Eingangsportal.
3.61 Schwellenwert Helligkeitserhöhung TI, %: Ein Kriterium, das die Blendwirkung von Beleuchtungsanlagenleuchten im Sichtfeld des Fahrers eines Fahrzeugs regelt. Bezeichnet die Zunahme des Kontrasts zwischen einem Objekt und seinem Hintergrund, bei der die Sichtbarkeit des Objekts in Gegenwart einer hellen Lichtquelle dieselbe wäre wie in deren Abwesenheit. Bestimmt durch die Formel
|
|
Wo Durchschnittl- durchschnittliche Helligkeit der Straßenoberfläche, cd/m2;
k - Multiplikator gleich 950 bei Durchschnittl> 5 cd/m2 und 650 at Durchschnittl≤ 5 cd/m2;
Ev,i- vertikale Beleuchtung des Auges des Fahrers durch die i-te Lampe, Lux;
θ i - Winkel zwischen Richtung auf i-te Lampe und Sichtlinie, Grad;
n ist die Anzahl der Lampen, die innerhalb des Winkelintervalls θ (2°) in das Sichtfeld des Fahrers fallen< θ < 20°).
3,62 maximale Gleichmäßigkeit der Beleuchtungsverteilung (Helligkeit). U d: Verhältnis von minimaler Beleuchtung (Helligkeit) zu maximalem:
3.63 Längsgleichmäßigkeit der Helligkeitsverteilung der Straßenoberfläche Ui: Verhältnis des minimalen Helligkeitswerts der Straßenoberfläche L min auf seinen Maximalwert L max entlang der Fahrspurachse:
![]() .
.
3,64 Reise: Ein Bereich, der sowohl für den Verkehr von Fahrzeugen als auch für Fußgänger vorgesehen ist.
3.65 Fluchtwege: Ein Weg, über den Personen im Notfall den Gefahrenbereich verlassen können. Es beginnt an dem Ort, an dem sich Menschen aufhalten, und endet in der sicheren Zone.
3.66 Arbeitsfläche: Die Fläche, auf der gearbeitet wird, wird genormt und die Beleuchtung gemessen.
3.67 Arbeitsbeleuchtung: Beleuchtung, die in Räumen und Arbeitsorten außerhalb von Gebäuden für einheitliche Lichtverhältnisse (Beleuchtungsstärke, Lichtqualität) sorgt.
3,68 Gleichmäßigkeit des natürlichen Lichts: Das Verhältnis des Minimalwerts zum Durchschnittswert von KEO innerhalb des charakteristischen Raumabschnitts.
3.69 Gleichmäßigkeit der Beleuchtungsverteilung (Helligkeit). U 0: Verhältnis des minimalen Beleuchtungs-(Helligkeits-)Werts zum durchschnittlichen Beleuchtungs-(Helligkeits-)Wert:
3.70 Entkopplung: Die Kreuzung von Straßen auf verschiedenen Ebenen mit Rampen, damit Fahrzeuge von einer Straße zur anderen gelangen können.
3,71 sicherer Bremsweg (RBD), m: Der Mindestabstand, der erforderlich ist, um ein Fahrzeug, das sich mit der vorgesehenen Geschwindigkeit bewegt, zuverlässig vollständig zum Stehen zu bringen.
Notiz.
Sie wird durch die Gesamtzeit bestimmt, die der Fahrer auf ein scheinbares Hindernis reagiert, um eine Entscheidung zu treffen und das Fahrzeug abzubremsen.
3,72 Entwurfsgeschwindigkeit: Die Höchstgeschwindigkeit eines einzelnen Fahrzeugs, die bei der Gestaltung der Straße berücksichtigt wird.
3,73 berechneter Wert von KEO e p, %: Der durch Berechnung ermittelte Wert bei der Beurteilung der natürlichen oder kombinierten Beleuchtung von Räumlichkeiten:

wobei L die Anzahl der Himmelsabschnitte ist, die vom berechneten Punkt aus durch die Lichtöffnung sichtbar sind;
ε bi - geometrisches KEO am Entwurfspunkt mit seitlicher Beleuchtung unter Berücksichtigung des direkten Lichts aus dem i-ten Himmelsabschnitt;
C N - Lichtklimakoeffizient, gemessen nach;
q ich- Helligkeitskoeffizient der Ungleichmäßigkeit des i-ten Abschnitts des bewölkten Himmels der CIE;
M ist die Anzahl der Fassadenabschnitte von Gebäuden mit entgegengesetzter Bebauung, die vom Entwurfspunkt aus durch die Lichtöffnung sichtbar sind;
ε Gebäudej - geometrisches KEO am Entwurfspunkt mit Seitenbeleuchtung unter Berücksichtigung des vom j-ten Abschnitt der Fassaden von Gebäuden mit entgegengesetzter Bebauung reflektierten Lichts;
b fj - durchschnittliche relative Helligkeit des j-ten Abschnitts der Fassaden von Gebäuden mit entgegengesetzter Bebauung;
r 0 - Koeffizient, der den Anstieg des KEO bei seitlicher Beleuchtung aufgrund des von den Oberflächen des Raums und der darunter liegenden Schicht neben dem Gebäude reflektierten Lichts berücksichtigt;
k Gebäudej- Koeffizient, der Änderungen der internen reflektierten Komponente des KEO in einem Raum bei Vorhandensein gegenüberliegender Gebäude berücksichtigt, bestimmt durch die Formel
wobei τ 1 die Lichtdurchlässigkeit des Materials ist;
τ 2 - Koeffizient, der den Lichtverlust in den Rahmen der Lichtöffnung berücksichtigt. Die Maße der Lichtöffnung sind gleich den Maßen des Bindekastens entsprechend dem Außenmaß;
τ 3 - Koeffizient unter Berücksichtigung des Lichtverlusts in tragenden Strukturen (bei seitlicher Beleuchtung τ 3 = 1);
τ 4 - Koeffizient unter Berücksichtigung des Lichtverlusts in Sonnenschutzgeräten;
τ 5 - Koeffizient unter Berücksichtigung des Lichtverlusts im unter den Lampen installierten Schutzgitter, angenommen gleich 0,9;
MF ist der Betriebsfaktor, bestimmt durch ;
T ist die Anzahl der Lichtöffnungen in der Beschichtung;
ε вi – geometrisches KEO am Designpunkt mit Deckenbeleuchtung aus der i-ten Öffnung;
ε av - der aus der Beziehung ermittelte Durchschnittswert des geometrischen KEO bei Deckenbeleuchtung an der Schnittlinie der bedingten Arbeitsfläche und der Ebene des charakteristischen vertikalen Raumabschnitts
hier ist N die Anzahl der Designpunkte;
r 2- Koeffizient, der den Anstieg des KEO bei Deckenbeleuchtung aufgrund des von den Raumoberflächen reflektierten Lichts berücksichtigt;
k f- Koeffizient unter Berücksichtigung des Laternentyps.
3.74 Rückfahrbeleuchtung: Eine Art Notbeleuchtung zur Weiterarbeit bei ausgeschalteter Arbeitsbeleuchtung.
3,75 Lichtklima: Der Satz natürlicher Lichtverhältnisse in einem bestimmten Bereich (Beleuchtung und Beleuchtungsstärke auf horizontalen und vertikalen Flächen unterschiedlicher Ausrichtung entlang des Horizonts, erzeugt durch diffuses Licht vom Himmel und direktes Licht von der Sonne, Sonnenscheindauer und Albedo der darunter liegenden Fläche). ) für einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren.
3,76 natürliche Lichtfaser: Ein Gerät, das natürliches Licht in ein Gebäude lenkt.
3,77 Leuchtanzeige: Sicherheitsschild mit Innenbeleuchtung.
3,78 LED: Eine Lichtquelle, die auf der Emission inkohärenter Strahlung im sichtbaren Wellenlängenbereich basiert, wenn ein elektrischer Strom durch eine Halbleiterdiode geleitet wird.
3,79 Wohngebiet: Ein Gebiet, das für die Unterbringung von Wohnungsbeständen, öffentlichen Gebäuden und Bauwerken sowie einzelner kommunaler und industrieller Einrichtungen bestimmt ist, die keine Errichtung von Sanitärschutzzonen erfordern, für den Bau von Überlandkommunikationswegen, Straßen, Plätzen, Parks, Gärten, Boulevards und andere öffentliche Plätze.
3.80 Tunnel-Thekenbeleuchtungssystem: Tunnelbeleuchtung, bei der Licht überwiegend in Richtung des Verkehrsflusses auf Objekte fällt.
Notiz.
Für eine Thekenbeleuchtung werden Lampen verwendet, deren Lichtstärkeverteilung asymmetrisch zu einer Ebene senkrecht zur Bewegungsrichtung des Verkehrsflusses ist, wobei die maximale Lichtstärke auf die Bewegung des Verkehrsflusses gerichtet ist.
3.81 Symmetrisches Tunnelbeleuchtungssystem: Tunnelbeleuchtung, bei der das Licht sowohl entlang als auch in Richtung des Verkehrsflusses gleichmäßig auf Objekte fällt.
Notiz.
Für ein symmetrisches Beleuchtungssystem werden Lampen verwendet, deren Lichtstärkeverteilung symmetrisch zu einer Ebene senkrecht zur Verkehrsflussrichtung ist.
3.82 System zur Kennzeichnung von Fluchtwegen: Ein System, das eine ausreichende Anzahl von Sicherheitszeichen bereitstellt, damit Personen im Falle einer Gefahr entlang etablierter Fluchtwege einen Ort evakuieren können.
3,83 kombinierte Beleuchtung: Beleuchtung, bei der das normativ unzureichende natürliche Licht den ganzen Arbeitstag über durch künstliches Licht ergänzt wird.
3,84 durchschnittlicher KEO-Wert e durchschn, %: durch die Formel bestimmt
|
|
Wo e 1 Und e N- KEO-Werte mit Decken- oder kombinierter Beleuchtung am ersten und letzten Punkt des charakteristischen Raumabschnitts, siehe und ;
e i- KEO-Werte an anderen Punkten des charakteristischen Raumabschnitts (i = 2, 3, ... N - 1).
3,85 durchschnittliche Beleuchtung auf der Fahrbahnoberfläche E avg, Lux: Beleuchtung auf der Straßenoberfläche, gewichteter Durchschnitt über die Fläche eines bestimmten Gebiets.
3,86 durchschnittliche Helligkeit der Straßenoberfläche L avg, cd/m 2: Die Helligkeit einer trockenen Straßenoberfläche in Richtung des Auges eines Beobachters, der sich unter Standardbeobachtungsbedingungen auf der Achse einer Fahrspur befindet, gewichteter Durchschnitt über die Fahrbahnfläche eines bestimmten Abschnitts.
3,87 durchschnittliche Helligkeit der Fahrbahn im Übergangsbereich des Tunnels L tr, cd/m2: Die durchschnittliche Helligkeit der trockenen Fahrbahnoberfläche über den Bereich der Fahrbahn in Richtung des Auges des Betrachters, der sich auf der Achse der Fahrbahn im Übergangsbereich des Tunnels befindet.
3,88 durchschnittliche Helligkeit der Schwellenzone des Tunnels L th , cd/m 2: Durchschnittliche Helligkeit der Fahrbahnoberfläche in der ersten Hälfte der Tunnelschwellenzone.
3.89 Standardbedingungen für die Beobachtung bei der Straßenbeleuchtung: Bei der Berechnung der Helligkeit der Fahrbahnoberfläche werden die Beobachtungsbedingungen des Fahrers des Fahrzeugs geregelt, bei denen sich das Auge des Beobachters in einer Höhe von 1,5 m über der Fahrbahnoberfläche befindet und vom berechneten Punkt in einem Abstand entfernt ist Die Sichtlinie ist in einem Winkel (1 ± 0,5)° zur Straßenebene auf den berechneten Punkt gerichtet.
3,90 Strobe-Effekt: Die visuelle Wahrnehmung einer scheinbaren Veränderung, eines Aufhörens der Rotationsbewegung oder einer periodischen Schwingung eines Objekts, das durch Licht beleuchtet wird, das mit einer ähnlichen, zusammenfallenden oder mehreren Frequenzen variiert.
3.91 Tunnelverkehrszone: Teil des Tunnelbaukomplexes mit der eigentlichen Fahrbahn, eingeschlossen zwischen Ein- und Ausgangsportal.
3,92 Gehweg: Fußgängerbereich der Straße.
3,93 spezifische Leistung ω, W/m2: Die installierte Leistung der künstlichen Beleuchtung im Raum geteilt durch die Nutzfläche.
3.94 Straße: Ein auf einer oder beiden Seiten ganz oder teilweise von Gebäuden umschlossener Raum mit einer Fahrbahn für Fahrzeuge, Fußgängerwegen und gegebenenfalls Fahrradwegen.
3,95 bedingte Arbeitsfläche: Eine bedingte horizontale Fläche in einer Höhe von 0,8 m über dem Boden.
3,96 eingestellte Fahrgeschwindigkeit: Maximale Auslegungsgeschwindigkeit des Transports.
3.97 Nützliche Außenbeleuchtung: Stationäre Beleuchtung soll eine sichere und komfortable Bewegung von Fahrzeugen und Fußgängern gewährleisten.
3,98 Straßenabschnitt mit Standard-Fahrbahngeometrie: Ein Straßen- oder Straßenabschnitt, dessen Fahrbahn eine ebene rechteckige Fläche ist, deren Länge durch Standardbeobachtungsbedingungen bestimmt wird.
Notiz.
Für Abschnitte mit einheitlicher Fahrbahngeometrie sind sowohl die Helligkeit als auch die Ausleuchtung der Fahrbahnoberfläche standardisiert.
3,99 Straßenabschnitt mit nicht standardmäßiger Fahrbahngeometrie: Ein Abschnitt einer Straße oder Straße, der Abweichungen von der Standardgeometrie aufweist, z. B. Kurven, Gabelungen, Ein- und Ausfahrten von Überführungen, gekrümmte Abschnitte (im Grundriss und Profil) usw.
Notiz.
Für Bereiche mit abweichender Fahrbahngeometrie ist lediglich die Ausleuchtung der Fahrbahnoberfläche normiert.
3.100 Flimmern: Subjektive Wahrnehmung von Schwankungen des Lichtstroms künstlicher Lichtquellen in Betrag und Zeit.
3.101 Flimmereffekt (bei Tunnelbeleuchtung): Der Effekt des monotonen Flackerns heller Teile von Lampen und ihrer Reflexionen von der Karosserie, die bei bestimmten Frequenzintervallen und Dauer des Flackerns zu Irritationen beim Fahrer führen.
3.102 Hintergrund: Die Oberfläche, die direkt an das Objekt der Unterscheidung angrenzt, auf dem es betrachtet wird.
Als Hintergrund gilt: Licht – wenn der Oberflächenreflexionsgrad mehr als 0,4 beträgt; Durchschnitt - gleich, von 0,2 bis 0,4; dunkel - das gleiche, weniger als 0,2.
3.103 Charakteristischer Raumausschnitt: Ein Querschnitt in der Raummitte, dessen Ebene senkrecht zur Ebene der Verglasung der Lichtöffnungen (bei seitlicher Beleuchtung) bzw. der Längsachse der Raumspannweiten liegt. Der charakteristische Raumabschnitt sollte Bereiche mit der größten Anzahl von Arbeitsplätzen sowie Punkte im Arbeitsbereich umfassen, die am weitesten von den Lichtöffnungen entfernt sind.
3.104 Farbtemperatur T c, K: Die Temperatur eines Planck-Strahlers (schwarzer Körper), bei der seine Strahlung die gleiche Farbe wie die des betreffenden Objekts hat
3.105 Farbwiedergabe: Ein allgemeines Konzept, das den Einfluss der spektralen Zusammensetzung einer Lichtquelle auf die visuelle Wahrnehmung farbiger Objekte charakterisiert, bewusst oder unbewusst im Vergleich zur Wahrnehmung derselben Objekte, die von einer Standardlichtquelle beleuchtet werden.
3.106 zylindrische Beleuchtung E c, OK: Das Verhältnis des auf die Seitenfläche eines infinitesimalen Zylinders mit Mittelpunkt an einem bestimmten Punkt einfallenden Lichtstroms zur Fläche der Seitenfläche dieses Zylinders.
Anmerkungen:
- Sofern nicht anders angegeben, muss die Zylinderachse vertikal sein.
- In Bezug auf die Innenbeleuchtung wird die zylindrische Beleuchtung als Kriterium zur Beurteilung der Sättigung eines Raumes mit Licht herangezogen.
3.107 Evakuierungsbeleuchtung: Eine Art Notbeleuchtung zur Evakuierung von Personen oder zum Abschluss eines potenziell gefährlichen Vorgangs.
3.108 Notausgang: Ein Ausgang zur Evakuierung von Personen im Notfall zu einem Fluchtweg, der direkt nach draußen oder in einen sicheren Bereich führt.
3.109 äquivalente Größe des Diskriminierungsobjekts: Die Größe eines gleich hellen Kreises auf einem gleich hellen Hintergrund, der bei einer gegebenen Hintergrundhelligkeit den gleichen Schwellenwertkontrast wie das zu unterscheidende Objekt aufweist.
3.110 Energieeffizienz: Merkmale, die das Verhältnis der positiven Wirkung aus der Nutzung von Energieressourcen zum Aufwand an Energieressourcen zur Erzielung einer solchen Wirkung widerspiegeln, in Bezug auf ein Produkt, einen technologischen Prozess, eine juristische Person oder einen einzelnen Unternehmer.
, Artikel 2 Absatz 4]
3.111 Energieeinsparung: Umsetzung organisatorischer, rechtlicher, technischer, technologischer, wirtschaftlicher und sonstiger Maßnahmen, die darauf abzielen, die Menge der eingesetzten Energieressourcen zu reduzieren und gleichzeitig die entsprechenden positiven Auswirkungen ihrer Nutzung aufrechtzuerhalten (einschließlich der Menge der hergestellten Produkte, der durchgeführten Arbeiten und der erbrachten Dienstleistungen).
, Artikel 2, Absatz 3]
3.112 Helligkeit L, cd/m2: Das Verhältnis des Lichtstroms d 2 Ф, der von einem Elementarstrahl übertragen wird, der durch einen bestimmten Punkt geht und sich in einem Raumwinkel dΩ ausbreitet, der eine bestimmte Richtung enthält, zum Produkt der Fläche des Abschnitts dieses Strahls, der durch einen bestimmten Punkt geht Punkt dA, der Kosinus des Winkels θ zwischen der Normalen zu diesem Abschnitt und der Richtung der Strahlstrahlen und dem Raumwinkel dΩ:
![]() .
.
3.113 Helligkeitsanpassung im Zugangsbereich des Tunnels L 20, cd/m2: Durchschnittliche Helligkeit in einem konischen Sichtfeld mit einem Winkel von 20°, wobei der Scheitelpunkt an der Stelle des Auges des Fahrers liegt, der sich dem Tunnel nähert, und die Achse auf die Mitte des Tunneleingangsportals gerichtet ist.
Notiz.
Helligkeitsanpassung L 20 wird in Bezug auf den Fahrer ermittelt, der sich auf dem RBT vom Eingangsportal des Tunnels in der Mitte der entsprechenden Fahrbahn befindet.
4 Allgemeine Bestimmungen
4.1 In diesem Regelwerk für Räumlichkeiten ist die durchschnittliche Beleuchtung einer bedingten Arbeitsfläche für alle Lichtquellen außer in bestimmten Fällen standardisiert.
Die Mindestbeleuchtung an Arbeitsplätzen sollte gemäß SanPiN 2.2.4.3359 nicht mehr als 10 % von der normalisierten durchschnittlichen Beleuchtung im Raum abweichen.
Für die Außenbeleuchtung von Wohngebieten normiert dieses Regelwerk die Ausleuchtung und Helligkeit von Straßenflächen für beliebige Lichtquellen.
Standardisierte Beleuchtungswerte in Lux, die sich um eine Stufe unterscheiden, sollten auf einer Skala genommen werden: 0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 15; 20; dreißig; 40; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 1000; 1250; 1500; 2000; 2500; 3000; 3500; 4000; 4500; 5000.
Standardisierte Oberflächenhelligkeitswerte, cd/m2, die sich um eine Stufe unterscheiden, sollten auf einer Skala genommen werden: 0,2; 0,3; 0,4; 0,6; 0,8; 1; 2; 3; 5; 8; 10; 12; 15; 20; 25; dreißig; 50; 75; 100; 125; 150; 200; 400; 500; 750; 1000; 1500; 2000; 2500.
Für natürliches Licht liefert dieses Regelwerk Werte für den natürlichen Beleuchtungskoeffizienten (LFC).
4.2 Anforderungen an die Raumbeleuchtung Industrieunternehmen(KEO, normalisierte Beleuchtung, kombinierter Indikator für Unbehagen und Beleuchtungspulsationskoeffizient) sollten unter Berücksichtigung der Anforderungen und und berücksichtigt werden.
4.3 Anforderungen an die Beleuchtung von Räumlichkeiten von Wohn-, öffentlichen und Verwaltungsgebäuden (KEO, standardisierte Beleuchtung, zylindrische Beleuchtung, kombinierter Unbehaglichkeitsindikator und Beleuchtungspulsationskoeffizient) sollten gemäß und berücksichtigt werden.
4.4 Bei der Gestaltung natürlicher, künstlicher und kombinierter Beleuchtung sollte zum Ausgleich des Beleuchtungsrückgangs während des Betriebs der Betriebskoeffizient MF nach , eingeführt werden.
4.5 Anforderungen an die Einstrahlung und den Sonnenschutz der Räumlichkeiten werden gemäß SanPiN 2.2.1/2.1.1.1076 erfüllt.
4.6 Messungen der Beleuchtung, Helligkeit und des Beleiner Beleuchtungsanlage werden während der Inbetriebnahme und Überwachung des Beleuchtungszustands während des Betriebs gemäß GOST R 54944, GOST 26824, GOST 33393 durchgeführt. Die Bestimmung des kombinierten Indikators von Unannehmlichkeiten werden in der Entwurfsphase der Beleuchtungsanlage gemäß GOST 33392 durchgeführt.
4.7 Bei der Gestaltung künstlicher und kombinierter Beleuchtung sollten Daten zur vorbeugenden UV-Bestrahlung berücksichtigt werden.
Tabelle 4.1. SP 52.13330.2016
Anforderungen an die Beleuchtung von Industriegebäuden
|
Merkmale der visuellen Arbeit |
Kleinste oder äquivalente Größe des Diskriminierungsobjekts, mm |
Kategorie der visuellen Arbeit |
Unterkategorie „Visuelle Arbeit“. |
Kontrast von Motiv und Hintergrund |
Hintergrundmerkmale |
Künstliches Licht |
Tageslicht |
Kombinierte Beleuchtung |
||||||
|
Beleuchtung, Lux |
Kombination normalisierter Werte des kombinierten Unbehagenindex UGR und des Pulsationskoeffizienten |
KEO e n, % |
||||||||||||
|
mit einem kombinierten Beleuchtungssystem |
mit Allgemeinbeleuchtungssystem |
UGR, nicht mehr |
K p, %, nicht mehr |
mit Decken- oder Kombibeleuchtung |
mit Seitenbeleuchtung |
mit Decken- oder Kombibeleuchtung |
mit Seitenbeleuchtung |
|||||||
|
Einschließlich der Gesamtsumme |
||||||||||||||
| Höchste Präzision | Weniger als 0,15 | |||||||||||||
|
Klein |
Durchschnitt |
|||||||||||||
|
Klein |
Licht |
|||||||||||||
|
Durchschnitt |
Licht |
|||||||||||||
| Sehr hohe Präzision | Von 0,15 bis 0,30 | |||||||||||||
|
Klein |
Durchschnitt |
|||||||||||||
|
Klein |
Licht |
|||||||||||||
|
Durchschnitt |
Licht |
|||||||||||||
| Hohe Präzision | Von 0,30 bis 0,50 | |||||||||||||
|
Klein |
Durchschnitt |
|||||||||||||
|
Klein |
Licht |
|||||||||||||
|
Durchschnitt |
Licht |
|||||||||||||
| Mittlere Genauigkeit | St. 0,5 bis 1,0 | |||||||||||||
|
Klein |
Durchschnitt |
|||||||||||||
|
Klein |
Licht |
|||||||||||||
|
Durchschnitt |
Licht |
|||||||||||||
| Geringe Genauigkeit | St. 1 bis 5 | |||||||||||||
|
Klein |
Durchschnitt |
|||||||||||||
|
Klein |
Licht |
|||||||||||||
|
Durchschnitt |
Licht |
|||||||||||||
| Grob (sehr geringe Präzision) | Mehr als 5 |
Unabhängig von den Eigenschaften des Hintergrunds und dem Kontrast des Objekts zum Hintergrund |
||||||||||||
| Arbeiten mit leuchtenden | ||||||||||||||
Details zum Regelwerk
AUFTRAGNEHMER - Landeshaushaltsinstitution „Forschungsinstitut für Bauphysik der Russischen Akademie für Architektur und Bauwissenschaften“ (NIISF RAASN) und Gesellschaft mit beschränkter Haftung „CERES-EXPERT“ (LLC „CERES-EXPERT“)
EINGEFÜHRT vom Technischen Komitee für Normung TC 465 „Konstruktion“
VORBEREITET zur Genehmigung durch die Abteilung für Stadtentwicklung und Architektur des Ministeriums für Bauwesen, Wohnungswesen und kommunale Dienstleistungen der Russischen Föderation (Ministerium für Bauwesen Russlands)
GENEHMIGT durch Beschluss des Ministeriums für Bauwesen, Wohnungswesen und kommunale Dienstleistungen der Russischen Föderation vom 7. November 2016 Nr. 777 / in Kraft getreten am 8. Mai 2017.
REGISTRIERT von der Bundesagentur für technische Regulierung und Metrologie (Rosstandart). Überarbeitung von SP 52.13330.2011 „SNiP 23-05-95 Natürliche und künstliche Beleuchtung“
Einführung
Dieses Regelwerk enthält Anforderungen, die den Zielen des Bundesgesetzes vom 30. Dezember 2009 Nr. 384-FZ „Technische Vorschriften für die Sicherheit von Gebäuden und Bauwerken“ entsprechen und unter Berücksichtigung von Artikel 46 Teil 1 zwingend einzuhalten sind des Bundesgesetzes vom 27. Dezember 2002 Nr. 184-FZ „Über technische Vorschriften“, des Bundesgesetzes vom 23. November 2009 Nr. 261-FZ „Über Energieeinsparung und Steigerung der Energieeffizienz sowie über die Einführung von Änderungen bestimmter Rechtsakte der Russische Föderation".
Das Regelwerk legt Standards für die natürliche, künstliche und kombinierte Beleuchtung von Gebäuden und Bauwerken sowie Standards für die künstliche Beleuchtung von Wohngebieten, Betriebsgeländen und Arbeitsstätten außerhalb von Gebäuden fest.
Die Aktualisierung wurde von einem Autorenteam durchgeführt: der staatlichen Haushaltsinstitution „Forschungsinstitut für Bauphysik der Russischen Akademie für Architektur und Bauwissenschaften“ (Kandidat der technischen Wissenschaften I.A. Shmarov, Kandidat der technischen Wissenschaften V.A. Zemtsov, Ingenieur V. V. Zemtsov, Ingenieur L.V. Brazhnikova, Kandidat der technischen Wissenschaften E.V. Korkina); LLC „CERERA-EXPERT“ (Ingenieur E.A. Litvinskaya) unter Beteiligung der LLC „Allrussisches Institut für Forschung, Design und Ingenieurwesen, benannt nach S.I. Vavilov“ (Ingenieur A.Sh. Chernyak, Ph.D. Wissenschaften A.A. Korobko); Russische Medizinische Akademie für postgraduale Ausbildung des Gesundheitsministeriums Russlands (Doktor der medizinischen Wissenschaften T.E. Bobkova); Föderale staatliche autonome Einrichtung „Wissenschaftliches Zentrum für Kindergesundheit“ des Gesundheitsministeriums Russlands (Kandidat der Biowissenschaften L.M. Teksheva); UN-Entwicklungsprogramm (dt. A.S. Shevchenko), CJSC „Svetlana-Optoelectronics“ (Kandidat der technischen Wissenschaften A.A. Bogdanov) OJSC NIPI „TYAZHPROM-ELECTROPROJECT“ (Ingenieur Z.K. Gobacheva).
Normative Verweisungen
Dieses Regelwerk verwendet regulatorische Verweise auf die folgenden Dokumente:
GOST 21.607-2014 System der Entwurfsdokumentation für den Bau. Regeln für die Umsetzung der Arbeitsdokumentation für elektrische Außenbeleuchtung.
GOST 21.608-2014 System der Entwurfsdokumentation für den Bau. Regeln für die Umsetzung der Arbeitsdokumentation für die elektrische Innenbeleuchtung.
GOST 111-2014 Farbloses Flachglas. Technische Bedingungen.
GOST 5406-84 Emails NTs-25. Technische Bedingungen.
GOST 9754-76 Emails ML-12. Technische Bedingungen.
GOST 10982-75 Weiße EP-148-Emaille für Kühlschränke und andere Elektrogeräte. Technische Bedingungen.
GOST 14254-96 (IEC 529-89) Schutzgrade durch Gehäuse (IP-Code).
GOST 26824-2010 Gebäude und Bauwerke. Methoden zur Helligkeitsmessung.
GOST 27900-88 (IEC 598-2-22) Lampen für Notbeleuchtung. Technische Anforderungen.
GOST 30826-2014 Mehrschichtiges Glas. Technische Bedingungen.
GOST 31364-2014 Glas mit weicher Beschichtung mit niedrigem Emissionsgrad. Technische Bedingungen.
GOST 32997-2014 In der Masse gefärbtes Flachglas. Allgemeine technische Bedingungen.
GOST 33017-2014 Glas mit Sonnenschutz- oder dekorativer Hartbeschichtung. Technische Bedingungen.
GOST 33086-2014 Glas mit Sonnenschutz- oder dekorativer Weichbeschichtung. Technische Bedingungen.
GOST 33392-2015 Gebäude und Bauwerke. Methode zur Bestimmung des Unbehaglichkeitsindex bei künstlicher Beleuchtung von Räumlichkeiten.
GOST 33393-2015 Gebäude und Bauwerke. Methoden zur Messung des Pulsationskoeffizienten der Beleuchtung.
GOST EN 410-2014 Glas und daraus hergestellte Produkte. Methoden zur Bestimmung optischer Eigenschaften. Bestimmung von Licht- und Solareigenschaften.
GOST IEC 60598-2-22-2012 Lampen. Teil 2-22. Private Anforderungen. Lampen für Notbeleuchtung.
GOST R 12.4.026-2001 System der Arbeitssicherheitsstandards. Signalfarben, Sicherheitszeichen und Signalmarkierungen. Zweck und Nutzungsregeln. Allgemeine technische Anforderungen und Eigenschaften. Testmethoden.
GOST R 54350-2015 Beleuchtungsgeräte. Beleuchtungsanforderungen und Prüfmethoden.

 , Wo
, Wo