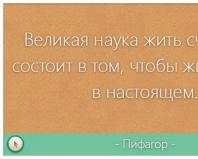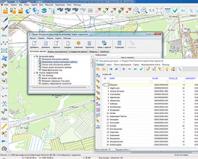So berechnen Sie Resonanzfrequenzen in einem Raum. Vollversion anzeigen. Reflexionspunkte definieren
Obwohl akustische Reflexionen zu Problemen bei der Klarheit der Mischung führen können, sind die von Mike Senior vorgeschlagenen Lösungen kostengünstig und umsetzbar, sodass Ihnen das Problem des „Kammfiltereffekts“ nicht in den Sinn kommt. Wege bei der Erstellung eines Werbespots Notenaufnahme. Es ist nicht verwunderlich, dass die Besitzer hochmoderner Studios in die gleiche Richtung gingen. Es gibt jedoch noch einen weiteren Aspekt der Akustikgestaltung, der aufgrund der Komplexität des Problems und der hohen Kosten fast oft und bewusst vernachlässigt wird – die Raumresonanz.
Mike Senior:„Um zu verstehen, wie die Resonanz eines Raumes funktioniert, muss man verstehen, wie er mitschwingt Gitarrensaite. Bei ihrer niedrigsten Resonanzfrequenz (der ersten Stufe oder, wie man sagt, dem „Grundton“) steht die Saite an den Enden still und schwingt hauptsächlich in der Mitte. Die Saite hat jedoch eine zweite Resonanztonalität (zweite Ebene oder Oberton) – sie ist doppelt so hoch wie die erste Frequenz, als ob die Saite in zwei gleich schwingende Teile geteilt wäre. Bei der dritten Resonanztonalität (dritte Ebene oder zweiter Oberton) ist die Saite bereits in drei gleiche Teile geteilt, bei der Quarte in vier usw. Spitze des Spektrums. 
Warum wir ein Beispiel mit einer Schnur brauchten, damit Sie geistig verstehen, dass der Luftraum eines Raums zwischen seinen parallelen Grenzen (z. B. zwischen seinen gegenüberliegenden Wänden oder Boden und Decke) die gleiche Reihe von Resonanzfrequenzen aufweist. Eine einfache, aber nicht sehr genaue Möglichkeit, die erste Resonanzfrequenz eines Raums zu ermitteln, besteht darin, die Zahl 172 durch den Abstand zwischen zwei parallelen Grenzen des Raums selbst (in Metern) zu dividieren. Nachfolgende Obertonwerte sind Vielfache, wie im Saitenbeispiel. Wenn sich die Decke Ihres Studios beispielsweise 2,42 m über dem Boden befindet, liegt die erste Resonanzfrequenz des Raums (in der Ebene „Boden-Decke“) bei 71 Hz, die zweite bei 142 Hz und die dritte bei 213 Hz usw.
Jede Ebene der Resonanzfrequenzen des Raumes teilt den Abstand zwischen seinen Grenzen auf seine eigene Weise auf und schafft so eigene gleiche Intervalle. Und wenn Ihr Hörpunkt zwischen diesen Intervallen liegt, dann hören Sie im Klangspektrum des Raumes eine Abnahme des Pegels bei dieser Resonanzfrequenz, und wenn Ihr Hörpunkt in der Mitte des Intervalls liegt, führt dies zu dessen Anstieg . Da jedes Paar paralleler Flächen seine eigene Reihe von Resonanzfrequenzen einführt (und die meisten Räume eine „rechteckige“ Form haben, also drei Paare), ist der Studioraum großzügig mit Intervallen unterschiedlicher Frequenzen in drei Ebenen übersät. 
Abbildung: Das Diagramm zeigt den Einfluss der Raumresonanz auf den Frequenzgang des Monitorsystems. Die Abbildung zeigt die Resonanzfrequenzpegel eines Raumes mit einer Länge von 4,3 Metern von der Vorder- bis zur Rückwand. Resonanz tritt bei 40 Hz, 80 Hz, 120 Hz und 160 Hz auf. Der Buchstabe N markiert die Grenzen der Intervalle und der Buchstabe A markiert die Mitte des Intervalls. Sie müssen verstehen, dass sie in der Abbildung zum besseren Verständnis separat dargestellt sind, in Wirklichkeit jedoch vollständig übereinander liegen. In zwei Abschnitten wird veranschaulicht, wie sich der Frequenzgang ändert, wenn der Hörplatz auf eine Entfernung von 75 cm verschoben wird.
Was bedeutet das alles in der Praxis? Dies bedeutet, dass bereits die erste Ebene der Resonanzfrequenzen des Raumes das Spektrum im Resonanzbereich problemlos um 20 dB anhebt. Nur ein fliegendes Schwein ist wahrscheinlich in der Lage, im Studio eine Stelle zu finden, die bei mehreren gleichzeitigen Resonanzen die richtige spektrale Balance liefert. Wenn Sie sich außerdem im Studio bewegen, „krümmt“ sich der Frequenzgang des Monitorsystems, als wäre er „bereits in einer Bratpfanne“. Ich habe versucht, die Veränderungen im Frequenzgang in der Abbildung darzustellen. Aber um genau zu sein, würde ich sagen, dass es in erster Linie auf die Höhe der Resonanzfrequenzen ankommt Unterteil Spektrum, da hochfrequente Resonanzen durch die richtige Raumumgebung leichter gedämpft werden, verbleibende Stresszonen unter 1 kHz beeinträchtigen jedoch das richtige Mischen erheblich.
Da jeder Raum eine andere Struktur hat, führen Sie dieses Experiment durch, um ein reales Bild von der Auswirkung der Raumresonanz auf Ihr Monitorsystem zu erhalten: Spielen Sie die LFSineTones-Datei ab, während Sie an der Hörposition vor den Monitoren sitzen, und vergleichen Sie die relative Lautstärke des reinen Sinus Halbtöne. Sie werden in aufsteigender Reihenfolge über einen Bereich von drei Oktaven gespielt. Wenn Ihr Studio wie kleine, unprofessionell vorbereitete Kontrollräume ist, werden Sie feststellen, dass einige Mitteltöne kaum hörbar sind, während andere deutlich laut sind. Tabelle 1 zeigt, welche Halbtöne sowie deren Frequenzen im Zeitverlauf in der LFSineTones-Datei abgespielt werden. Schnappen Sie sich also einen Bleistift und markieren Sie die störenden Frequenzen, die im Pegel auffallen. Bewegen Sie sich nun von Ihrem Hörpunkt einige Dutzend Zentimeter in eine beliebige Richtung, und Sie werden feststellen, dass die Frequenzen, die überaktiv waren, jetzt leise sind und die Frequenzen, die zuvor ruhig waren, überaktiv sind.
Man kann durchaus mit Fug und Recht sagen, dass Sinuswellen wenig mit echter Musik zu tun haben. Sie müssen sich also darauf konzentrieren, wie sich die Raumresonanz tatsächlich auf die Basslinie professioneller kommerzieller Titel auswirkt (mit diesem Thema haben sie ja bekanntlich keine Probleme). Als Standard biete ich den Song „All Four Seasons“ an, er wurde von Hugh Padgham für das Streicheralbum Mercury Falling erfunden und gemischt. Der Bassbereich dieses Titels ist ziemlich breit, aber auch äußerst konsistent, sodass die Bassnoten in diesem Song bei der Wiedergabe auf jedem Abhörsystem ziemlich flach sind. Wenn sich beim Hören herausstellt, dass sie ungleichmäßig sind, dann sollte man ernsthaft darüber nachdenken, wie man in dieser Situation richtig mischt.“
Optimierung der Lautsprecherplatzierung in einem rechteckigen Raum
Für Leistung Gute Qualität Tonwiedergabe, Akustische Eigenschaften Hörräume müssen bestimmten optimalen Werten angenähert werden. Dies wird durch die Gestaltung einer „akustisch korrekten“ Raumgeometrie sowie durch eine spezielle akustische Veredelung der Innenflächen von Wänden und Decke erreicht.
Aber sehr oft hat man es mit einem Raum zu tun, dessen Form nicht verändert werden kann. Gleichzeitig können sich raumeigene Resonanzen äußerst negativ auf die Klangqualität der Geräte auswirken. Ein wichtiges Instrument zur Reduzierung des Einflusses von Raumresonanzen ist die Optimierung relative Position akustische Systeme relativ zueinander, umschließende Strukturen und Hörbereich.
Die angebotenen Rechner sind für Berechnungen in rechteckigen symmetrischen Räumen mit geringem Schallabsorptionsvermögen konzipiert.
|
|
|
|
|
|
|
|
Die praktische Anwendung der Ergebnisse dieser Berechnungen wird den Einfluss von Raummoden reduzieren, die Klangbalance verbessern und den Frequenzgang des „AC-Raum“-Systems bei niedrigen Frequenzen ausgleichen.
Es ist zu beachten, dass die Berechnungsergebnisse nicht unbedingt zur Schaffung einer „idealen“ Klangbühne führen, sondern lediglich die Korrektur akustischer Mängel betreffen, die vor allem durch den Einfluss unerwünschter Raumresonanzen verursacht werden.
Die Berechnungsergebnisse können jedoch ein guter Ausgangspunkt für die weitere Suche nach dem aus dieser Sicht optimalen Standort des Lautsprechers sein individuelle Vorlieben Hörer.
Bestimmung der Orte der ersten Reflexionen
Ein Zuhörer in einem Raum, der Musik hört, nimmt nicht nur den abgestrahlten Direktschall wahr Akustische Systeme, aber auch Reflexionen von Wänden, Böden und Decken. Intensive Reflexionen von einigen Bereichen der Innenflächen des Raumes (Bereiche der ersten Reflexionen) interagieren mit dem Direktschall der Lautsprecher, was zu einer Änderung des Frequenzgangs des vom Hörer wahrgenommenen Schalls führt. Gleichzeitig wird der Schall bei manchen Frequenzen verstärkt, bei anderen deutlich abgeschwächt. Dieser akustische Defekt, „Kammfilterung“ genannt, führt zu einer unerwünschten „Färbung“ des Klangs.
Durch die Steuerung der Intensität früher Reflexionen können Sie die Qualität der Klangbühne verbessern und die Lautsprecher klarer und detaillierter klingen lassen. Die wichtigsten frühen Reflexionen stammen von Bereichen an den Seitenwänden und der Decke zwischen dem Hörbereich und den Lautsprechern. Außerdem, großer Einfluss Reflexionen von der Rückwand können die Klangqualität beeinträchtigen, wenn sich der Hörbereich zu nahe daran befindet.
In Bereichen, in denen sich frühe Reflexionsstellen befinden, empfiehlt es sich, schallabsorbierende Materialien oder schallstreuende Strukturen (akustische Diffusoren) anzubringen. Die akustische Bearbeitung von Frühreflexionsstellen muss dem Frequenzbereich angemessen sein, in dem akustische Verzerrungen am stärksten beobachtet werden (Kammfiltereffekt).
Die linearen Abmessungen der verwendeten Akustikbeschichtungen sollten 500–600 mm betragen weitere Größen Orte erster Überlegungen. Parameter der erforderlichen akustischen Endbearbeitung in jedem konkreter Fall Es wird empfohlen, einen Akustikingenieur zu konsultieren.
| " |
Berechnung  Helmholtz-Resonator
Helmholtz-Resonator
Der Helmholtz-Resonator ist ein schwingendes System mit einem Freiheitsgrad und kann daher auf eine bestimmte Frequenz reagieren, die seiner Eigenfrequenz entspricht.
Ein charakteristisches Merkmal des Helmholtz-Resonators ist seine Fähigkeit, niederfrequente Eigenschwingungen auszuführen, deren Wellenlänge deutlich größer ist als die Abmessungen des Resonators selbst.
Diese Eigenschaft des Helmholtz-Resonators wird in der Architekturakustik genutzt, um sogenannte schlitzresonante Schallabsorber (Slot Resonator) herzustellen. Je nach Bauart absorbieren Helmholtz-Resonatoren Schall bei mittleren und tiefen Frequenzen gut.
Im Allgemeinen ist das Absorberdesign Holzrahmen, montiert an der Oberfläche einer Wand oder Decke. Ein Satz Holzbretter wird am Rahmen befestigt, wobei zwischen ihnen Lücken gelassen werden. Der Innenraum des Rahmens ist ausgefüllt schallabsorbierendes Material. Die Resonanzfrequenz der Absorption hängt vom Querschnitt der Holzbretter, der Tiefe des Rahmens und der Schallabsorptionsleistung des Dämmmaterials ab.
fo = (c/(2*PI))*sqrt(r/((d*1,2*D)*(r+w))), Wo
w- Breite Holzbrett,
R- Spaltbreite,
D- Dicke des Holzbrettes,
D- Rahmentiefe,
Mit- Schallgeschwindigkeit in Luft.
Wenn Sie in einem Design Streifen unterschiedlicher Breite verwenden und diese mit ungleichen Abständen befestigen und außerdem einen Rahmen mit variabler Tiefe herstellen, können Sie einen Absorber bauen, der über ein breites Frequenzband effektiv arbeitet.
Der Aufbau des Helmholtz-Resonators ist recht einfach und kann kostengünstig und zusammengebaut werden verfügbaren Materialien direkt im Musikzimmer oder Studioraum während der Bauarbeiten.
| " |
Berechnung eines Panel-NF-Absorbers  Konvertierungstyp (NCHKP)
Konvertierungstyp (NCHKP)
Der Plattenabsorber vom Konvertierungstyp ist aufgrund seines einfachen Designs und seiner Optik ein recht beliebtes Mittel zur akustischen Behandlung von Musikräumen hohe Effizienz Absorption im Niederfrequenzbereich. Ein Plattenabsorber ist ein starrer Rahmenresonator mit einem geschlossenen Luftvolumen, hermetisch abgeschlossen durch eine flexible und massive Platte (Membran). Als Membranmaterial werden meist Sperrholz- oder MDF-Platten verwendet. Im Innenraum des Rahmens ist ein wirksames schallabsorbierendes Material angebracht.
Schallschwingungen versetzen die Membran (Panel) und das daran befestigte Luftvolumen in Bewegung. Dabei kinetische Energie Membran umgewandelt wird Wärmeenergie durch innere Verluste im Membranmaterial und die kinetische Energie von Luftmolekülen wird durch viskose Reibung in der Schallabsorberschicht in Wärmeenergie umgewandelt. Daher nennen wir diese Art der Absorberumwandlung.
Der Absorber ist ein Masse-Feder-System und hat daher eine Resonanzfrequenz, bei der er am effektivsten arbeitet. Der Absorber kann durch Veränderung seiner Form, seines Volumens und seiner Membranparameter auf den gewünschten Frequenzbereich abgestimmt werden. Die genaue Berechnung der Resonanzfrequenz eines Plattenabsorbers ist ein komplexes mathematisches Problem, und das Ergebnis hängt davon ab große Menge Ausgangsparameter: Befestigungsart der Membran, geometrische Abmessungen, Gehäusedesign, Schallabsorbereigenschaften usw.
Durch die Verwendung einiger Annahmen und Vereinfachungen können wir jedoch ein akzeptables praktisches Ergebnis erzielen.
In diesem Fall die Resonanzfrequenz fo kann durch die folgende Bewertungsformel beschrieben werden:
fo=600/qm(m*d), Wo
M- Oberflächendichte der Membran, kg/qm
D- Rahmentiefe, cm
Diese Formel gilt für den Fall, dass der Innenraum des Absorbers mit Luft gefüllt ist. Wird im Inneren ein poröses schallabsorbierendes Material eingebracht, dann hören die Vorgänge im System bei Frequenzen unter 500 Hz auf, adiabatisch zu sein und die Formel wird in ein anderes Verhältnis umgewandelt, das im Online-Rechner „Berechnung eines Plattenabsorbers“ verwendet wird:
fo=500/qm(m*t)
Das Füllen des Innenvolumens der Struktur mit porösem schallabsorbierendem Material verringert den Qualitätsfaktor (Q) des Absorbers, was zu einer Erweiterung seines Betriebsbereichs und einer Erhöhung der Absorptionseffizienz bei niedrigen Frequenzen führt. Die Schallabsorberschicht darf sich nicht berühren Innenfläche Bei Membranen empfiehlt es sich außerdem, einen Luftspalt zwischen Schallabsorber und zu lassen Rückwand Geräte.
Der theoretische Betriebsfrequenzbereich eines Plattenabsorbers liegt innerhalb von +/- einer Oktave relativ zur berechneten Resonanzfrequenz.
Es ist zu beachten, dass in den meisten Fällen der beschriebene vereinfachte Ansatz völlig ausreichend ist. Aber manchmal erfordert die Lösung eines kritischen akustischen Problems mehr präzise Definition Resonanzeigenschaften eines Plattenabsorbers unter Berücksichtigung des komplexen Mechanismus der Biegeverformungen der Membran. Dies erfordert genauere und recht aufwendige akustische Berechnungen.
| " |
Berechnung der Studioraumabmessungen gemäß EBU/ITU-Empfehlungen, 1998
Es basiert auf einer Technik, die 1993 von Robert Walker nach einer Reihe von Studien der Forschungsabteilung der Ingenieurabteilung der Luftwaffe entwickelt wurde. Als Ergebnis wurde eine Formel vorgeschlagen, die das Verhältnis der linearen Abmessungen eines Raumes in einem relativ weiten Bereich regelt.
Im Jahr 1998 wurde diese Formel von der Europäischen Rundfunkunion (Technische Empfehlung R22-1998) und der Empfehlung der Internationalen Fernmeldeunion (ITU-R BS.1116-1, 1998) als Standard übernommen und für den Einsatz beim Bau von Studioräumen und Musikhörräumen empfohlen .
Das Verhältnis sieht so aus:
1,1 W/h<= l/h <= 4.5w/h - 4,
l/h< 3, w/h < 3
Dabei ist l die Länge, w die Breite und h die Höhe des Raumes.
Darüber hinaus sollten ganzzahlige Verhältnisse der Raumlänge und -breite zu seiner Höhe innerhalb von +/- 5 % ausgeschlossen werden.
Alle Maße müssen den Abständen zwischen den Hauptumfassungskonstruktionen des Raumes entsprechen.
| " |
Berechnung des Schröder-Diffusors 
Um Berechnungen im vorgeschlagenen Rechner durchzuführen, müssen Daten online eingegeben und die Ergebnisse anschließend in Form eines Diagramms auf dem Bildschirm angezeigt werden. Die Nachhallzeit wird gemäß der in SNiP 23-03-2003 „Schutz vor Lärm“ festgelegten Methodik in Oktavfrequenzbändern gemäß der Eyring-Formel (Carl F. Eyring) berechnet:
T (s) = 0,163*V / (−ln(1−α)*S + 4*µ*V)
V - Hallenvolumen, m3
S - Gesamtfläche aller umschließenden Flächen der Halle, m2
α – durchschnittlicher Schallabsorptionskoeffizient im Raum
µ - Koeffizient unter Berücksichtigung der Schallabsorption in der Luft
Die resultierende geschätzte Nachhallzeit wird grafisch mit dem empfohlenen (optimalen) Wert verglichen. Die optimale Nachhallzeit ist diejenige, bei der der Klang des Musikmaterials in einem bestimmten Raum am besten oder die Sprachverständlichkeit am höchsten ist.
Optimale Nachhallzeitwerte werden durch relevante internationale Standards standardisiert:
DIN 18041 Akustische Qualität in kleinen bis mittelgroßen Räumen, 2004
EBU Tech. 3276 – Hörbedingungen für Tonprogramm, 2004
IEC 60268-13 (2. Ausgabe) Soundsystemausrüstung – Teil 13, 1998
Wohnungen für das System
Ich denke oft, dass wir Glück haben, mit zwei Ohren geboren zu werden – wie könnten wir sonst Stereoklang genießen? Natürlich hat jeder Vorteil eine Kehrseite – dieses Geschenk vergiftet das Leben mancher und zwingt sie dazu, viel Zeit damit zu verbringen, mit allen möglichen Teilen und Kabeln herumzuspielen, auf der Suche nach noch größerem Klangvergnügen.
Die Fähigkeit, den Unterschied im Klang von Komponenten zu hören, die Topologie von Schaltkreisen zu ändern, neue Ständer anzubringen und schließlich all das hält die Leidenschaft von HiFi-Fans am Brennen. Einige Experten sind der Meinung, dass wir auf die technischen Eigenschaften von Komponenten achten sollten, andere drängen uns, Teile in Seriengeräten auszutauschen, und wieder andere befürworten einen Systemansatz ...
Bei so viel Aufmerksamkeit für die Hardware vergisst man leicht die Räume, in denen wir sie hören. Dabei hängt die Klangqualität nicht weniger von der Akustik des Raumes als auch von der Qualität der Ausstattung ab. Um dies sicherzustellen, gehen Sie mit einem Freund aus und sprechen Sie mit ihm im Abstand von zwei bis drei Metern. Dann gehen Sie zurück in Ihr Zimmer und machen Sie dasselbe – Sie werden sehen, was ich meine.
Glauben Sie Ihren Ohren
Obwohl sich viele vorstellen können, wie ein Wasserfluss Strom erzeugt, reicht dies noch lange nicht aus, um die Energie akustischer Wellen zu verstehen. Selbst für Spezialisten ist Akustik eine komplexe Wissenschaft, die komplexe Berechnungen und einige intuitive Vermutungen erfordert.
In diesem Artikel werde ich versuchen, das Thema zu vereinfachen, indem ich es in einer Sprache beschreibe, die ein gebildeter Laie verstehen kann. Zunächst müssen Sie Ihren eigenen Ohren vertrauen und bedenken, dass in diesem Bereich alles relativ ist. Hören Sie einfach genau auf Ihr System. Wie klingt es? Volumetrisch? Wohnung? Trocken? Woher kommt der Ton?
Akustische Probleme in einem Hörraum werden höchstwahrscheinlich durch eine Kombination verschiedener Faktoren wie Reflexionen, Resonanzen und vor allem Raumproportionen verursacht. Schauen wir uns das alles der Reihe nach an.
Singende Wände
Jeder weiß, dass Schall von der Wand reflektiert wird. Aber wie passiert das? Trifft eine Schallwelle auf ein Hindernis, wird ein Teil davon reflektiert, ein Teil wird entweder absorbiert oder durchdringt das Hindernis. Je härter und dichter die Wand, desto mehr akustische Energie wird reflektiert – wer gerne Opernarien in einem gefliesten Badezimmer aufführt, weiß, was ich meine.
Schallwellen werden stark gerichtet reflektiert und dadurch entstehen zusätzliche „Bilder“ an der Wand, also entfernt vom Lautsprecher selbst. Sie können die Klarheit des Tonbildes beeinträchtigen. Stellen Sie sich nun vor, was passiert, wenn der Ton von zwei Lautsprechern von sechs Oberflächen in einem Raum reflektiert wird (Decke und Boden nicht vergessen), und Sie werden feststellen, dass das nicht so einfach ist.
Ausgabe in Dispersion
Der beste Weg, mit Reflexionen umzugehen, ist die Streuung, bei der Schallwellen durch unebene Oberflächen zufällig gestreut werden. Wenn das Ergebnis gut ist, hat der Zuhörer das Gefühl, als ob der Schall aus allen Richtungen mit gleicher Kraft käme.
Der wahrscheinlich einfachste Weg, solche Oberflächen zu Hause zu schaffen, ist mit Hilfe von Bücherregalen und anderen hängenden Innenteilen. Oder Sie verwenden einfach ein „Gitter“ für Eier und befestigen es an den Wänden.
Die richtige Platzierung der Streuflächen ist sehr wichtig. Idealerweise sollten sie symmetrisch sein. Achten Sie darauf, sie hinter der Hörposition zu platzieren, um größere Reflexionen von der Rückwand zu reduzieren. Die Streuflächen an den Seitenwänden sollten sich dort befinden, wo das Bild des Lautsprechers vom Hörplatz aus „sichtbar“ ist. Ein Spiegel und ein Freund werden Ihnen bei Ihrer Suche helfen, obwohl ich es normalerweise alleine mache, da ich weiß, dass der Reflexionswinkel einer Schallwelle gleich dem Winkel ihres Einfalls ist.
Häuser und Gärten
Vergessen Sie bei der Einrichtung Ihres Zimmers nicht die Reflexionen. Ein durchschnittlicher Lautsprecher ist in der Lage, Schallwellen mit einer Länge von weniger als 2,5 cm bis über 10 m zu erzeugen. Längere Wellen (tiefe Frequenzen oder Bässe) dringen problemlos durch Möbelstücke. Das Gleiche gilt jedoch nicht für hohe Frequenzen; sie werden von solchen Hindernissen reflektiert. Offensichtlich ist es keine gute Idee, einen Kleiderschrank vor einen Lautsprecher zu stellen.
Denken Sie auch daran, dass es wichtig ist, die Schallstreuung nicht mit der Absorption zu verwechseln, die Vorhängen innewohnt. Obwohl Akustiker häufig Banner oder Vorhänge verwenden, um die Nachhallzeiten in Konzertsälen anzupassen, ist es unwahrscheinlich, dass Ihr Wohnzimmer ein so großer Raum ist, sodass die Probleme dort anders sein werden. Großflächige Vorhänge „saugen“ einfach die gesamte mittlere und hohe Frequenzenergie aus dem Klang und hinterlassen leblose Musik. Versuchen Sie es stattdessen mit Jalousien, die eine gewisse Schalldiffusion, aber keine Schallabsorption bewirken.
Gleiches gilt für Teppiche. Wenn der Boden des Raumes vollständig mit einem dicken Teppich bedeckt ist und die Fenster mit dicken Vorhängen bedeckt sind, wird der Klang noch langweiliger und grauer. Experimentieren Sie wie bei Jalousien nach Möglichkeit mit dünnen, kleinen Teppichen oder Matten, um den Schall zu streuen, anstatt ihn zu absorbieren.
Ich möchte darauf hinweisen, dass Reflexionen hilfreich sein können und einige Zuhörer (wie ich) es vorziehen, wenn der Raum ein wenig „live“ ist. Dies ist natürlich eine Frage des persönlichen Geschmacks, daher müssen Sie wie immer experimentieren, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.
Raumdimensionen in Resonanz
Die Proportionen eines durchschnittlichen Wohnzimmers entsprechen den Schallwellenlängen am unteren Ende des hörbaren Spektrums (zwischen 70 und 140 Hz). Diese Frequenzen liegen im problematischsten Bereich. Wird Musik abgespielt, die Töne enthält, deren Wellenlänge doppelt so groß wie der Raum oder ein Vielfaches davon ist, entstehen Raumresonanzen (Moden) – das lästigste aller akustischen Probleme, die mit gewöhnlichen Räumen einhergehen.
Schallwellen in der Luft bewegen sich mit etwa 330 m pro Sekunde, sodass ein reiner Ton (eine Frequenz) von beispielsweise 31,5 Hz eine Wellenlänge von 330/31,5 hat – etwa 10 m. Wenn dieser Ton in einem Raum erzeugt wird, beträgt die Länge die Hälfte So groß, also 5 m, dann wird eine solche Schallwelle von der Rückwand reflektiert (aber absorbiert) und erreicht genau in dem Moment, in dem der zweite Ton erzeugt wird, die andere Seite des Raumes und verstärkt ihn so Resonanz erzeugen.
Resonanzen (Wellenlänge/Raumgröße) treten auch bei Frequenzen auf, die ein Vielfaches dieser ersten Resonanzfrequenz sind. Der gleiche Effekt tritt gleichzeitig in zwei anderen „Richtungen“ des Raumes auf – Breite und Höhe. Wenn Resonanzen in zwei oder mehr Dimensionen eines Raumes zusammentreffen, entsteht ein unangenehmes Dröhnen.
Überprüfen Sie Ihr Zimmer
Der wohl bedeutendste Faktor, der die Resonanzen beeinflusst, sind die relativen Proportionen des Raumes. Sie können sie mit einem einfachen Taschenrechner und einem Maßband berechnen. Es versteht sich von selbst, dass ein echter Audiophiler, der ein neues Zuhause sucht, dies auf jeden Fall tun wird!
Wenn das Zimmer hat rechteckige Form, messen Sie alle Hauptabmessungen – Höhe, Breite und Tiefe. Dann bauen Sie Ihren eigenen Tisch, indem Sie 330 durch die doppelte Größe Ihres Raums teilen – Sie erhalten die ersten Resonanz-(Modus-)Werte. Die Werte der zweiten Resonanz erhalten Sie, indem Sie diese Werte mit zwei, die dritte mit drei usw. multiplizieren. Es macht keinen Sinn, Resonanzen oberhalb der Quarte zu berechnen, da man sich danach bereits außerhalb der „Gefahrenzone“ befindet.
Als Beispiel habe ich ein typisches Wohnzimmer mit einer Länge von 4,5 m, einer Breite von 3,5 und einer Höhe von 2,3 m genommen. Tabelle 1 zeigt die Ergebnisse. Wenn die Resonanzen in unterschiedlicher Richtung und in beliebiger Reihenfolge zusammenfallen, kommt es natürlich zu einem ungleichmäßigen Frequenzgang im Bass und einem unangenehmen „Bumm“. In unserem Fall etwa 71 Hz und dann -141 Hz. Vergessen Sie nicht, dass der Raum und nicht das System für das „Gemurmel“ verantwortlich ist. Versuchen Sie nicht, Ihre Ausrüstung anzupassen!
Tabelle 1
Raum 4,8 m x 3,6 m x 2,4 m.
Raummaße
1. Grund. Frequenz
2. Grund. Frequenz
106,5 Hz
3. Grund. Frequenz
4. Grund. Frequenz
Aus dieser Tabelle können wir richtig schließen, dass ein quadratischer Raum gleichzeitig in zwei Richtungen schwingt und dementsprechend den Klang noch weiter verschlechtert. Nur ein würfelförmiger Raum wird ihn hinsichtlich der schlechten Akustik übertreffen. Zum Glück gibt es nicht so viele kubische Räume.
Ebenso können mechanische Resonanzen, die dadurch entstehen, dass ein Lautsprecherständer auf Spikes auf einem Holzboden ruht, zu Problemen führen. Letzteres ist gewissermaßen eine Resonanzplatte, die die Gehäuseresonanzen des Lautsprechers verstärkt. Besitzer dieser Böden und Lautsprecher mögen eine hörbare Steigerung der Bassleistung als Verbesserung empfinden, in Wirklichkeit ist der Klang jedoch schlechter. Viel weniger Probleme mit einem Betonboden – ich hoffe, dass Sie das haben.
So verbessern Sie die Raumakustik.
Basierend auf den Schlussfolgerungen des vorherigen Kapitels besteht der einfachste Weg zur Verbesserung der Raumakustik darin, den richtigen Standort für die Installation Ihrer Lautsprecher zu wählen. Dies ist sehr wichtig, da Resonanzen (Moden) stärker angeregt werden, wenn sich Lautsprecher in der Nähe von Wänden befinden, und noch stärker, wenn sie in einer Ecke stehen. In diesem Fall werden die Ecken des Raumes zu unkontrollierbaren Hörnern. Da typische Lautsprecher mit schmaler Frontplatte besser klingen, wenn sie so weit wie möglich von Ecken entfernt platziert werden, kann die Platzierung an der langen Wand des Raums helfen, dieses Problem zu lindern.
Auch wenn der Raum symmetrisch aussieht, ist dies aus akustischer Sicht kaum der Fall. Daher kann eine Klangveränderung durch die Platzierung der Lautsprecher an der gegenüberliegenden Wand erreicht werden. Eine noch drastischere Lösung besteht darin, die Audioanlage in einen anderen Raum zu verlegen. Vergessen Sie natürlich nicht, es vorher auf Resonanzen zu prüfen!
Durch Experimente habe ich herausgefunden, dass es am besten funktioniert, die Lautsprecher an der Rückwand zu montieren, etwa ein Viertel der Länge des Raums, wobei der Abstand zwischen jedem Lautsprecher und den Seitenwänden etwa ein Viertel der Breite des Raums beträgt. Dann muss sich der Zuhörer in einem Abstand von einem Viertel der Raumlänge von der Vorderwand positionieren.
Böden und Decken.
Wenn Ihre Lautsprecher mit Spikes auf einem Holzboden stehen und Sie unter unerwünschten Resonanzen leiden, können Sie den Klang verbessern, indem Sie vor der Installation des Spikes-Lautsprechers eine dünne, flexible Filzmatte, z. B. eine Marmorplatte, auf den Lautsprecher legen.
Die Höhe des Hörraums ist oft die größte Ursache für die Klangverschlechterung, da eine typische Deckenhöhe von etwa 2,4 m der Hälfte der 71,5-Hz-Wellenlänge entspricht, was zu störendem Dröhnen führen kann. Natürlich ist es unwahrscheinlich, dass Sie Bücherregale an der Decke anbringen können, aber Sie können dort schmale Holzlatten unterschiedlicher Dicke anbringen, die als Diffusor fungieren. Das ist übrigens eine recht originelle Inneneinrichtung.
Hohle Schönheiten.
In den USA ist es unter Audiophilen in Mode gekommen, in Hörräumen sogenannte Trap Pipes zu installieren, um Resonanzen und Nachhall zu bekämpfen. Fallrohre sind zylindrische Vorrichtungen aus Glasfaserrohren mit einem Durchmesser von etwa 28 cm, deren halber Umfang mit einer perforierten Metallplatte bedeckt ist und deren gebogene Metalloberfläche nach außen in den Raum gerichtet ist. Theoretisch funktioniert eine solche Falle teilweise als Röhren- und teilweise als Kammerresonator.
Nach Angaben des Herstellers sind diese Geräte für niederfrequenten Schall transparent, sodass akustische Energie unter 440 Hz absorbiert wird, höhere Frequenzen reflektiert die Falle jedoch mäßig und fungiert dann als dissipative Oberfläche. Einer der Hersteller von Fallrohren in den USA ist ASC. Für alle, die mehr über diese Geräte erfahren möchten, stellen wir die Internetadresse zur Verfügung -
Frequency liebt Reinheit.
In Aufnahmestudios kommen spezielle Resonatoren zum Einsatz, die nach einem ähnlichen Prinzip Rohre einfangen und unerwünschte Frequenzen selektiv absorbieren oder deren Pegel anpassen. Dabei handelt es sich in der Regel um perforierte oder massive Flachpaneele, die mit einem Luftspalt an der Wand montiert und manchmal teilweise mit künstlichem Material wie Glasfaser gefüllt sind.
Die Funktionsweise dieser Geräte besteht darin, dass die Luft als Feder fungiert und Schallenergie absorbiert, ähnlich wie wenn man über den Hals einer Flasche bläst und einen Ton erzeugt. In diesem Fall ist der Flaschenhals der Flaschenkörper und die Luft fungiert als Feder. Die Herstellung eines solchen Resonanzgeräts ist relativ einfach und kostengünstig. Sie müssen die Holzlatten an der Wand befestigen und die Paneele daran aufhängen, dann entsteht ein Luftspalt zwischen ihnen und der Wand. Die korrekte Platzierung dieser Paneele ist jedoch viel schwieriger. Wenn Sie sich also für diesen Weg entscheiden, wenden Sie sich besser an einen Akustikspezialisten, der die Proportionen Ihres Raums analysiert und Sie bei der optimalen Platzierung der Paneele berät. Es kostet Sie möglicherweise nur einen Bruchteil des Geldes, das Sie sonst für die Aufrüstung Ihres Systems ausgeben würden.
Möchten Sie übrigens eine Idee? Ich persönlich habe noch nicht versucht, einen Haufen leerer Bierflaschen in der Ecke meines Zimmers stehen zu lassen, aber ein echter Audiophiler sollte alles versuchen, um den besten Klang zu erzielen!
Halten Sie sich an den Goldenen Schnitt.
Die Erwähnung von Bier erinnerte mich an die allerbeste Version des Raumes. Ich muss jedoch warnen, dass diese Methode nichts für schwache Nerven ist, da Sie wahrscheinlich Ihr Zuhause umbauen oder erweitern müssen! Eines Abends, als ich anhand der Proportionen meines Zimmers Berechnungen über einen großen Becher anstellte, dachte ich, was passieren würde, wenn seine Abmessungen dem bekannten Goldenen Schnitt entsprächen.
Der Goldene Schnitt basiert auf der Fibonacci-Reihe -1, 2, 3, 5, 8,13, 21, 34, 55 usw. Darin ist jeder nachfolgende Term gleich der Summe der beiden vorherigen. Wenn Sie in dieser Reihe weiter nach oben gehen, wird der Quotient einer beliebigen Zahl dividiert durch die vorherige sehr nahe am Goldenen Schnitt liegen, dessen Wert 1,6180339887 beträgt.
Ich habe festgestellt, dass bei einem Raum mit Proportionen, die auf dem Goldenen Schnitt basieren, die Resonanzfrequenzen für Höhe, Länge und Breite kein Vielfaches sind und sich somit gegenseitig aufheben. Tabelle 2 zeigt das Ergebnis.
Tabelle 2
Raum 6,3m x 3,9m x 2,4m
Raummaße
1. Grund. Frequenz
2. Grund. Frequenz
3. Grund. Frequenz
4. Grund. Frequenz
Da ich außerdem vorhatte, mein Haus zu erweitern, beschloss ich, die Gelegenheit zu nutzen und einen Raum mit diesen Proportionen zu bauen. Und was denkst du? Es funktionierte! Hier ist also mein Rat. Bevor Sie Geld für die „Aufrüstung“ von Geräten ausgeben, nehmen Sie ein Maßband und überprüfen Sie Ihr Zimmer. Vielleicht ist es Zeitverschwendung, vielleicht sparen Sie dadurch viel Geld und Nerven.
Übrigens habe ich endlich die Kondensatoren ausgetauscht!
David Lewis Er war 27 Jahre lang als Architekt tätig und verfügt über Erfahrung im Bau von Kunstsalons, Radiostudios und Tonstudios. Derzeit an der Gestaltung eines Proberaums für eines der führenden Orchester Londons beteiligt.
15.03.2007, 16:02
Es gibt Akustik (kleine Standlautsprecher) und es gibt eine beeindruckende Resonanz bei 55 Hertz (die Breite des Raumes beträgt 3,25 m, die Länge beträgt 5,62 m, die Lautsprecher befinden sich an einer langen Wand, etwa 60 cm von der entfernt). Wand, der Hörplatz ist fast an der Wand - hier gibt es keine Optionen). Zu den Möbeln gehören ein Sofa, ein Sessel, ein Fernseher und ein kleines Regal. Teppich auf dem Boden.
Durch Verschieben – die Akustik von der Wand wegbewegen, den Bassreflex dämpfen – lässt sich keine große Verbesserung erzielen.
Vielleicht hilft ein Bassreiniger? Wie berechnet man das? Vielleicht gibt es da ein paar Programme? Oder versuchen Sie es mit anderen Methoden?
Vielen Dank im Voraus an alle, die auf meine Anfrage geantwortet haben. Ich denke, dieses Problem tritt häufig in unseren kleinen Räumen auf :-)
15.03.2007, 16:52
Bitte nennen Sie mir relativ einfache und kostengünstige Möglichkeiten, Raumresonanzen (sofern vorhanden) zu minimieren. Nein!
Allerdings kann man in den Ecken des Raumes leere Kartons bis zur Decke stapeln :)
Es gibt Akustik (kleine Standlautsprecher) und es gibt eine beeindruckende Resonanz bei 55 Hertz (die Breite des Raumes beträgt 3,25 m, die Länge beträgt 5,62 m, die Lautsprecher befinden sich an einer langen Wand, etwa 60 cm von der entfernt). Wand, der Hörplatz ist fast an der Wand - hier gibt es keine Optionen). Zu den Möbeln gehören ein Sofa, ein Sessel, ein Fernseher und ein kleines Regal. Teppich auf dem Boden. Lautsprecher an einer kurzen Wand – auf keinen Fall?
Vielleicht hilft ein Bassreiniger? Wie berechnet man das? Vielleicht gibt es da ein paar Programme? Oder versuchen Sie es mit anderen Methoden? Die Größe eines Viertelraums wird Sie verärgern.
Vielen Dank im Voraus an alle, die auf meine Anfrage geantwortet haben. Ich denke, dieses Problem tritt häufig in unseren kleinen Räumen auf :-) Es ist in Ordnung – es ist 18 m groß – klein, Leute in 12–14 m versuchen, Standlautsprecher zu installieren – es funktioniert.
Abhängen: http://www.acoustic.ua/Article_225.html (http://www.acoustic.ua/Article_225.html)
15.03.2007, 17:23
Es gibt Akustik (kleine Standlautsprecher) und es gibt eine unglaubliche Resonanz bei 55 Hertz ... Sag mir – welche Standlautsprecher?
Wie werden sie auf dem Boden platziert (Spikes, Platte usw.)?
Welche Art von Boden hat der Raum (strukturell)?
Wie haben Sie festgestellt, dass es 55 Hz sind?
Und was bedeutet großartig?
16.03.2007, 17:06
Schweik, danke für den Link. Ich werde auf jeden Fall einen Blick darauf werfen. Was die Platzierung entlang einer kurzen Wand betrifft – weil... Der Raum wird nicht nur für Audio genutzt, eine solche Platzierung ist noch nicht möglich. Ich würde es gerne versuchen, aber meine Möglichkeiten sind begrenzt ... Zu Viktor - Monitor Audio Silver RS 5-Standlautsprechern. Auf 9 kg schweren Platten (30 x 30 Gehweg) + Originalspikes platziert, habe ich versucht, sie ohne Platten zu installieren. Der Boden besteht aus Beton (ein gewöhnliches 5-stöckiges Plattengebäude) + dickes Linoleum. Die 55 Hertz habe ich anhand der Testscheibe von „Salon AV“ ermittelt (es gibt eine Spur mit einem Schnitt von 20 auf 150 Hertz). Genial ist das bei 40 Hz und 60 Hz – deutlich leiser, aber bei 55 drückt es auf die Ohren.
16.03.2007, 17:44
Genial – dann sind 40 Hz und 60 Hz viel leiser und bei 55 drückt es auf die Ohren. Seltsam... .
Es wird angenommen, dass der Monitor Audio Silver RS 5 ab ca. 70–80 Hz normal funktioniert.
Aber... wenn es eine Tatsache ist -
Als kostengünstige Methode kann man leeren Schweik-Boxen auch Zell-Eierkartons hinzufügen, aber... nicht ästhetisch ansprechend :-).
Markenartikel sind nicht billig.
Ich kenne keine einfachen Programme zur Berechnung der Raumakustik.
Bei Bedarf nutzen wir CARA-Programme (http://www.cara.de/). Die gleiche Firma stellt übrigens auch Audioabsorber für andere Frequenzen her (allerdings zu einem höheren Preis...).
Der Einbau anderer Möbel kann Ihnen helfen – weiche Stühle, Regale mit Büchern.
26.03.2007, 05:39
Und auch ein parametrischer Equalizer kann Ihnen helfen. Nur ein guter ist teuer, aber wenn Sie kein besonderer Ästhet sind... plötzlich.
Sie können die Tiefen auch grafisch „reduzieren“. Vielleicht lässt sich das Problem lösen, indem Sie ein paar Dezibel verringern, aber vielleicht helfen auch alle 12 nicht. Es passiert auf unterschiedliche Weise, experimentieren Sie einfach hier.
26.03.2007, 11:28
Ihr sucht am falschen Ort nach einer Lösung für Euer Problem, meine Lieben!
Alles ist sehr einfach.
Sie sollten nicht versuchen, das Phänomen der Resonanz zu verstehen, geschweige denn den Frequenzgang regulieren.
Wichtiger ist in Ihrem Fall das Phänomen des ECHO (manchmal auch Nachhall genannt). Dies lässt sich minimieren, indem man die Wände einfach mit Stoff drapiert, der zu einer Ziehharmonika zusammengebunden ist. Erinnern Sie sich an Faltenröcke? Zeichnen Sie dann das griechische Alphabet-Symbol „Omega“ auf das Papier und drücken Sie es von oben nach unten flach, bis es fast flach ist. Dies ist die Form, die Sie benötigen, um den Stoff auf der gesamten Höhe des Raumes zu befestigen. Mit einem Bürohefter auf einer Holzverkleidung aus 30-50 mm dicken Lamellen. Zwischen Stoff und Wand muss ein Spalt vorhanden sein – auch die Luft in einem geschlossenen Raum ist ein Dämpfer. Jeder Stoff, nicht synthetisch.
Mehrfache Schallreflexionen (die Wand ist weich und nicht flach) werden eliminiert, der Bass dröhnt nicht und höhere Harmonische werden unterdrückt. Der Ton wird klar sein.
In Bezug auf die Unterdrückungseffizienz sind Stoffvorhänge den Eizellen etwas unterlegen. Aber schöner.
Aber muss man in der eigenen Wohnung so anspruchsvoll sein?
Dies geschieht in Proberäumen für Orchester, damit schlechte Intonation und schlechtes Arrangement deutlicher zu hören sind.
Vielleicht ist es einfacher, bei geringerer Lautstärke zuzuhören?
26.03.2007, 16:31
Bitte nennen Sie mir relativ einfache und kostengünstige Möglichkeiten, Raumresonanzen (falls vorhanden) zu minimieren.
:-)
Ich habe Resonanzen mit einem parametrischen Equalizer herausgeschnitten.
18.04.2007, 02:09
Es gibt nur eine Lösung: Stellen Sie Ihre Bodenständer weiter von der Wand weg. Mindestens 1,5 m. Und versuchen Sie, die Bassreflexe, falls vorhanden, zu schließen.
Ich glaube, dass in einem NORMEN Wohnzimmer KEINE Notwendigkeit besteht, besondere akustische Maßnahmen zu ergreifen. Es ist natürlich ratsam, wenn möglich, dafür einen separaten Raum einzurichten, wie ich es getan habe. Aber das ist ein separates Thema.
18.04.2007, 02:14
Übrigens zu Standgeräten.
Obwohl ich preisgünstige Standlautsprecher nicht mag, war ich kürzlich vom Klang der neuen französischen Hochlandakustik positiv überrascht. Klassik, Jazz – WUNDERSCHÖN! Rock ist schrecklich.
Ich empfehle, zuzuhören. ;)
18.04.2007, 17:13
Und es gibt eine gewaltige Resonanz bei 55 Hertz. Entschuldigen Sie den einfältigen Amateur, aber könnten diese 55 Hertz nicht einfach der Einfluss des Stromnetzes sein?
25.04.2007, 22:45
Die akustische Umgebung in einem Raum bei 50 Hertz effektiv zu verändern, ist unrealistisch. Versuchen Sie, das Bassreflexloch zunächst mit einer losen Polyesterwatte zu verschließen und erhöhen Sie dabei nach und nach die Dichte des Stopfens.
Musatov Konstantin
28.04.2007, 21:01
Resonanz 55 Hz ist die Hauptresonanz und kann nicht mit Zellen oder Vorhängen behandelt werden. Obwohl eine allgemeine Dämpfung des Raumes notwendig ist, ist dies eine andere Frage. Der beste Weg, Grundresonanzen zu bekämpfen, ist die Platzierung der Lautsprecher. Höchstwahrscheinlich sollten Sie versuchen, den Lautsprecher so nah wie möglich an der Wand zu platzieren. Wenn auf der Rückseite ein Phasenanschluss vorhanden ist, stecken Sie dort ein paralleles Licht ein. Als nächstes müssen Sie den Abstand zwischen den Lautsprechern so wählen, dass die 55-Hz-Spitze minimal ist. Es ist schwierig, die Abstimmung anhand diskreter Frequenzen der Testscheibe zu beurteilen, da möglicherweise andere Frequenzen angeregt werden. Es ist besser, einen Sweep-Ton zu finden.
15.09.2007, 14:08
Ich habe ein ähnliches Problem, nur ist die Frequenz niedriger – 41Hz.
Was ich nicht gemacht habe, war ein „schwimmender Boden“, eine Akustikdecke, eine Zwischenwand aus 2 Schichten 12-mm-Gipskarton und Mineralwolle und Stangen, in zwei Ecken des Raumes habe ich Regale für CDs aus Gipskarton, Mineralwolle usw. gemacht Riegel.
Ich wechselte die Ausrüstung und schleppte „Jamo C809“-Lautsprecher durch den Raum auf der Suche nach der tiefsten Resonanz im Tieftonbereich.
Müde......
Ich werde stärker und mache etwas anderes, vielleicht kaufe ich ein großes Sofa.
Ich habe von Niederfrequenzstreuern gehört, weiß aber nicht, wie ich sie berechnen und woraus ich sie herstellen soll.
Wenn jemand es weiß, sagen Sie es mir bitte.
Es ist bekannt, dass der Raum einen erheblichen Einfluss auf den Klang von HiFi-Anlagen hat. Über dieses Phänomen wurde sowohl in Fachpublikationen als auch in populärwissenschaftlichen Publikationen ausreichend geschrieben. Vielleicht haben viele unserer Leser dieses Problem unabhängig voneinander untersucht, wenn nicht theoretisch, dann in der Praxis – indem sie den optimalen Standort des akustischen Systems im Raum wählten und versuchten, die Absorptionseigenschaften mithilfe von Teppichen, schweren Vorhängen und Polstermöbeln zu verändern. Da wir über einige zusätzliche Möglichkeiten verfügten, nämlich über unseren Messkomplex, entschieden wir uns auch, an der Untersuchung der Resonanzeigenschaften von Räumen teilzunehmen. Natürlich sind unsere Ergebnisse größtenteils illustrativer Natur, aber es scheint, dass dies genau dann der Fall ist, wenn es nützlicher ist, einmal zu sehen, als hundertmal zu hören ...
Beginnen wir dennoch mit der Theorie. Durch mehrfache Reflexionen an den Wänden im Raum entsteht ein dreidimensionales Klangfeld. Stimmt die Frequenz des Schalls mit einer der Eigenfrequenzen des Raumes überein, so stellt sich im Raumraum eine stabile Verteilung der Amplitude der Druckschwankungen ein und dieser wird als Schall wahrgenommen. Stellen Sie sich vor, wir hätten den Raum mit unserer Stimme zum Singen gebracht (wir können dies tun, indem wir die Schallquelle ausschalten, die die Schwingungen im Raum mit einer ihrer eigenen Frequenzen angeregt hat, und uns vorstellen, dass es keine Dämpfung gibt). Wie wird die Resonanz des Raumes wahrgenommen? Wir werden einen Ton hören, dessen Frequenz natürlich der Frequenz der Quelle entspricht, die wir bereits gedanklich ausgeschaltet haben, und deren Lautstärke sich ändert, wenn sich der Zuhörer im Raum bewegt. Schöne mehrfarbige Figuren in den Figuren zeigen, wie sich die Druckamplitude (Schalllautstärke) im Raum für verschiedene Eigenfrequenzen des Raumes (Zahlen unter den Figuren) mit den Abmessungen lx = 5,6 m, ly = 3,8 m, lz = 3,5 m ändert. Die hellsten Bereiche sind Bereiche mit höheren Druckamplituden. Je höher die Eigenfrequenz ist, desto homogener ist die Verteilung tendenziell. Zahlreiche spitze Stacheln sind nicht erkennbar, als wären sie mit einer Walze überfahren worden. Der Grund liegt in der Schallabsorption, die proportional zum Quadrat der Frequenz zunimmt.
Kehren wir nun zur Realität zurück. Solche stabilen Bilder bestehen im Raum, solange die Tonquelle in Betrieb ist. Sobald es ausgeschaltet wird, beginnt die Amplitude der Schwingungen schnell abzufallen (erinnern Sie sich an das Exponentialgesetz?), und die Abnahmegeschwindigkeit hängt von der Dämpfung im Raum (d. h. vom Exponenten) ab. Je geringer die Dämpfung, desto länger ist die Nachhallzeit – das Echo des Raumes. Aber das ist eine ganz andere Geschichte...
Das Schallfeld des Lautsprechers ist somit untrennbar mit den Resonanzen im Raum verbunden und deren Wechselwirkung erfolgt nach den Gesetzen der Beugung und Interferenz. Dadurch ist nicht nur eine lokale Erhöhung, sondern auch eine Verringerung der Schalldruckamplitude möglich. Und die Felder addieren sich nicht bei einer Frequenz, sondern über den gesamten Bereich der von der Quelle ausgesendeten und der natürlichen Resonanzfrequenzen des Raumes. Die ausgeprägtesten Verteilungen gibt es bei niedrigen Frequenzen, was natürlich auch denjenigen klar war, die versuchten, den Bass zu verstärken, indem sie die Lautsprecher in eine Ecke des Raumes stellten.
Nachdem wir unser Verständnis der Resonanzen in einem Raum mithilfe von Computermodellen aufgefrischt hatten, beschlossen wir, zu sehen, was darin mit dem Klang eines Hi-Fi-Lautsprechers passiert. Durch die Installation von Lautsprechern in einem Raum legen wir die Resonanzverteilungen fest. Der Ort, an dem wir das Mikrofon platzieren, liegt bei einigen Frequenzen in der Zone erhöhter Druckamplitude und bei anderen umgekehrt. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass in einem Raum mit normalem Nachhall die direkte Abstrahlung des Lautsprechers das Ohr dominiert.





Wenn wir die Amplituden-Frequenz-Eigenschaften von Lautsprechern messen, schließen wir normalerweise den Einfluss des Raums aus, d. h. wir führen Messungen wie im freien Feld durch. Dies wird dadurch erreicht, dass man sich möglichst weit von allen Wänden, Böden und Decken entfernt (in der Mitte des Volumens); Für die Strahlung wird ein kurzes Pulssignal verwendet und bei der Registrierung wird ein Zeitfenster verwendet, das alle reflektierten Signale abschneidet. Um den tatsächlichen Beitrag des Raums zu bewerten, verwendeten wir eine kontinuierliche Quelle für weißes Rauschen. In Abb. Abbildung 1 zeigt den Frequenzgang des Lautsprechers (blaue Linie) und den Frequenzgang des Lautsprecher-Raum-Systems (rote Linie), ermittelt in unserem Labor – einem ziemlich großen Raum mit Abmessungen von 7,0, 7,5 und 3,6 m und gut gedämpfte Wände. Es ist deutlich zu erkennen, dass der Raum in diesem Fall eine unbedeutende Rolle spielt – bei niedrigen Frequenzen beträgt der Unterschied nicht mehr als 4 dB, ab 1 kHz ist er praktisch nicht mehr vorhanden. In einem anderen Raum (3,6–3,8–5,5 m), in dem die Wände nicht mit absorbierenden Platten bedeckt sind, ist ihr Einfluss in einer ähnlichen Situation größer (Abb. 2). Man kann jedoch nicht sagen, dass es den Frequenzgang des Lautsprechers radikal zerstört. Aber selbst wenn das Regallautsprechersystem in einem Abstand von 2 m vom Sofa, auf dem der Zuhörer sitzt, auf dem Boden platziert wird (wir haben ein Mikrofon), dann erhalten wir die in Abb. 3. Der Klang wird spürbar bassiger. Vielleicht ist das nicht schlecht für eine Tanzparty... In Abb. In Abb. 4 können Sie deutlich sehen, was mit dem Klang passiert, wenn der Lautsprecher ganz in der Ecke platziert und in einem Abstand von 2 m von der Wand abgehört wird. Leider wird im Bereich bis 1 kHz der ursprüngliche Frequenzgang fast vollständig zerstört. Die Situation ändert sich nicht, wenn Lautsprecher und Mikrofon ausgetauscht werden (Abb. 5). Diagramm in Abb. 6 entspricht der Situation, wenn der Hörer (Mikrofon) sich in einem Abstand von ~20 cm von der Wand befindet und der Sprecher 2 m von ihm entfernt ist.
Versuchen wir, einige Ergebnisse zusammenzufassen und vielleicht einen Rat zu geben. Zunächst stellen wir fest, dass der dargestellte Frequenzgang des Lautsprecher-Raum-Systems etwas übertrieben ist. Erinnern wir uns daran, dass sie mit kontinuierlichem weißem Rauschen gemessen wurden und in diesem Fall buchstäblich alle möglichen Resonanzschwingungen festgestellt und aufrechterhalten werden. Beim Musikhören ist die Situation etwas anders. Dabei spielt die Absorption eine große Rolle, und da Musiksignale oft impulsiverer Natur sind, erreicht der Prozess in einem gut gedämpften Raum im übertragenen Sinne nicht die „Sättigung“. Natürlich müssen Sie bei der Auswahl der Akustik die Art und Größe Ihres Hörraums berücksichtigen. Vielleicht sollten Sie sich nicht immer auf tiefe Bässe konzentrieren. Bitte beachten Sie jedoch, dass auch bei unseren „nichtmusikalischen“ Experimenten der Frequenzgang des Lautsprechers selbst eine wichtige Rolle spielt und es als „Quellenmaterial“ besser ist, eine Akustik mit einer gleichmäßigen (ohne Ungleichgewichte) Frequenz zu haben Antwort. Halten Sie sich beim Aufstellen und Hören von Lautsprechern am besten von Wänden und Ecken fern. Aus Erfahrung können wir Ihnen empfehlen, bei der Einrichtung Ihrer Raumakustikanlage auf wenig musikalisches, aber informatives weißes Rauschen zu setzen. Die Klangveränderung, wenn sich der Lautsprecher im Hörraum bewegt, ist für das Ohr deutlich wahrnehmbar. Sie können sich beispielsweise mit der Referenz-„Stimme“ des weißen Rauschens vertraut machen, indem Sie es über gute Kopfhörer hören oder eine hochwertige Akustik in der Mitte eines gut gedämpften und relativ großen Raums platzieren. Allerdings werden wir nicht besonders auf dieses „Konzert“ bestehen...